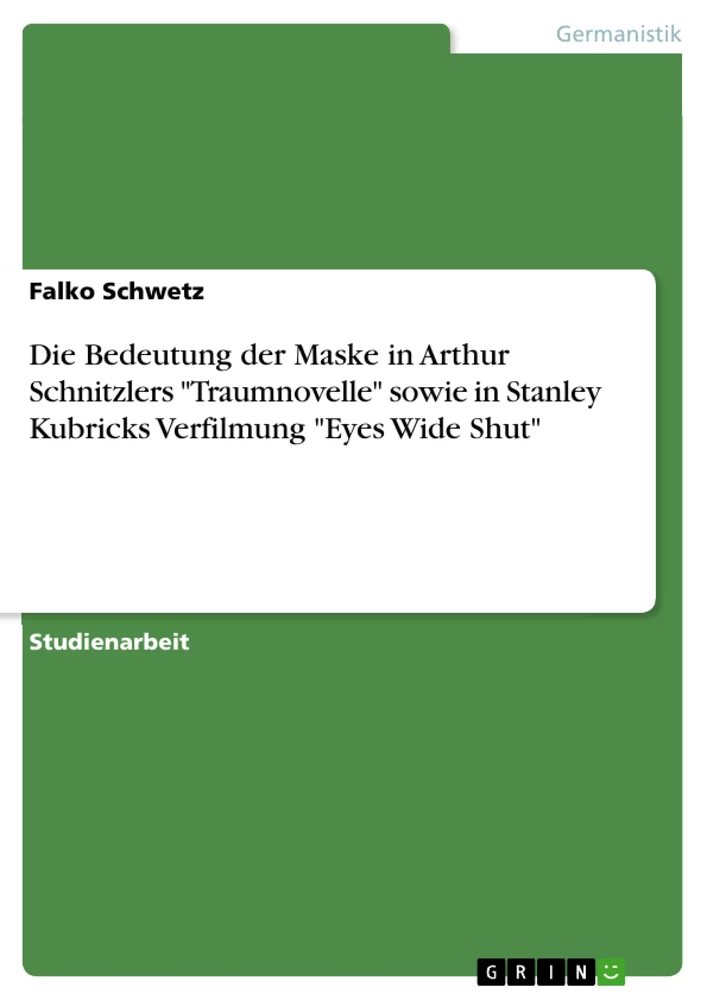Die Maske ist eines der zentralen Leitmotive in Arthur Schnitzlers 1926 erschienener Traumnovelle. Auch in der Verfilmung von Stanley Kubrick unter dem Namen Eyes Wide Shut (Erscheinungsjahr 1999) hat die Maske eine elementare Relevanz. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, welche Bedeutung die Maske symbolisiert und inwiefern die Maske für den Handlungsverlauf eine Bedeutung hat. In den bislang veröffentlichten Werken, die Vergleiche zwischen Film und Novelle angestellt haben, hat sich vor allem Julia Freytag hervorgetan. Sie vertritt die Theorie, dass die Maske neben dem Gesicht vor allem die Scham verhüllt. Im Gegensatz zu Freytags Werk, wird die Bedeutung der Maske von anderen Autoren zwar aufgegriffen, jedoch in deutlich geringerem Umfang. Die elementarsten Erörterungen der bisherigen Forschung und die zentralen Aussagen von Freytag werden in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst und sollen mit weiteren, eigenen Gedanken einen Überblick über die Bedeutung des Maskenmotivs in der Traumnovelle sowie in Eyes Wide Shut geben.
In der heutigen Gesellschaft wird die Maske zunächst mit dem Karneval bzw. dem Fasching in Verbindung gebracht. Die Maske ist Teil der Verkleidung, mit der man den Winter vertreiben möchte. Die Wurzel der Maske liegt jedoch in ihrer rituellen Bedeutung zur Abschreckung böser Geister oder Anbetung von Gottheiten, vor allem in afrikanischen Kulturen. In Theatern, Musicals und Opern spielt die Maske nach wie vor eine große Rolle, um den Darstellern zu ermöglichen eine bestimmte Rolle zu verkörpern. Dass auch Gesichtsausdrücke als Maske bezeichnet werden können, weil man dem Gesprächspartner keine Gefühle offenbaren will, zeigt Abschnitt 3.4. Zunächst werden in der vorliegenden Arbeit aber die Szenen aus der Traumnovelle betrachtet, in denen die Maske eine Bedeutung hat. Im zweiten Abschnitt werden die Maskenmotive aus Eyes Wide Shut aufgegriffen und analysiert. Im Anschluss wird ein Vergleich gezogen, inwiefern Arthur Schnitzler und Stanley Kubrick die Masken in ihren Werken einsetzen, wo Gemeinsamkeiten und wo die größten Unterschiede bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Maske in Arthur Schnitzlers Traumnovelle
- 2.1 Die Dominos auf der Redoute
- 2.2 Die Geständnisse
- 2.3 Fridolins Rolle als Arzt
- 2.4 Nachtigall als Eintrittskarte zum Maskenball
- 2.5 Fridolin beim Maskenverleiher Gibiser
- 2.6 Der geheimnisvolle Maskenball
- 2.7 Die Maske auf dem Ehebett
- 3. Die Maske in Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“
- 3.1 Die erste Einstellung - Der Zuschauer als Bill
- 3.2 Die Masken bei Domino
- 3.3 Bills Rolle als Arzt
- 3.4 Bills Gesicht als Maske
- 3.5 Der geheimnisvolle Maskenball und die Orgie
- 3.6 Die Maske auf dem Ehebett
- 4. Zusammenfassung & Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die symbolische Bedeutung der Maske in Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und Stanley Kubricks Verfilmung „Eyes Wide Shut“. Ziel ist es, die Funktion der Maske im Handlungsverlauf beider Werke zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede im Einsatz des Motivs zu beleuchten. Die Arbeit bezieht sich dabei auf bestehende Forschung, insbesondere die Arbeiten von Julia Freytag, und erweitert diese um eigene Interpretationen.
- Die symbolische Bedeutung der Maske als Verhüllung von Scham und geheimen Begierden.
- Die Rolle der Maske im Kontext von Ehe und Beziehungen.
- Der Kontrast zwischen öffentlicher und privater Identität.
- Die Funktion der Maske als Katalysator für Handlung und Konflikt.
- Vergleichende Analyse des Maskenmotivs in der Novelle und dem Film.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die zentrale Rolle der Maske in Schnitzlers „Traumnovelle“ und Kubricks „Eyes Wide Shut“. Sie skizziert den Forschungsstand, insbesondere die Arbeit von Julia Freytag, die die Maske als Verhüllung von Scham interpretiert. Die Einleitung hebt die unterschiedliche Bedeutung der Maske in verschiedenen Kontexten hervor, vom Karneval bis zum Theater, und kündigt die Struktur der Arbeit an: Analyse der Maske in der Novelle, im Film und schließlich ein Vergleich beider Werke.
2. Die Maske in Arthur Schnitzlers Traumnovelle: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Facetten des Maskenmotivs in Schnitzlers Novelle. Es beginnt mit der Begegnung Fridolins mit den Dominos auf dem Maskenball, die seine Begierde und das Geheimnisvolle der Maskerade unterstreichen. Die anschließenden Geständnisse zwischen Fridolin und Albertine zeigen die Maske als Metapher für verborgene Wünsche und Scham. Fridolins Rolle als Arzt wird als weitere Maske interpretiert, die ihm erlaubt, seine eigenen Begierden zu verbergen und seine Ängste zu kompensieren. Die Suche nach dem geheimnisvollen Maskenball symbolisiert Fridolins Versuch, seine Wünsche und seine Rachegelüste auszuleben, während er gleichzeitig seine Identität hinter der Maske verbirgt.
Schlüsselwörter
Maske, Scham, Geheimnis, Begierde, Identität, Traumnovelle, Eyes Wide Shut, Arthur Schnitzler, Stanley Kubrick, Verfilmung, Vergleichende Analyse, Symbol, Verhüllung, Karneval, Ehe, Beziehung, öffentliche und private Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Maske in Schnitzlers "Traumnovelle" und Kubricks "Eyes Wide Shut"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die symbolische Bedeutung der Maske in Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" und Stanley Kubricks Verfilmung "Eyes Wide Shut". Der Fokus liegt auf der Funktion der Maske im Handlungsverlauf beider Werke, mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Einsatz dieses Motivs herauszuarbeiten. Die Arbeit baut auf bestehenden Forschungsarbeiten, insbesondere von Julia Freytag, auf und erweitert diese durch eigene Interpretationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die symbolische Bedeutung der Maske als Verhüllung von Scham und geheimen Begierden, ihre Rolle im Kontext von Ehe und Beziehungen, den Kontrast zwischen öffentlicher und privater Identität und ihre Funktion als Katalysator für Handlung und Konflikt. Ein zentraler Aspekt ist der vergleichende Analyse des Maskenmotivs in der Novelle und dem Film.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema einführt und den Forschungsstand skizziert; ein Kapitel zur Analyse der Maske in Schnitzlers "Traumnovelle", welches verschiedene Facetten des Motivs beleuchtet (z.B. die Begegnung mit den Dominos, die Geständnisse, Fridolins Rolle als Arzt, der Maskenball); ein Kapitel zur Analyse der Maske in Kubricks "Eyes Wide Shut", mit ähnlichen Schwerpunkten wie im vorherigen Kapitel (z.B. die erste Einstellung, die Masken bei Domino, Bills Rolle als Arzt, der Maskenball); und abschließend eine Zusammenfassung und Schlussbemerkung.
Wie wird die Maske in Schnitzlers "Traumnovelle" interpretiert?
In Schnitzlers Novelle wird die Maske als Metapher für verborgene Wünsche und Scham interpretiert. Die Begegnung mit den Dominos auf dem Maskenball unterstreicht die Begierde und das Geheimnisvolle der Maskerade. Die Geständnisse zwischen Fridolin und Albertine verdeutlichen die Maske als Verhüllung innerer Konflikte. Fridolins Rolle als Arzt wird als weitere Maske interpretiert, die ihm erlaubt, seine eigenen Begierden zu verbergen und seine Ängste zu kompensieren. Die Suche nach dem geheimnisvollen Maskenball symbolisiert Fridolins Versuch, seine Wünsche und Rachegelüste auszuleben, während er gleichzeitig seine Identität hinter der Maske verbirgt.
Wie wird die Maske in Kubricks "Eyes Wide Shut" interpretiert?
In Kubricks Film wird die Maske ebenfalls als Symbol für verborgene Begierden und die Verhüllung der Identität analysiert. Die erste Einstellung, in der der Zuschauer die Perspektive Bills einnimmt, etabliert eine unmittelbare Verbindung zum Protagonisten und dessen Suche nach Identität. Die Masken beim Domino-Spiel und der geheimnisvolle Maskenball symbolisieren die geheimen Wünsche und die Orgie. Bills Rolle als Arzt und sein Gesicht werden als Masken interpretiert, die seine Identität verschleiern. Auch hier steht die Maske im Kontext von Ehe und Beziehung und dem Konflikt zwischen öffentlicher und privater Identität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Maske, Scham, Geheimnis, Begierde, Identität, Traumnovelle, Eyes Wide Shut, Arthur Schnitzler, Stanley Kubrick, Verfilmung, Vergleichende Analyse, Symbol, Verhüllung, Karneval, Ehe, Beziehung, öffentliche und private Identität.
Auf welchen Forschungsarbeiten basiert die Analyse?
Die Arbeit bezieht sich auf bestehende Forschung, insbesondere auf die Arbeiten von Julia Freytag, die die Maske als Verhüllung von Scham interpretiert. Die vorliegende Arbeit erweitert diese Interpretationen durch eigene Analysen.
- Citation du texte
- Falko Schwetz (Auteur), 2015, Die Bedeutung der Maske in Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" sowie in Stanley Kubricks Verfilmung "Eyes Wide Shut", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377870