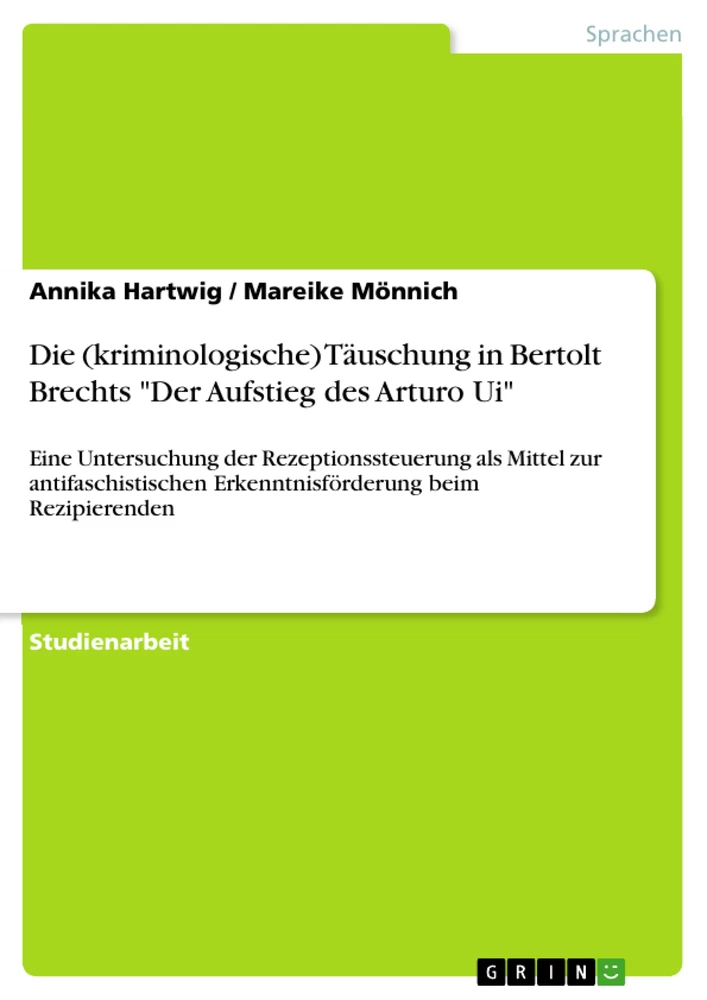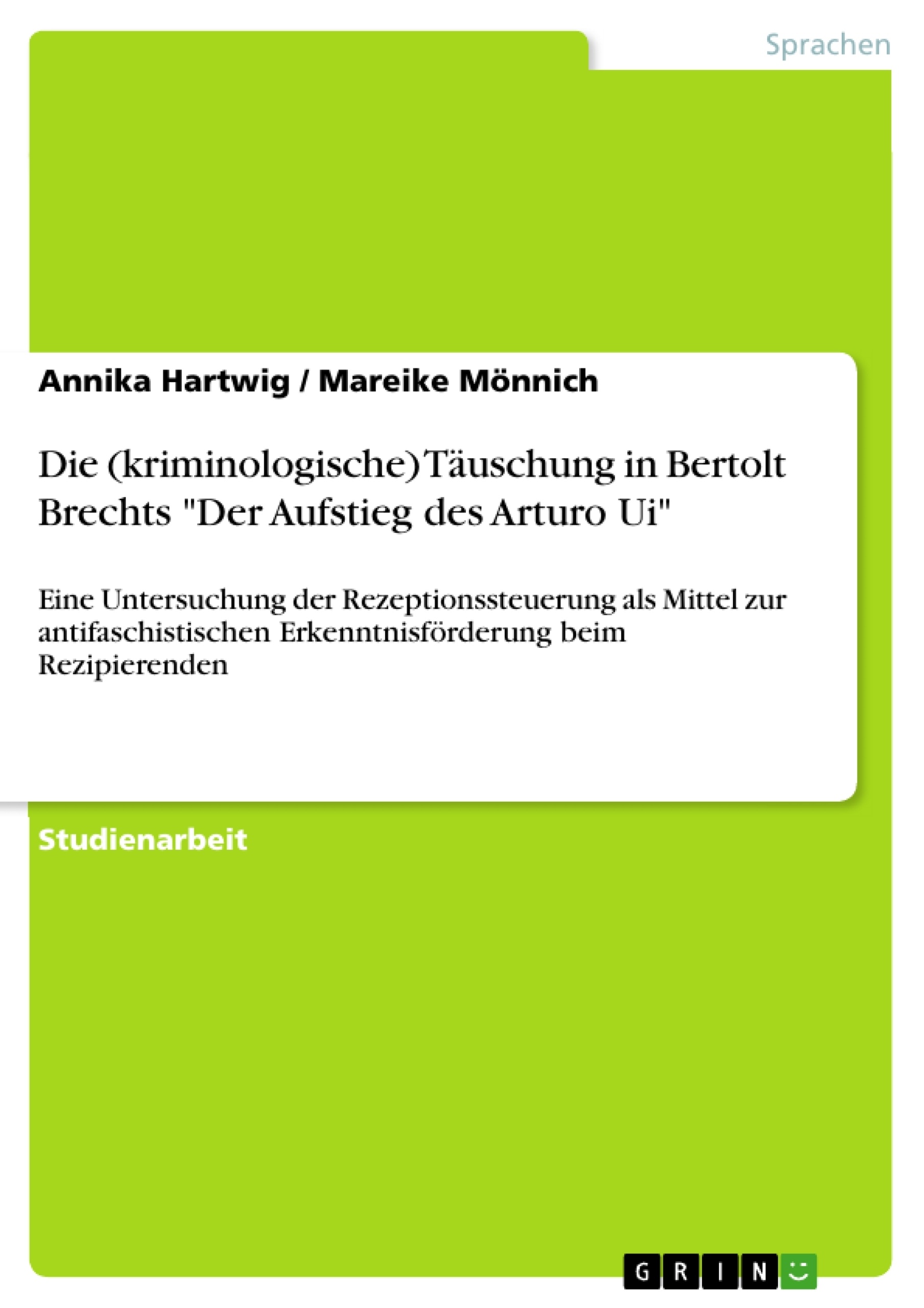„[T]he gangster play we know“. Mit dieser Formulierung verweist Brecht in seinem Arbeitsjournal am Anfang seines Schaffensprozesses zum Theaterstück Der Aufstieg des Arturo Ui auf seine Intention, gesellschaftliche Vorgänge in das Bewusstsein der Rezipierenden zu rufen und damit den kritischen Blick dieser auf eben solche (kriminellen) Handlungen zu lenken.
Dieser Hinweis auf bereits bekannte Ereignisse sollte dabei mindestens zweidimensional betrachtet werden: Erstens in Hinblick auf den Nationalsozialismus unter Adolf Hitler. Zweitens verweist das Stück durch vielfältige Bezüge auf Bandenkriege, die Brecht während seiner USA-Reise im Jahr 1935 erlebte. Helfried W. Seliger konnte in diesem Zusammenhang nachweisen, dass der Werdegang Arturos mit dem des berühmten „Chicagoer Gangsters Al Capone“ kongruent ist.
In dem Transfer, der von Brecht empfundenen, aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen (Nationalsozialismus und amerikanisches Gangsterwesen) ins epische Theater, findet sich eine Verfremdung des jeweils anderen, die mit der von Brecht gehegten Angst der „mangelnden historischen Reife“ der zeitgenössischen Rezipierenden einhergeht. Zudem findet sich in dieser Parallelität eine für Brecht charakteristische Faschismuskritik. Der Beweggrund und die Schwierigkeit eine solche Kritik in Form von Literatur und Theater auszuüben, zeigt sich anschaulich an folgender Äußerung Brechts:
Der Autor […] muss den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl die allenthalben unterdrückt wird; die Klugheit, sie zu erkennen, obwohl sie allenthalben verhüllt wird; die Kunst, sie handhabbar zu machen als eine Waffe; das Urteil, jene auszuwählen, in deren Händen sie wirksam wird; die List, sie unter diesen zu verbreiten.
Auf Grundlage dieses Ausspruchs widmet sich die folgende Hausarbeit der Untersuchung, inwiefern Brecht in Der Aufstieg des Arturo Ui „die ‚Verhüllung‘, (die eine Enthüllung ist)“ konzipiert und vor dem Hintergrund strategischer Täuschungsversuche der Gangsterfiguren seine (subjektive) Wahrheit offenlegt. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Fokussierung auf die Rezeptionssteuerung als Mittel zur Erkenntnisförderung beim Rezipierenden. Dazu wird im Folgenden zunächst die detektivische Rolle des Rezipierenden, ausgehend von der Brechts Anforderungen an den Rezipierenden des Stückes, dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur detektivischen Rolle des Rezipierenden
- Zum Täuschungskonzepts in Der Aufstieg des Arturo Ui
- Eine exemplarische Untersuchung der Rezeptionssteuerung
- Zur Faschismuskritik Bertolt Brechts in Der Aufstieg des Arturo Ui
- Schlussfolgerungen und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Bertolt Brechts Stück "Der Aufstieg des Arturo Ui" und untersucht, wie der Autor durch strategische Täuschungsversuche die Rezeption steuert, um beim Rezipierenden antifaschistisches Bewusstsein zu fördern.
- Die Rolle des Rezipierenden als Detektiv und seine aktive Teilnahme am Erkenntnisprozess
- Die Verwendung von Täuschungsmanövern in "Der Aufstieg des Arturo Ui" als Mittel der Rezeptionssteuerung
- Brechts Faschismuskritik in "Der Aufstieg des Arturo Ui" und ihre Vermittlung durch die Inszenierung
- Die Verbindung des Stückes zu aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen, insbesondere dem Nationalsozialismus und dem amerikanischen Gangsterwesen
- Die Bedeutung von Brechts epischem Theater und seiner Verfremdungstechniken für die anti-faschistische Botschaft des Stücks.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Intention der Hausarbeit vor und skizziert Brechts Ziel, gesellschaftliche Vorgänge in das Bewusstsein der Rezipierenden zu rufen. Sie verweist auf die beiden Ebenen der Rezeptionssteuerung: die Parallelen zum Nationalsozialismus und die Bezüge zum amerikanischen Gangsterwesen.
- Zur detektivischen Rolle des Rezipierenden: Dieser Abschnitt beleuchtet die Rolle des Rezipierenden im epischen Theater Brechts und seine aktive Teilnahme am Erkenntnisprozess. Er erläutert, wie Brecht die Distanz zwischen Zuschauer und Bühnenhandlung herstellt und den Rezipierenden zum kritischen Beobachter macht.
- Zum Täuschungskonzepts in Der Aufstieg des Arturo Ui: Dieser Abschnitt untersucht die Verwendung von Täuschungsmanövern im Stück, die Brecht einsetzt, um den Rezipierenden auf die wahre Bedeutung der Handlung aufmerksam zu machen.
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, Der Aufstieg des Arturo Ui, episches Theater, Verfremdung, Rezeptionssteuerung, Täuschung, Faschismuskritik, Nationalsozialismus, amerikanisches Gangsterwesen.
Häufig gestellte Fragen
Welche historischen Ereignisse verarbeitet Brecht in „Arturo Ui“?
Das Stück verknüpft den Aufstieg Adolf Hitlers im Nationalsozialismus mit dem Gangsterwesen im Chicago der 1930er Jahre, insbesondere der Figur Al Capone.
Was bedeutet die „detektivische Rolle“ des Rezipienten?
Brecht fordert vom Zuschauer, die Handlung kritisch zu beobachten und die „Verhüllungen“ der Figuren wie ein Detektiv zu durchschauen, um zur Wahrheit zu gelangen.
Wie nutzt Brecht die „Täuschung“ als stilistisches Mittel?
Durch strategische Täuschungsversuche der Gangsterfiguren und die Verfremdungseffekte des epischen Theaters wird der Zuschauer dazu gebracht, die kriminellen Strukturen des Faschismus zu erkennen.
Was ist das Ziel der Rezeptionssteuerung in diesem Stück?
Die Steuerung zielt darauf ab, beim Publikum ein antifaschistisches Bewusstsein zu fördern und den kritischen Blick auf gesellschaftliche Machtmechanismen zu schärfen.
Warum wählte Brecht das Gangstermilieu für seine Faschismuskritik?
Die Parallelisierung dient der Verfremdung; sie entlarvt politische Führer als gewöhnliche Kriminelle und macht die Mechanismen der Machtergreifung durchschaubarer.
- Citation du texte
- Annika Hartwig (Auteur), Mareike Mönnich (Auteur), 2017, Die (kriminologische) Täuschung in Bertolt Brechts "Der Aufstieg des Arturo Ui", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378050