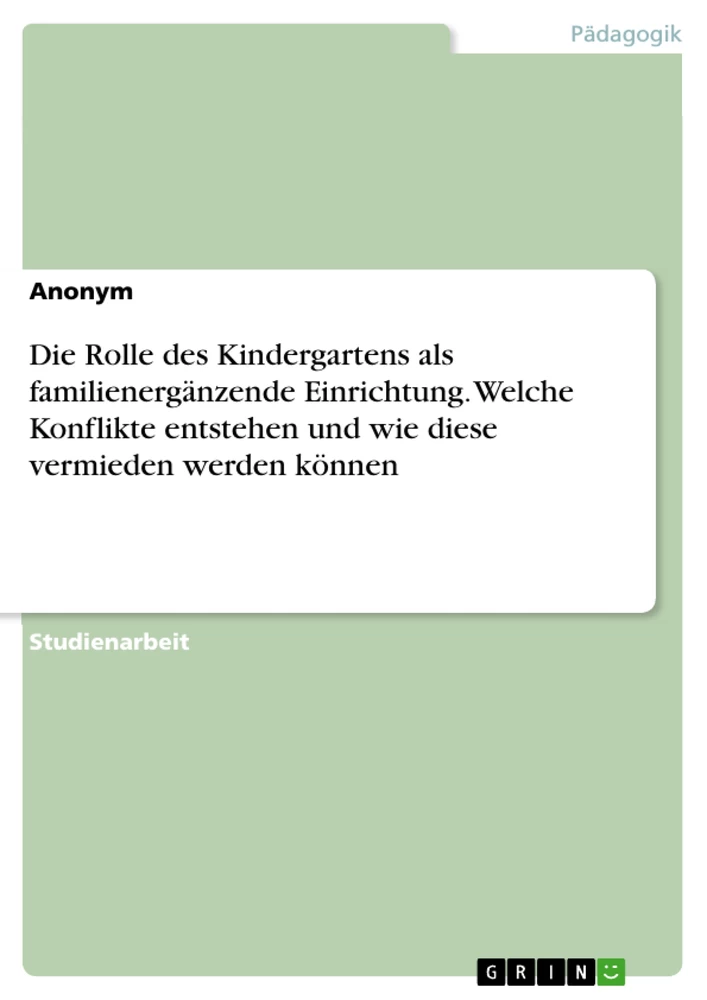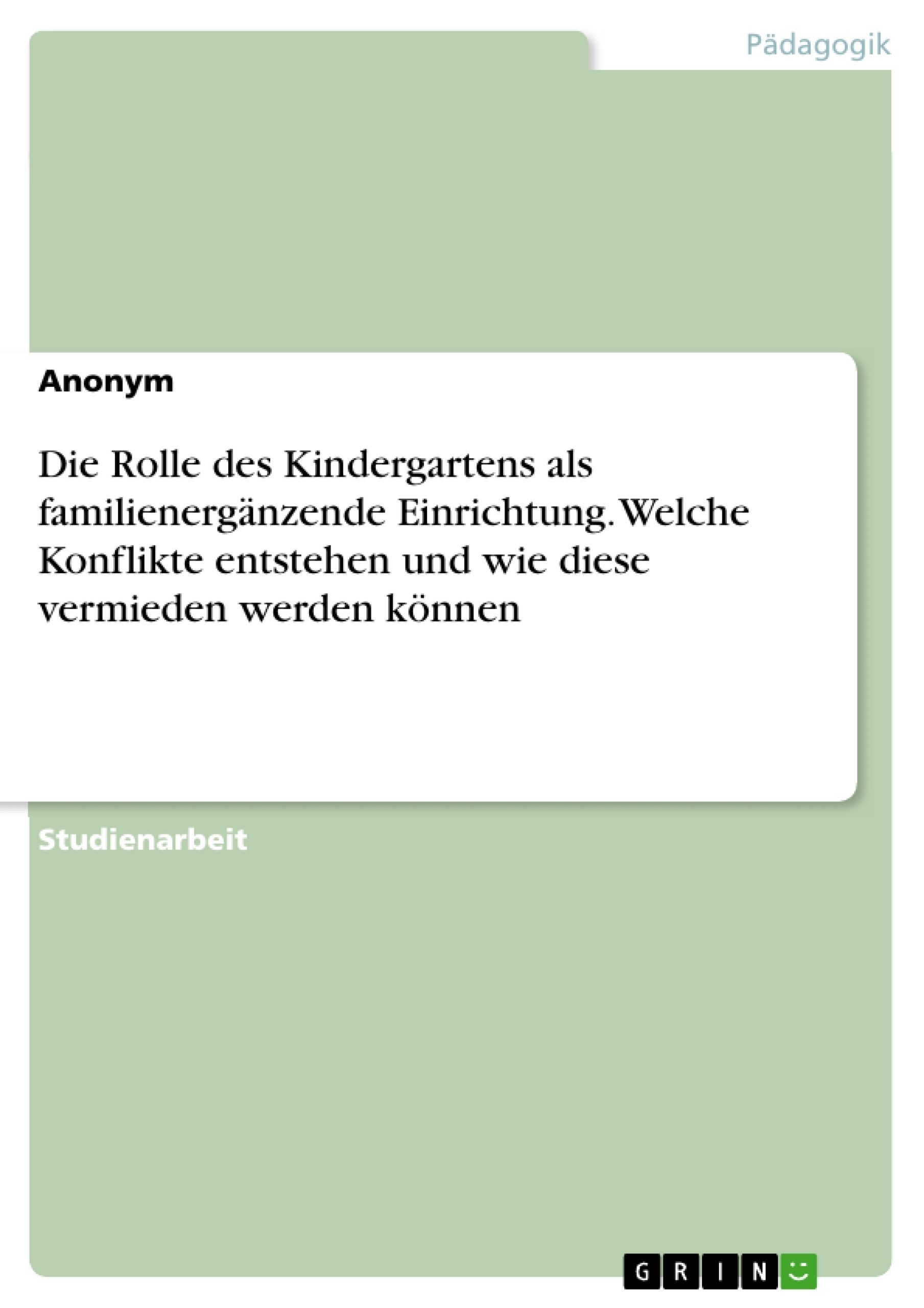In den vergangenen Jahren ist sowohl in den Familien als auch in der Politik der Ruf nach guter und umfassender Kinderbetreuung immer lauter geworden. Nicht nur durch die Ergebnisse der PISA-Studie wird zunehmend eine verbesserte frühkindliche Betreuung und Bildung gefordert, womit der Erwartungsdruck wächst, dem Betreuungseinrichtungen ausgesetzt sind. Doch wie erfolgsversprechend ist die Struktur dieser Betreuungseinrichtungen?
Mit diesem Thema hat sich der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinsohn befasst. Folgend soll die Frage beantwortet werden, welche Konflikte durch die Rolle des Kindergartens als familienergänzende Institution entstehen und wie diese vermieden werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzbiografie Gunnar Heinsohn
- Hauptaussagen der Texte
- Zentrale Konflikte
- Forderungen Heinsohns
- Konklusion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Konflikten, die durch die Rolle des Kindergartens als familienergänzende Einrichtung entstehen. Sie untersucht die Hauptaussagen des Wirtschaftswissenschaftlers und Soziologen Gunnar Heinsohn zu diesem Thema und analysiert, wie diese Konflikte vermieden werden könnten.
- Die Auswirkungen der Lohnerziehung
- Die negativen Aspekte der Kollektivierung
- Das Abgeschnittensein der Kinder von den Erwachsenenverrichtungen
- Die Kritik an der Struktur des Kindergartens als Fabrik oder Bewahranstalt
- Die Bedeutung der frühkindlichen Erziehungseinrichtungen als familienergänzende Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Fragestellung der Hausarbeit vor. Sie führt den Leser in die Thematik ein und erläutert die Relevanz des Themas.
Kapitel 2 bietet eine Kurzbiografie von Gunnar Heinsohn, dem zentralen Autor der Hausarbeit. Es werden seine wichtigsten Forschungsgebiete und Publikationen vorgestellt.
In Kapitel 3 werden die Hauptaussagen von Gunnar Heinsohn aus seinen Texten präsentiert. Zunächst werden die zentralen Konflikte, die durch die Rolle des Kindergartens als familienergänzende Einrichtung entstehen, erläutert. Anschließend werden die Forderungen Heinsohns zur Vermeidung dieser Konflikte dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der frühkindlichen Bildung, der Rolle des Kindergartens als familienergänzende Einrichtung, den Konflikten, die durch diese Rolle entstehen, der Lohnerziehung, der Kollektivierung, dem Abgeschnittensein der Kinder von Erwachsenenverrichtungen und der Kritik an der Struktur des Kindergartens als Fabrik oder Bewahranstalt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, Die Rolle des Kindergartens als familienergänzende Einrichtung. Welche Konflikte entstehen und wie diese vermieden werden können, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378093