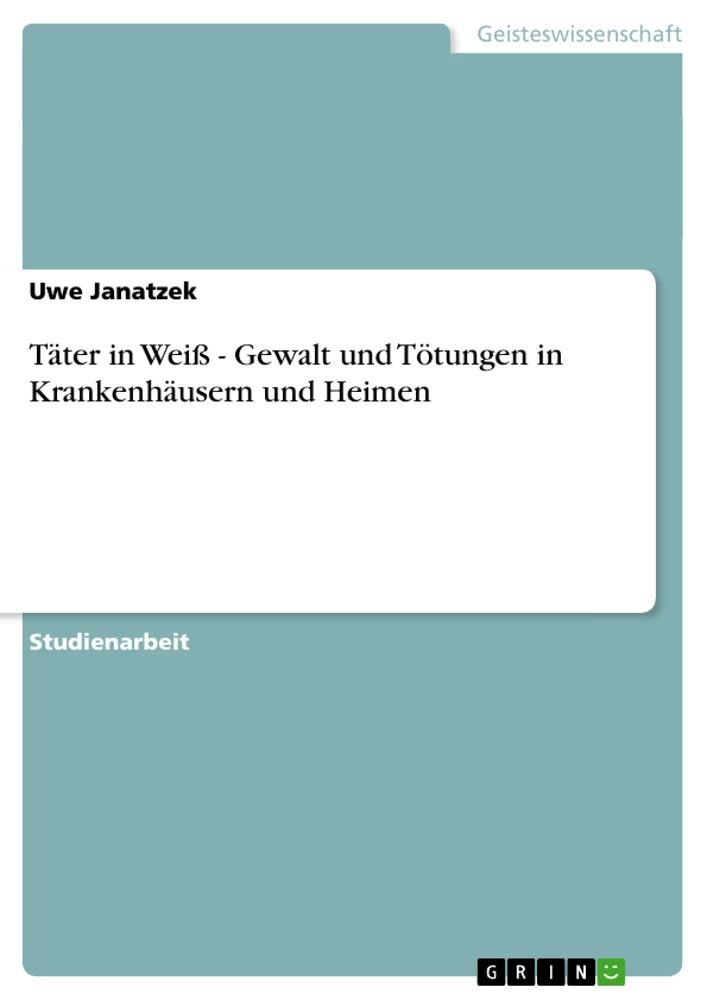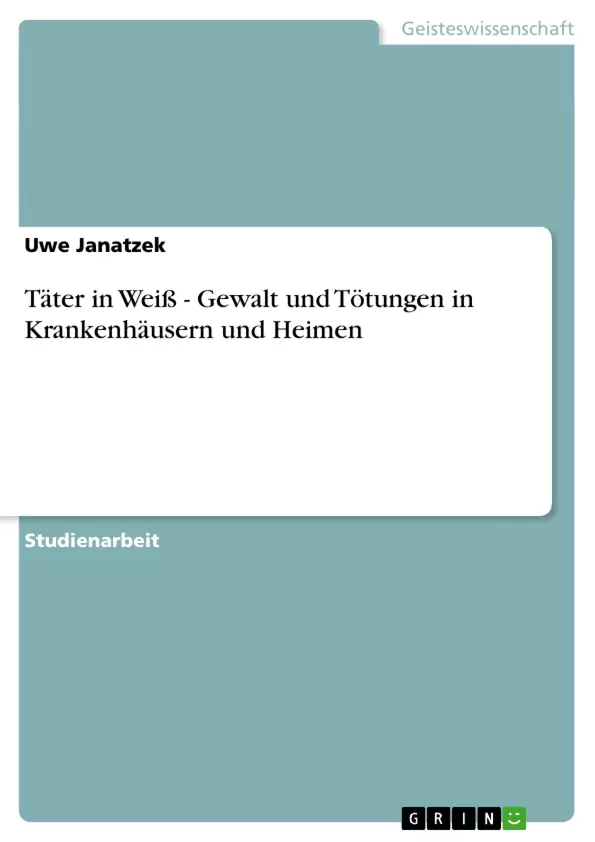"Leicht grünlich eingefärbte Bilder einer billigen Überwachungskamera flimmern rauschend über den Bildschirm. Aus einer leicht erhöhten Perspektive heraus ist eine Frau zu sehen, die das Gesicht eines alten Mannes abwischt, schnell und lieblos, dann noch einmal, schneller, aggressiver diesmal. Der Vorgang wiederholt sich, die Aggressivität der Frau steigert sich, sie beschimpft ihn. Der alter Mann ist wehrlos und versucht den Kopf wegzudrehen, was ihm aber nicht gelingt.
Szenenwechsel: Dieselbe Frau und derselbe alte Mann sind erneut zu sehen, diesmal liegt der Bettlägerige kaum bekleidet auf der Seite; die Frau schlägt auf seine Hüfte ein, wieder und wieder. Trotz des unscharf wirkenden Bildes, das den Eindruck von Reality-TV noch verstärkt, ist unverkennbar, daß sie ihre Wut über den Wehrlosen entlädt, harte Schläge auf einen ausgemergelten Körper austeilend."
Dann bricht die Filmsequenz ab, und der Moderator der Sendung erscheint. Nach einer kurzen, scheinbar genau berechneten Pause moralischer Entrüstung folgt sodann die Erklärung der verstörenden Bilder.
Das Video stammt aus einer Funküberwachungskamera, welche die Frau, die das 91jährige Opfer der gezeigten Mißhandlung in der häuslichen Umgebung pflegte, selbst in dessen Zimmer zur besseren Aufsicht angebracht hatte. Ein Funkamateur, der die Signale zufällig auffing und so verstärkte, daß er das Leiden des pflegebedürftigen Mannes auf Video bannen konnte, benachrichtigte nach seiner Entdeckung die Polizei, welche die Wohnung ausfindig machen konnte und den alten Mann in ein Krankenhaus bringen ließ. Zitiert werden die Beamten mit den Worten, daß das Opfer vor Erleichterung geweint habe, als es abtransportiert wurde.
Dieser Fall, der sich zwar nicht in einer Institution, sondern in der häuslichen Pflege zutrug, zeigt trotz der vordergründigen moralischen Entrüstung der Fernsehmacher und dem verständlichen Mitleid der zitierten Beamten mit dem Opfer aber mehr als nur eine Mißhandlungssituation. Während in dem Nachrichtenbeitrag bei RTL darüber spekuliert wurde, inwiefern hier die Bereitschaft der Frau, als Pflegende aufzutreten, mit der Zahlung des Pflegegeldes zusammenhing, wurde übersehen, daß die gezeigten Übergriffe im Rahmen der Pflegesituation begangen wurden - nämlich einmal während des Säuberns des Gesichts und beim zweiten Mal anscheinend während der Reinigung des Opfers von Exkrementen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. - Einführung und Themenbeschreibung:
- 1.1 Begrifflichkeiten:
- 1.1.1 Psychische Disposition:
- 1.1.2 Tötung:
- 1.2 Allgemeine Betrachtung der Einflußfaktoren und Zusammenhänge:
- 1.1 Begrifflichkeiten:
- 2. - Klassifikation von (Mehrfach-)Tötungen durch Ärzte, Pflegende und Pflegekräfte innerhalb und außerhalb von Krankenhäusern und Heimen:
- 2.1 Motivlage 1.1.1:
- 2.2 Motivlage 1.1.2:
- 2.3 Motivlage 1.1.3:
- 2.4 Motivlage 1.1.4:
- 2.5 Motivlage 2.1.1:
- 2.6 Motivlage 2.1.2:
- 2.7 Motivlage 3.1.1:
- 2.8 Motivlage 3.1.2:
- 2.9 Motivlage 3.1.3:
- 2.10 Motivlage 3.1.4:
- 2.11 Zeitliche und geographische Dimensionen:
- 2.12 Gemeinsame Merkmale von Tätern und Taten der Motivlage 3.1.4:
- 2.13 Zusammenfassende Tätertypologisierung und Tatumfeldtypologisierung:
- 2.13.1 Tätertypologisierung:
- 2.13.2 Tatumfeldtypologisierung:
- 3.- Der Fall Rudi Z. (Wuppertal):
- 3.1 Lebenslauf:
- 3.2 Tötungsdelikte, Tatumfelder und Täterverhalten:
- 3.2.1 Die Tötungsdelikte:
- 3.2.2 Tatumfelder und Täterverhalten:
- 3.3 Psychosozialer Befund:
- 3.3.1 Allgemeine Charakterisierung des Täters:
- 3.3.2 Persönlichkeitsbildung des Täters:
- 3.3.2.1 Stufenmodell nach Erikson:
- 3.3.2.1.1 Einflüsse während der oral-sensorischen Phase (Vertrauen vs. Mißtrauen):
- 3.3.2.1.2 Einflüsse während der anal-muskulären Phase (Kompetenz vs. Minderwertigkeit):
- 3.3.2.1.3 Einflüsse während der genital-lokomotorischen Phase (Initiative vs. Schuld):
- 3.3.2.1.4 Einflüsse während der Latenzphase (Kompetenz vs. Minderwertigkeit):
- 3.3.2.1.5 Einflüsse während der Pubertätsphase oder genitalen Phase (Identität vs. Identitätsdiffusion):
- 3.3.2.2 Ich, Über-Ich, Es und Abwehrmechanismen:
- 3.3.2.1 Stufenmodell nach Erikson:
- 4. - Verhalten und (zugeschriebene) Merkmale der Heimbewohner / Patienten in Beziehung zur Tatauslösung:
- 4.1 Die Rolle des Kranken bzw. Heilers:
- 4.1.1 Krankenhaus - Patientenrolle:
- 4.1.2 Altenheim - Bewohnerrolle:
- 4.1.3 Gemeinsame Aspekte von Krankenhäusern und Alten- bzw. Pflegeheimen:
- 4.1.4 Zusammenfassung:
- 4.1 Die Rolle des Kranken bzw. Heilers:
- 5. - Institutionelle und strukturell-rechtliche Bedingungen:
- 6. - Mögliche Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Gewalt und Tötungen in Krankenhäusern und Heimen. Sie analysiert Hintergründe, Zusammenhänge und Klassifizierungen von Gewalt- und Tötungsdelikten in Einrichtungen der Gesundheitversorgung, wobei ein besonderer Fokus auf sozialmedizinische und psychologische Aspekte gelegt wird. Die Arbeit will zu einem besseren Verständnis der Ursachen und Motive für Gewalt in Gesundheitseinrichtungen beitragen.
- Klassifizierung von Tötungsdelikten durch medizinisches Personal
- Motivlagen und Einflussfaktoren
- Zusammenhänge zwischen Täterpersönlichkeit, Tatumfeld und Opferrolle
- Institutionelle und strukturelle Rahmenbedingungen
- Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik, die verschiedene Begrifflichkeiten erläutert und die allgemeinen Einflussfaktoren und Zusammenhänge von Gewalt und Tötungen in Gesundheitseinrichtungen beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird eine Klassifizierung von (Mehrfach-)Tötungen durch Ärzte, Pflegende und Pflegekräfte vorgenommen, wobei verschiedene Motivlagen, wie z.B. Habgier, Irrsinn oder Sadismus, analysiert werden.
Das dritte Kapitel widmet sich einem Fallbeispiel, dem Fall Rudi Z., um die Zusammenhänge zwischen Täterpersönlichkeit, Tatumfeld und Opferrolle zu veranschaulichen. Hierbei werden der Lebenslauf des Täters, seine Tötungsdelikte, sein Täterverhalten und seine psychosoziale Entwicklung genauer betrachtet.
Im vierten Kapitel wird die Rolle des Kranken bzw. Heilers untersucht, wobei die spezifischen Aspekte der Krankenhaus- und der Altenheim-Situation analysiert werden.
Das fünfte Kapitel behandelt die institutionellen und strukturellen Bedingungen, die die Entstehung von Gewalt in Gesundheitseinrichtungen begünstigen können. Schließlich werden im sechsten Kapitel mögliche Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Gewalt in Gesundheitseinrichtungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Gewalt, Tötungen, Krankenhäuser, Heime, Gesundheitseinrichtungen, Täter, Opfer, Motivlagen, psychische Disposition, sozialmedizinische Aspekte, psychologische Aspekte, Prävention, Aufdeckung, strukturelle Bedingungen, institutionelle Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum kommt es zu Gewalt in Pflegeeinrichtungen?
Ursachen sind oft Überlastung, mangelnde psychische Eignung des Personals, institutionelle Mängel und die oft wehrlose Rolle der Patienten oder Heimbewohner.
Was sind typische Motivlagen für Tötungsdelikte durch Pflegepersonal?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Motive wie Mitleid (vermeintliche Erlösung), Machtstreben, Sadismus, Habgier oder psychische Störungen der Täter.
Wer war Rudi Z. und was zeigt sein Fall?
Rudi Z. ist ein Fallbeispiel für einen Serientäter im Pflegebereich. Seine Geschichte verdeutlicht, wie Täterpersönlichkeit und institutionelle Lücken Tötungen ermöglichen können.
Welche Rolle spielen strukturelle Bedingungen in Krankenhäusern?
Personalmangel, Zeitdruck und mangelnde Kontrolle schaffen ein Tatumfeld, in dem Misshandlungen und Übergriffe lange Zeit unentdeckt bleiben können.
Wie kann Gewalt in Heimen vorgebeugt werden?
Maßnahmen umfassen eine bessere Personalauswahl, psychologische Supervision, Whistleblower-Systeme und eine stärkere Sensibilisierung für die Rechte der Bewohner.
Was versteht man unter dem Begriff "Täter in Weiß"?
Der Begriff beschreibt Personen in Heil- und Pflegeberufen, die ihre Vertrauensstellung missbrauchen, um Patienten zu schädigen oder zu töten.
- Quote paper
- Uwe Janatzek (Author), 2005, Täter in Weiß - Gewalt und Tötungen in Krankenhäusern und Heimen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37820