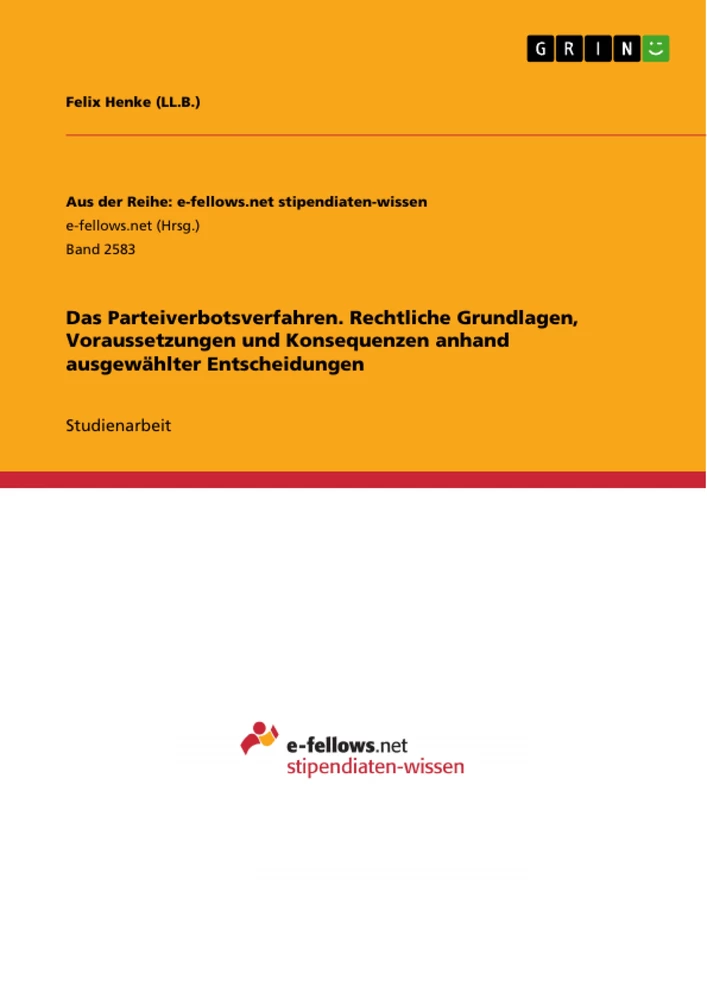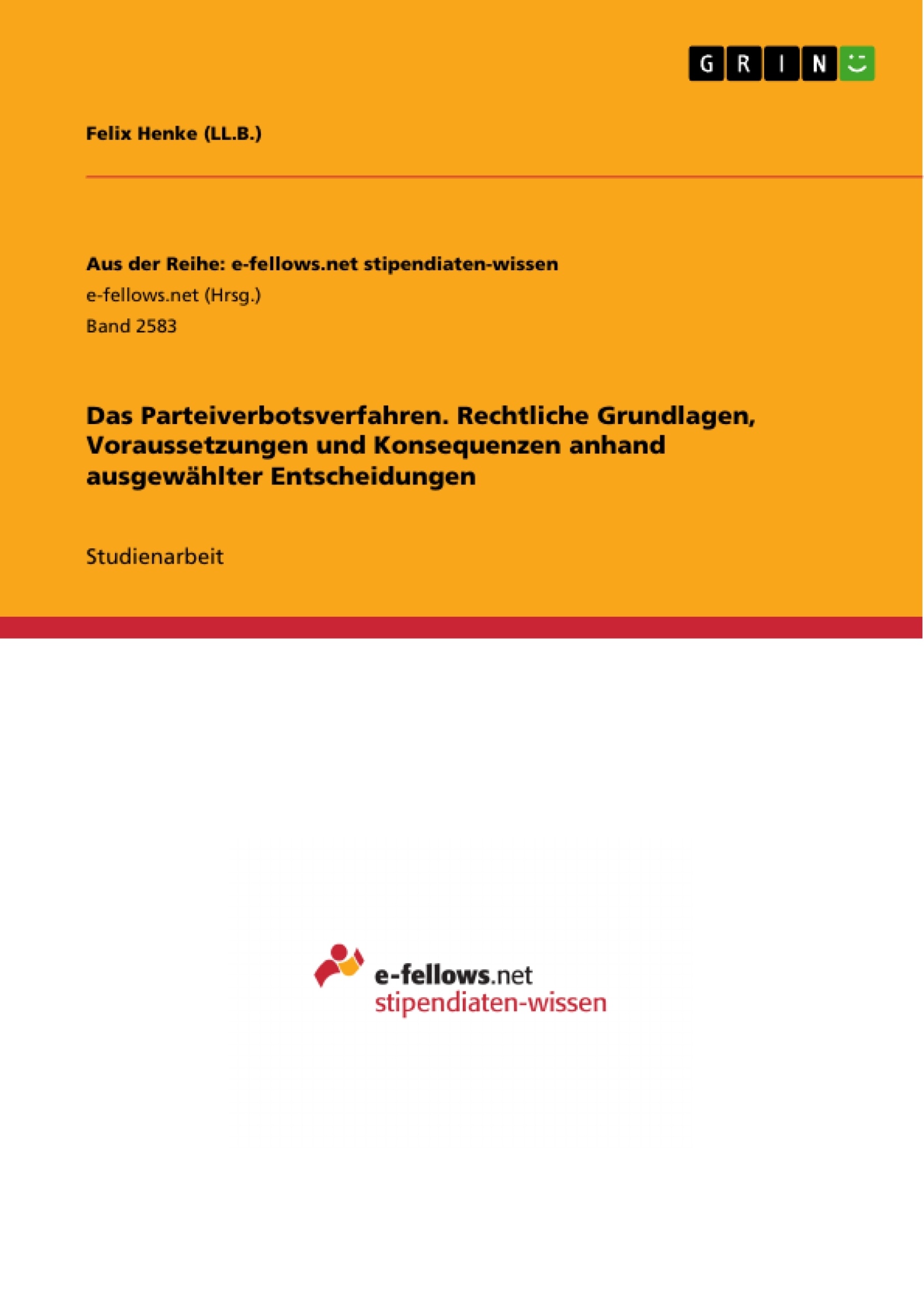Durch Art. 21 GG hat der deutsche Gesetzgeber mit Inkrafttreten des Grundgesetzes im Jahre 1949 juristisches Neuland betreten, denn die Anerkennung der politisch engagierten Parteien und die Schaffung eines speziellen Verbotsverfahrens waren im internationalen Umfeld unbekannt. [] Die Beweggründe hatten vor allem historischen Charakter, weil die Erinnerungen an die scheinlegale Bekämpfung der Weimarer Republik, die erneute Zulassung der zuvor verbotenen NSDAP und den Zweiten Weltkrieg noch so frisch waren. [] Nichtsdestotrotz wird das Parteiverbot immer wieder auch als eine sehr umstrittene Handlungsform des Staates angesehen, besser gesagt, es wird offen über dessen Notwendigkeit diskutiert. [] Als Argument der Kritiker steht auf der einen Seite die enge Verstrickung zwischen der Politik und dem Bundesverfassungsgericht, welches zwar an sich selbst zurecht den Anspruch stellt einzig nach rechtswissenschaftlichen Maßstäben sowie unparteiisch von etwaigen Beeinflussungen zu entscheiden, aber insbesondere bei einem Parteiverbotsverfahren an seine Grenzen stößt, schließlich sind die Antragsteller in Persona genauso Repräsentanten politischer Fraktionen wie die Anhänger der zu verbietenden Partei und noch fallen eben beide als gleichberechtigte Institutionen unter den Grundprinzipienschutz der Bundesrepublik Deutschland. [] Die Neutralität des Staates gegenüber Parteien ist diesbezüglich nicht hinreichend genug realisiert; Art. 21 Abs. 2 GG steht deshalb mehr symbolisch für eine streitbare, wehrhafte und / oder militante Demokratie. [] Andererseits erlaubt der Gesetzeswortlaut des entsprechenden Grundgesetzartikels in Verbindung mit § 46 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG keine andere Alternative, die schwächer als eine Auflösung wiegt.
Das führt, trotz des dem Verbotsprozess immanenten Ausgleichs zwischen Schutz und Förderung politischer Willensbildung im engeren Sinne sowie rechts- und verfassungsstaatlicher Garantien in weiterer Sicht, zu einer „Alles oder Nichts“ Entscheidung. [] Darüber hinaus sind die bisher durchgeführten Verbotsverfahren zahlenmäßig überschaubar und liegen zeitlich teilweise schon einige Jahrzehnte zurück, sodass die rechtliche Anwendungspraxis bei dem überwiegenden Teil der wichtigen Entscheidungsträgern nicht vorhanden ist. Dabei ist die Beurteilung, ob es zu einem Verbot kommen soll oder nicht, ein äußerst schmaler Grat und bedarf somit besonderem Fingerspitzengefühl, wobei Erfahrungswerte aus der Vergangenheit sicher nicht schaden würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtliche Grundlagen
- Die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 21 Abs. 2 GG
- ,,die freiheitliche demokratische Grundordnung“
- ,,zu beeinträchtigen oder zu beseitigen“
- ,,den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden“
- Ziele der Partei oder „,Verhalten ihrer Anhänger“
- ,,darauf ausgehen“
- Das Verbotsverfahren
- Ablauf des Verfahrens
- Konsequenzen eines Parteiverbots
- Kommentierung ausgewählter Entscheidungen
- SRP-Verbot
- KPD-Verbot
- Parteiverbotsanträge gegen die „Nationale Liste\" und die FAP
- Das erste NPD-Verbotsverfahren
- Das zweite NPD-Verbotsverfahren
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Parteiverbotsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen, die Voraussetzungen für ein Parteiverbot und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die Analyse stützt sich auf ausgewählte Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
- Rechtliche Grundlagen des Parteiverbots in Art. 21 Abs. 2 GG
- Die Tatbestandsvoraussetzungen für ein Parteiverbot
- Das Verfahren zur Verhängung eines Parteiverbots
- Die Konsequenzen eines Parteiverbots für die betroffene Partei
- Analyse ausgewählter Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Parteiverboten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Parteiverbots im Kontext der deutschen Geschichte und diskutiert die kontroversen Aspekte dieses Instruments. Kapitel II behandelt die rechtlichen Grundlagen des Parteiverbots in Art. 21 Abs. 2 GG. Kapitel III analysiert die Tatbestandsvoraussetzungen für ein Parteiverbot, einschließlich der Kriterien für die Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und des Bestands der Bundesrepublik Deutschland. Kapitel IV beschäftigt sich mit dem Ablauf des Parteiverbotsverfahrens und seinen Folgen. Kapitel V analysiert anhand ausgewählter Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts die Anwendung des Parteiverbots in der Praxis, z.B. im Fall der SRP, KPD und NPD.
Schlüsselwörter
Parteiverbot, Art. 21 Abs. 2 GG, freiheitliche demokratische Grundordnung, Bundesverfassungsgericht, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, politische Parteien, Extremismus, Verfassungsschutz, NPD, KPD, SRP.
Häufig gestellte Fragen
Welche rechtliche Grundlage hat das Parteiverbot in Deutschland?
Die Grundlage bildet Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG), der Parteien für verfassungswidrig erklärt, die die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen.
Wer entscheidet über ein Parteiverbot?
Ausschließlich das Bundesverfassungsgericht hat die Kompetenz, eine Partei für verfassungswidrig zu erklären und deren Auflösung anzuordnen.
Welche Parteien wurden in der Geschichte der BRD bereits verboten?
Bisher wurden die Sozialistische Reichspartei (SRP, 1952) und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD, 1956) verboten.
Was sind die Voraussetzungen für ein Verbot?
Eine Partei muss eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einnehmen und darauf ausgehen, diese zu beseitigen.
Warum scheiterte das erste NPD-Verbotsverfahren?
Es scheiterte aufgrund von Verfahrenshindernissen, da staatliche V-Leute auch in der Führungsebene der Partei tätig waren, was die Staatsfreiheit der Partei in Frage stellte.
Was bedeutet „wehrhafte Demokratie“?
Es ist das Konzept, dass die Demokratie Instrumente (wie das Parteiverbot) besitzt, um sich gegen ihre Feinde zu schützen, bevor diese die Ordnung legal abschaffen können.
- Quote paper
- Felix Henke (LL.B.) (Author), 2017, Das Parteiverbotsverfahren. Rechtliche Grundlagen, Voraussetzungen und Konsequenzen anhand ausgewählter Entscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378200