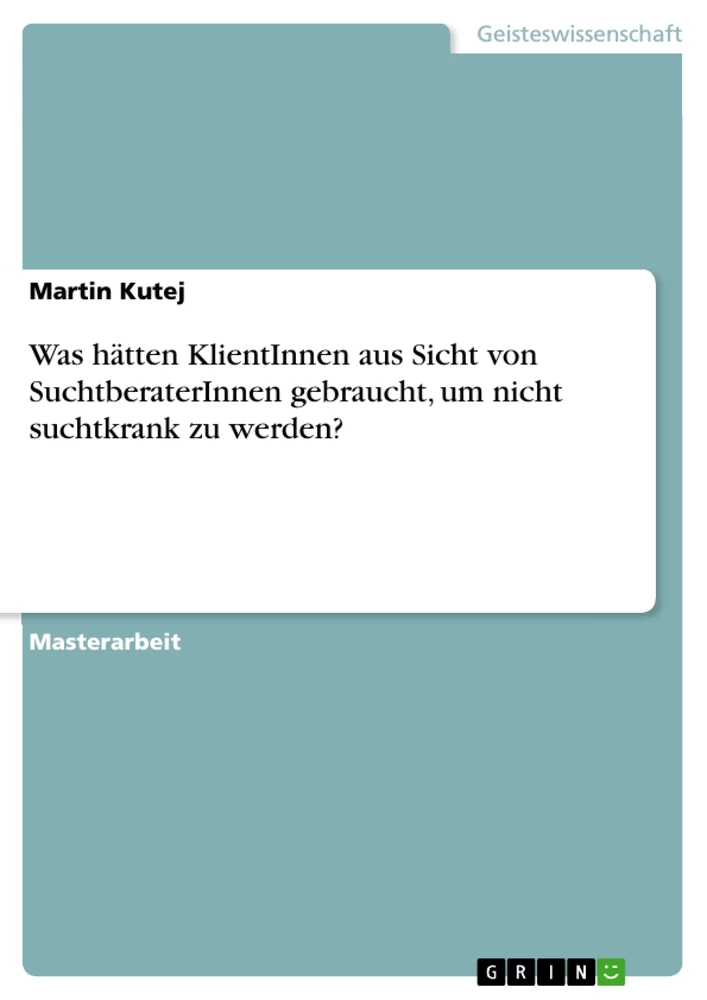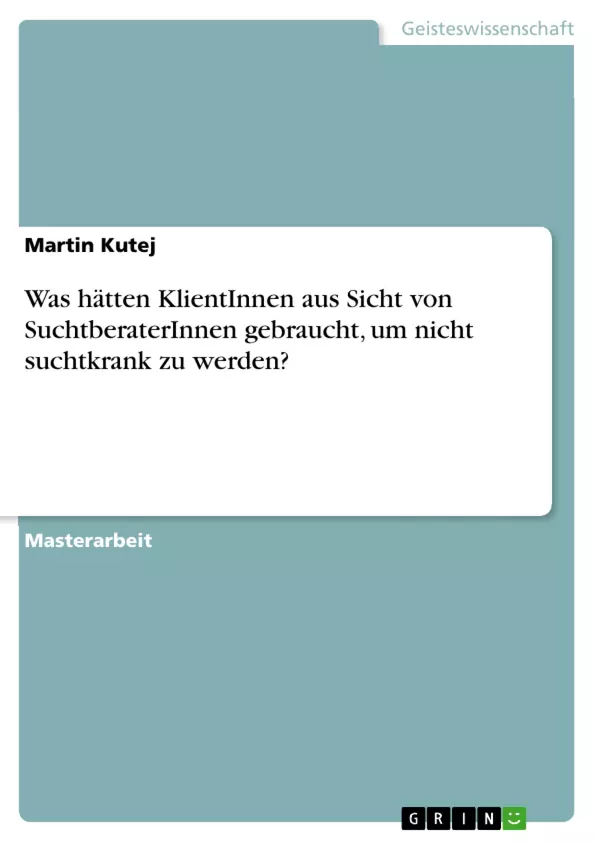Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen brauchen, um nicht suchtkrank zu werden.
In der Literatur werden sowohl Erklärungsmodelle für die Suchtentstehung gefunden, als auch der Zusammenhang mit möglichen Komorbiditäten aufzeigt. Hier zeigt sich, dass ein einfaches Ursache-Wirkung-Prinzip nicht angewandt werden kann, sondern aufgrund multifaktorieller Einflussfaktoren viele Umstände zu berücksichtigen sind.
Für die Studie wurden 13 Interviews mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in ambulanten Kärntner Suchtberatungsstellen durchgeführt. Die transkribierten Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die erhaltenen Aussagen werden den Ergebnissen der Literaturrecherche gegenüber gestellt.
Zwischen dem in der Literatur Vorgefundenem und in den Aussagen der Suchtberaterinnen und Suchtberater herrscht bezüglich der für eine Suchtentstehung maßgeblichen Faktoren eine große Übereinstimmung. Abweichungen gibt es bei den Schwerpunktsetzungen. Die im Feld professionell Tätigen messen familiären Einflüssen, Belastungen und Unterstützungen durch Soziale Organisationen ein besonders großes Gewicht bei. Hingegen werden biologische Ursachen der Suchtentstehung von ihnen nicht erwähnt. Die Befragung der Expertinnen und Experten ergibt neue Ansatzpunkte für die Suchtprävention, wobei die Kärntner Situation besondere Berücksichtigung findet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung in die Arbeit und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- A THEORETISCHER TEIL
- 2 Psychische Gesundheit
- 2.1 Definition
- 2.2 Psychosoziale Krisen
- 3 Prävention und Gesundheitsförderung
- 3.1 Definition
- 3.2 Das Wirkungsprinzip der Gesundheitsförderung
- 3.3 Suchtprävention
- 4 Sucht
- 4.1 Definition
- 4.2 Erklärungsmodelle zur Suchtentstehung
- 4.2.1 Psychoanalytische Suchttheorie
- 4.2.2 Kognitive Erklärungsmodelle
- 4.2.3 Soziologische Suchttheorie
- 4.2.4 Selbstmedikation
- 4.2.5 Konditionierung
- 4.2.6 Sucht als neuroendokrinologische Erkrankung
- 4.2.7 Das körpereigene Belohnungssystem
- 4.2.8 Sucht als Folge fehlender Bindung
- 4.2.9 Genetische Prädisposition
- 4.2.10 Multifaktorielle Ursachen
- 4.2.11 Lebensgeschichtliche Ereignisse
- 4.2.12 Entzugsvermeidung
- 4.3 Substanzen als Einflussfaktoren zur Suchtentwicklung
- 4.3.1 Geschichte der Opioide
- 4.3.2 Wirkung der Opiate
- 4.3.3 Heroin
- 4.3.4 Kokain
- Analyse der Erklärungsmodelle zur Suchtentstehung aus der Sicht von Suchtberaterinnen und Suchtberatern
- Ermittlung der relevanten Einflussfaktoren auf die Suchtentwicklung aus der Perspektive der Betroffenen
- Bewertung des Einflusses von sozialen, familiären und persönlichen Faktoren auf die Suchtentstehung
- Identifizierung von Präventionsstrategien, die auf den Erkenntnissen der Interviews basieren
- Untersuchung der Kärntner Situation im Kontext von Suchtprävention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Faktoren, die aus der Sicht von Suchtberaterinnen und Suchtberatern dazu beitragen, Menschen vor Suchtkrankheit zu bewahren. Dabei werden die Erfahrungen von Kärntner Suchtberaterinnen und Suchtberatern im Hinblick auf ihre Klientinnen und Klienten untersucht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik, die Problemstellung der Arbeit sowie die Zielsetzung und den Aufbau. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der Suchtentstehung und widmet sich verschiedenen Erklärungsmodellen. Hier werden die psychoanalytische, kognitive, soziologische, konditionierungs- und neuroendokrinologische Sichtweise beleuchtet. Weiterhin werden Faktoren wie Selbstmedikation, fehlende Bindung, genetische Prädisposition und multifaktorielle Ursachen sowie die Bedeutung lebensgeschichtlicher Ereignisse und Entzugsvermeidung für die Suchtentwicklung betrachtet. Darüber hinaus werden die Wirkung von Substanzen wie Opiate und deren Geschichte sowie die Auswirkungen von Heroin und Kokain im Kontext von Suchtentstehung und -prävention beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sucht, Prävention, Suchtprävention, Komorbidität, Trauma, Suchtberatung, addiction, prevention, drug prevention, comorbidity, addiction counselling
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Faktoren für die Entstehung einer Sucht?
Die Studie zeigt, dass Sucht multifaktoriell bedingt ist. Wichtige Einflüsse sind familiäre Belastungen, psychosoziale Krisen, fehlende Bindung und traumatische Erlebnisse.
Welche Rolle spielt die Familie bei der Suchtprävention?
Suchtberater messen familiären Einflüssen ein sehr hohes Gewicht bei. Ein stabiles Umfeld und Unterstützung durch soziale Organisationen gelten als entscheidende Schutzfaktoren.
Werden biologische Ursachen von Suchtberatern anders bewertet als in der Literatur?
Ja, während die Fachliteratur genetische und neuroendokrinologische Faktoren betont, wurden diese in den Interviews mit Kärntner Suchtberatern kaum erwähnt. Sie fokussieren stärker auf psychosoziale Aspekte.
Was ist das Prinzip der „Selbstmedikation“ bei Suchterkrankungen?
Dies ist ein Erklärungsmodell, bei dem Betroffene Substanzen konsumieren, um psychische Schmerzen, Traumata oder Komorbiditäten eigenständig zu lindern.
Wie wurde die Studie durchgeführt?
Es wurden 13 qualitative Interviews mit Sozialarbeitern in ambulanten Kärntner Suchtberatungsstellen geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
- Citation du texte
- Martin Kutej (Auteur), 2017, Was hätten KlientInnen aus Sicht von SuchtberaterInnen gebraucht, um nicht suchtkrank zu werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378295