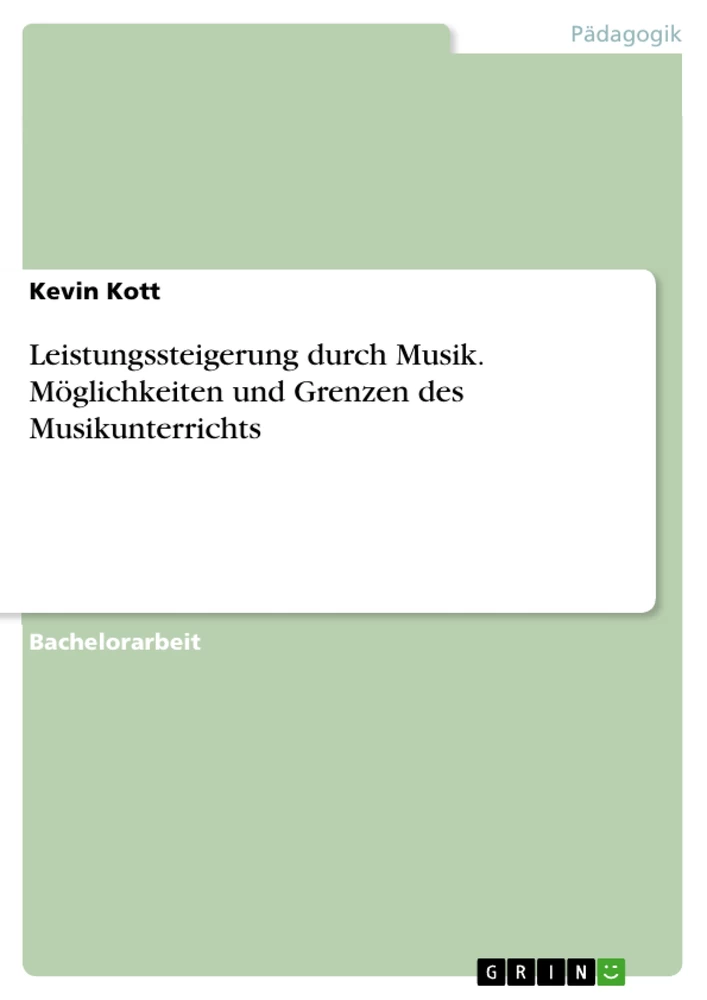Es sollen Möglichkeiten und Grenzen des Transfers durch Musik auf Basis von empirischen Befunden von Studien vorgestellt und kritisch diskutiert werden. Diese kritische Auseinandersetzung mit den Studien soll zum einen zeigen, dass viele Transfereffekte aus der Luft gegriffen sind und nicht empirisch belegbar sind. Zum anderen liefert die kritische Auseinandersetzung eine weitere Begleiterscheinung, die erst dann einleuchtet, wenn nach den Gründen von Musik in pädagogischen Kontexten wie den Schulen gefragt wird.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedeutung von Musik und mit der Frage inwiefern sich diese Bedeutung im Laufe der Zeit verändert hat. Diese Grundlage stellt die Überlegungen für die genaue Betrachtung des Kernlehrplans an den Schulen dar. Es soll untersucht werden, ob Transfereffekte innerhalb des Kernlehrplans bestehen und ob diese den Unterrichtsalltag mitgestalten. Dabei soll auch die Lehrperson in den Blick genommen werden, da sie als vermittelnde Instanz zwischen dem Lehrplan und den Schülern fungiert.
Im zweiten Teil erfolgt dann die theoretische Auseinandersetzung mit Studien zur Musik und ihrer Wirkungskraft. Die Bastian-Studie sowie die Studie zum Mozart-Effekt werden vorgestellt und anderen Positionen aus der Forschung gegenübergestellt.
Im letzten Teil der Arbeit soll ein Fazit gezogen werden, inwiefern Transfereffekte den Alltag des Musikunterrichts bestimmen und ob der Musikunterricht sich dieser Legitimation durch Transfereffekte beugen muss, oder ob es Möglichkeiten gibt, sich dieser Ansicht vieler zu entziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Warum Musik?
- Ein Blick in die ferne Vergangenheit
- Bedeutung und Funktion von Musik in der Neuzeit
- Missbrauch von Musik
- Werbung
- Der Kernlehrplan an den Schulen
- Kernlehrplan und Transfer
- Expertise bei (Musik-)Lehrern
- Zusammenfassung
- Transfer - Macht Musik schlau?
- Die Bastian-Studie
- Kritik an der Bastian-Studie
- Mozart-Effekt
- Kritische Worte zum Mozart-Effekt
- Musik und Sprache
- Musik und das Gehirn
- Musik und Persönlichkeit
- Aktueller Forschungsstand und Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Möglichkeiten und Grenzen von Transfereffekten durch Musik auf Basis empirischer Befunde zu untersuchen und kritisch zu diskutieren. Dabei wird die Frage behandelt, ob Musik tatsächlich kognitive Fähigkeiten und Leistungen verbessern kann, oder ob diese Behauptung nicht empirisch belegt ist.
- Die Bedeutung von Musik im Laufe der Zeit
- Der Einfluss von Musik auf das Gehirn und die kognitive Entwicklung
- Die Rolle des Kernlehrplans im Musikunterricht
- Transfereffekte von Musik auf andere Lernbereiche
- Kritische Auseinandersetzung mit Studien zu Transfereffekten von Musik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Transfereffekten von Musik. Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung von Musik im Laufe der Zeit beleuchtet und ein historischer Überblick über die Rolle von Musik in verschiedenen Kulturen gegeben. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob Musik tatsächlich kognitive Fähigkeiten und Leistungen verbessern kann, und analysiert verschiedene Studien zu diesem Thema, darunter die Bastian-Studie und der Mozart-Effekt. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem aktuellen Forschungsstand und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Musikforschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Transfereffekte, Musik, Lernen, Kognition, Intelligenz, Kernlehrplan, Musikunterricht, Bastian-Studie, Mozart-Effekt, empirische Forschung, Studien, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Macht Musik tatsächlich schlau?
Die Arbeit untersucht kritisch empirische Studien wie die Bastian-Studie und den Mozart-Effekt und kommt zu dem Schluss, dass viele behauptete Transfereffekte wissenschaftlich nicht eindeutig belegbar sind.
Was ist der "Mozart-Effekt"?
Der Mozart-Effekt bezeichnet die Theorie, dass das Hören von Musik von Wolfgang Amadeus Mozart kurzfristig die kognitive Leistungsfähigkeit steigert – eine These, die in der Arbeit kritisch hinterfragt wird.
Welche Rolle spielt der Kernlehrplan im Musikunterricht?
Es wird untersucht, ob der Lehrplan Transfereffekte als Begründung für den Musikunterricht nutzt und wie Lehrkräfte zwischen Lehrplanvorgaben und Unterrichtsalltag vermitteln.
Was besagt die Bastian-Studie?
Die Bastian-Studie ist eine bekannte Untersuchung zu den Auswirkungen von verstärktem Musikunterricht auf die Intelligenz und soziale Kompetenz von Grundschülern, die in dieser Arbeit kritisch diskutiert wird.
Muss sich Musikunterricht durch Transfereffekte legitimieren?
Die Arbeit hinterfragt, ob Musikunterricht nur dann als wertvoll gilt, wenn er Leistungen in anderen Fächern (wie Mathe oder Sprache) verbessert, oder ob Musik einen Eigenwert besitzt.
- Arbeit zitieren
- Kevin Kott (Autor:in), 2017, Leistungssteigerung durch Musik. Möglichkeiten und Grenzen des Musikunterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378336