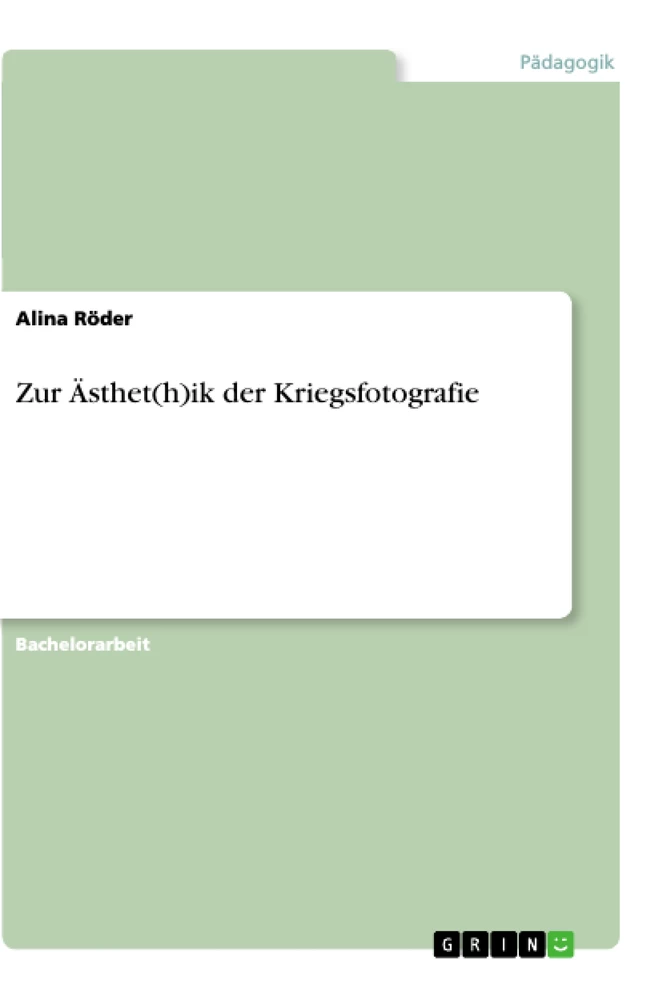Kriegsfotografien. Ein heikles Thema. So schrecklich sie sind, was für Grauenhaftigkeiten sie auch zeigen, manchmal kann man sich nicht erwehren: Sie berühren einen zutiefst, hinterlassen eine Spur im Gedächtnis des Betrachters. Manchmal ist der Auslöser dafür die Schönheit einer Aufnahme, welche man nicht in Worte fassen kann – oder darf?
In meiner Bachelorarbeit möchte ich mich genau mit diesem Phänomen beschäftigen: Warum sind ästhetische Momentaufnahmen des Grauens umstritten? Es soll herausgefunden werden, wie die ästhetische Wirkung und die Ethik, welche die Kriegsfotografien transportieren, im Zusammenhang stehen. Widersprechen sie sich oder gehen sie Hand in Hand?
Um diese Fragen zu beantworten wird das erste Kapitel zur Grundlagenklärung dienen. Die Begriffe der Kriegsfotografie, Ästhetik und Ethik werden geschichtlich untermauert und, auch wenn es aufgrund der vielfältigen Ansichten schwer fällt, möglichst definiert und eingegrenzt. Dabei liegt das Augenmerk auf den für diese Arbeit wichtigen Positionen.
Die theoretische Fundierung für die Beantwortung der Fragen liefert Susan Sontag. Ihre Essay-Sammlungen ‚Über Fotografie‘ und ‚Das Leiden anderer betrachten‘ werden hinsichtlich ihrer Meinung zur ethischen und ästhetischen Position der (Kriegs-)Fotografie genau untersucht. Ebenso werden ihre eigenen Ansichten beleuchtet, welche zum Verständnis durch ihre Biografie und eine zeitliche Einordnung ergänzt werden.
Nachfolgend sind Beispiele für Kriegsfotografen verschiedener Generationen aufgeführt. Welche ethischen Vorstellungen diese verfolgen und zu welchem Zweck sie ästhetische Mittel einsetzten, soll in diesem Kapitel exemplarisch herausgestellt werden.
Da Kriegsfotografien nahezu ausschließlich aus den Medien bekannt sind, spielen auch diese eine Rolle für die Beantwortung meiner Frage. Der ethische und ästhetische Umgang mit den Fotografien im Pressekontext wird genau betrachtet und die Bedeutung dieser Aufnahmen (für die Massenmedien) verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DEFINITIONEN
- 2.1 Kriegsfotografie
- 2.2 Ästhetik
- 2.3 Ethik
- 3. THEORETISCHE GRUNDLAGE
- 3.1 „Über Fotografie“ (,On Photography' - Susan Sontag 1977)
- 3.1.1 Zeitliche Einordnung von „Über Fotografie“ in Sontags Leben
- 3.1.2 Die ästhetische Doppelmoral
- 3.1.3 Abstumpfungsthese
- 3.2 ,,Das Leiden anderer betrachten“ (,Regarding the Pain of Others' – Susan Sontag 2003)
- 3.2.1 Zeitliche Einordnung von „Das Leiden anderer betrachten“ in Sontags Leben
- 3.2.2 Wirkungen von Kriegsfotografien
- 3.2.3 Ästhetische Kriegsfotografien
- 4. KRIEGSFOTOGRAFEN
- 4.1 Robert Capa
- 4.1.1 Capas Mission
- 4.1.2 Capas moralisches Verständnis
- 4.1.3 Capas Fließästhetik
- 4.1.4 Ein,Fotograf des Friedens‘
- 4.2 James Nachtwey
- 4.2.1 Nachtweys Mission
- 4.2.2 Nachtweys moralisches Verständnis
- 4.2.3 Nachtweys ästhetische Vorstellungen
- 4.2.4 Ein,Anti-Kriegsfotograf
- 4.3 Anja Niedringhaus
- 4.3.1 Niedringhaus' Mission
- 4.3.2 Niedringhaus' moralisches Verständnis
- 4.3.3 Niedringhaus' Ästhetik
- 4.3.4 Eine Fotografin des Krieges
- 5. MASSENMEDIEN
- 5.1 Die Moral der Massenmedien
- 5.2 Verwendung von Fotografien
- 5.3 Nicht der richtige Rahmen?
- 6. EIN FRIEDENSPÄDAGOGISCHES AUSSTELLUNGSPROJEKT
- 6.1 Friedenspädagogik
- 6.2 Ausstellungsbeispiel, The Family of Man‘
- 6.3 Konzeptionsentwurf einer friedenspädagogischen Kriegsfotografie-Ausstellung
- 7. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich der Frage, wie die ästhetische Wirkung von Kriegsfotografien mit ihrer ethischen Dimension zusammenhängt. Sie untersucht, ob die ästhetische Qualität von Fotos des Grauens in Widerspruch zur ethischen Botschaft steht oder ob beide Aspekte sich ergänzen.
- Die Bedeutung von Ästhetik und Ethik in der Kriegsfotografie
- Die Rolle von Susan Sontag und ihrer Theorien zur Kriegsfotografie
- Der ethische Umgang von Kriegsfotografen mit ihrem Sujet
- Die Verwendung von Kriegsfotografien in den Massenmedien
- Der Einsatz von Kriegsfotografien im Rahmen der Friedenspädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Kriegsfotografie und ihren Einfluss auf den Betrachter vor. Sie führt die Forschungsfrage ein, die sich mit der Beziehung zwischen Ästhetik und Ethik in der Kriegsfotografie auseinandersetzt.
Kapitel 2 definiert die wichtigsten Begriffe der Arbeit: Kriegsfotografie, Ästhetik und Ethik. Es beleuchtet die historischen Hintergründe und verschiedene Perspektiven auf diese Begriffe.
Kapitel 3 analysiert die Theorien von Susan Sontag, die sich mit der ethischen und ästhetischen Dimension der Fotografie auseinandersetzt. Es werden ihre beiden Essay-Sammlungen "Über Fotografie" und "Das Leiden anderer betrachten" beleuchtet und in den Kontext von Sontags Leben und Werk gestellt.
Kapitel 4 stellt verschiedene Kriegsfotografen unterschiedlicher Generationen vor und untersucht deren ethische Vorstellungen sowie deren ästhetischen Mittel.
Kapitel 5 widmet sich dem Umgang der Massenmedien mit Kriegsfotografien. Es beleuchtet den ethischen und ästhetischen Umgang mit den Fotografien im Pressekontext.
Kapitel 6 untersucht das Potenzial von Kriegsfotografien im Kontext der Friedenspädagogik. Es zeigt ein Ausstellungsbeispiel und skizziert ein Konzept für eine friedenspädagogische Kriegsfotografie-Ausstellung.
Schlüsselwörter
Kriegsfotografie, Ästhetik, Ethik, Susan Sontag, Medienethik, Friedenspädagogik, Ausstellungen, Robert Capa, James Nachtwey, Anja Niedringhaus.
- Citar trabajo
- Alina Röder (Autor), 2016, Zur Ästhet(h)ik der Kriegsfotografie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378370