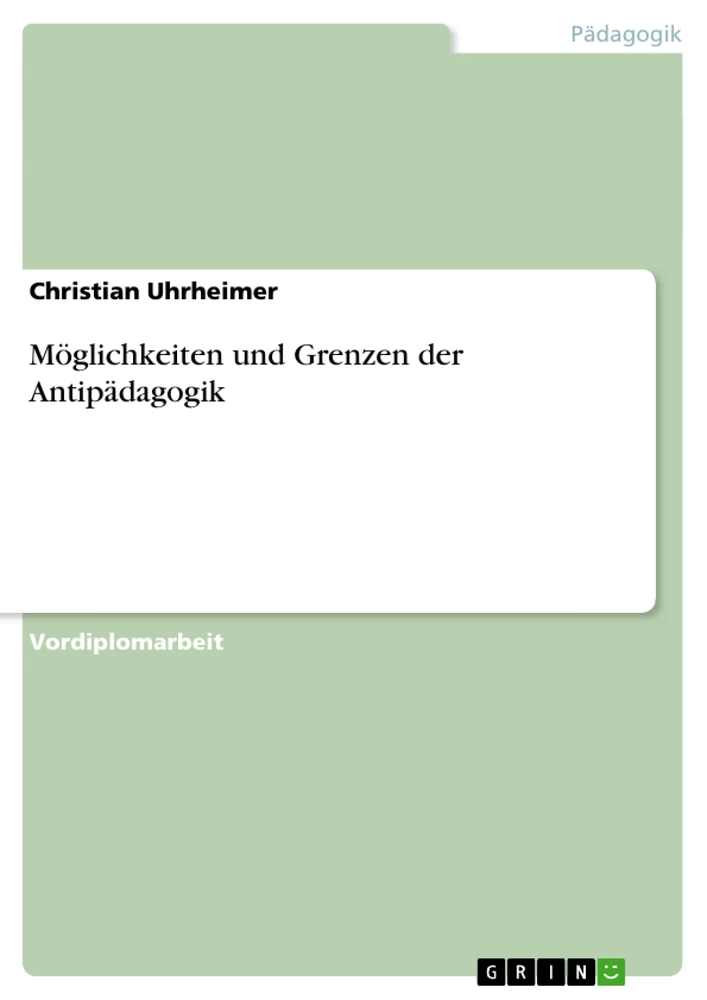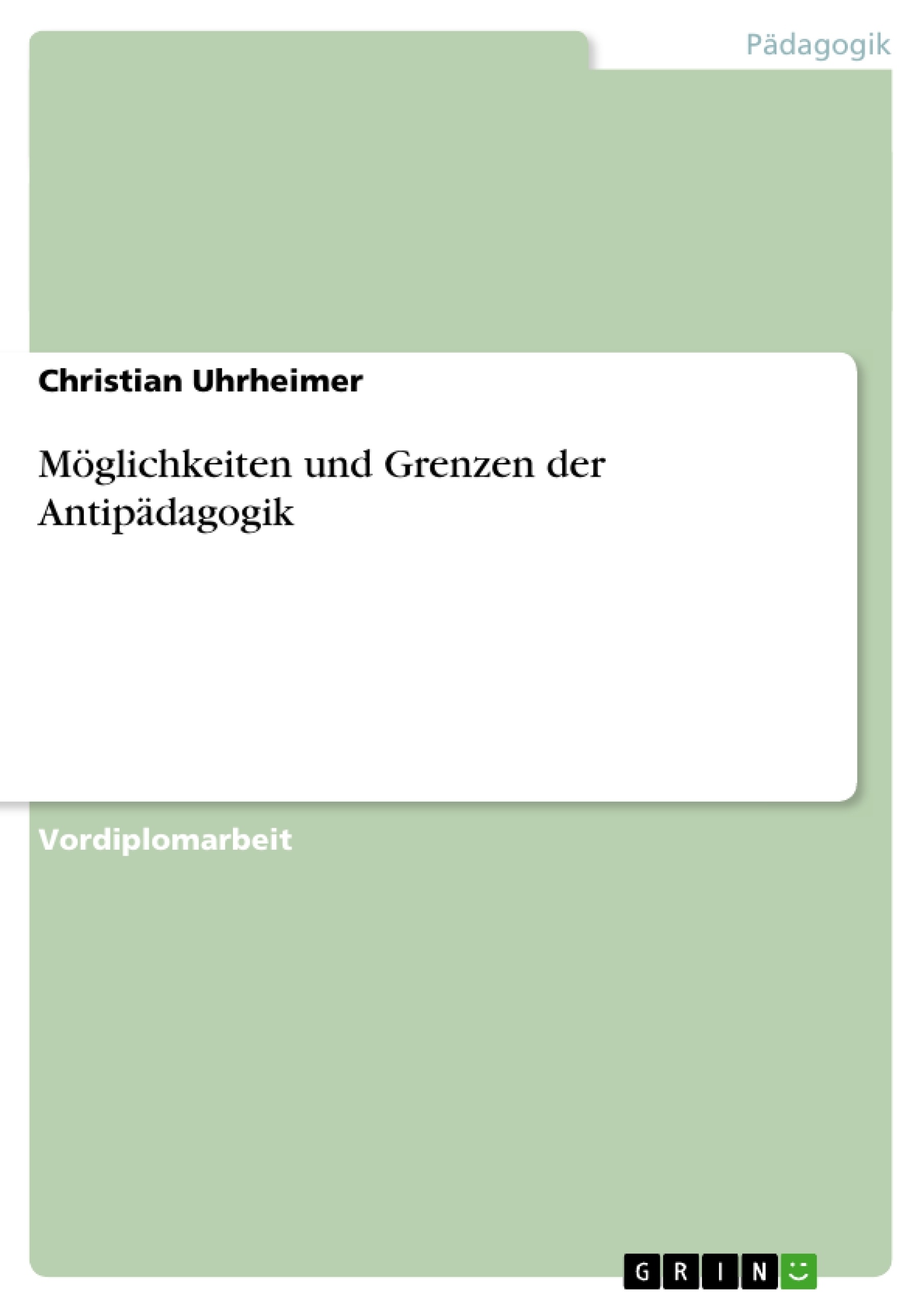In den siebziger Jahren entstand eine Bewegung, die sich radikal gegen jede Form von Erziehung wendet: die Antipädagogik. Sie war nicht einfach nur die Negation der Pädagogik, sondern entwickelte eine eigene – außerhalb des pädagogischen Systems stehende - Theorie vom Umgang mit Kindern. Es wird von einem völlig anderem Menschenbild als in der Pädagogik ausgegangen, welches von der Fähigkeit der Kinder ausgeht, von Geburt an selbst zu bestimmen, was das Beste für sie sei. Damit einhergehend werden Forderungen wie etwa rechtliche Gleichstellung von Kindern und Erwachsenen laut, die aus pädagogischer Sicht unvorstellbar wären. Aufgrund dieses grundlegend verschiedenen Selbstverständnisses gibt es (bzw. eher gab) es teilweise massive und aggressive Anfeindungen und wüste Beschimpfungen gegenüber der Pädagogik und ihrer Vertreter.
Die verschiedenen Strömungen der Antipädagogik eint jedoch lediglich der Konsens, gegen jeden pädagogischen Einfluss auf Kinder zu sein. Da die Antipädagogen jedoch sonst sehr heterogene Auffassungen und Strategien vertreten, halte ich es für sinnvoll die geschichtliche Entwicklung dieser Bewegung mit ihren verschiedenen Vorstellungen (z.T. anhand ihrer Vertreter) darzustellen, um so einen Überblick über die Bandbreite und die diversen Inhalte der Antipädagogik zu geben.
Im dritten Kapitel werde ich Auszüge von Dialogen zwischen Pädagogen und Antipädagogen (hauptsächlich v. Schoenebeck) herausgreifen und mich dabei selber zu den jeweiligen Streitpunkten positionieren. Dabei zeige ich bereits Grenzen der Antipädagogik auf, aber auch einige sinnvolle Ideen und Vorstellungen werden dementsprechend kommentiert.
Allgemeiner und systematisierender gehe ich dann im nächsten Kapitel auf die Grenzen der Antipädagogik ein, bevor ich mich näher mit ihren Möglichkeiten auseinandersetze und schließlich ein Fazit daraus ziehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung antipädagogischer Ideen
- Die Kinderrechtsbewegung
- Heinrich Kupffer
- Maud Mannoni
- Ekkehard von Braunmühl
- Katharina Rutschky
- Alice Miller
- Hubertus von Schoenebeck
- Dialoge zwischen Antipädagogen und Pädagogen:
- Andreas Flitner: „Konrad sprach die Mama“
- Diskussionsformen zwischen Vertretern der Pädagogik und Antipädagogik
- Schulpflicht
- Verantwortung für das Kind
- Jürgen Oelkers/Thomas Lehmann: „Antipädagogik. Herausforderung und Kritik“
- Erziehungsanspruch
- Vernunft durch Erziehung oder ihrer Abschaffung?
- Authentizität von Gefühlsäußerungen
- Michael Winkler: „Stichworte zur Antipädagogik“
- Anneignung der Bedingungen menschlichen Lebens
- Andreas Flitner: „Konrad sprach die Mama“
- weitere Grenzen der Antipädagogik Antipädagogik und die Realität
- Möglichkeiten der Antipädagogik
- Kritik an den Erziehungsinstitutionen
- Hinterfragung der Notwendigkeit von Erziehung
- Freundschaft mit Kindern und gegenseitiger Respekt
- Keine Verantwortung für das Kind
- Non-direktive Pädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Antipädagogik, einer Bewegung, die sich radikal gegen jede Form von Erziehung wendet. Er verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Antipädagogik zu beleuchten, ihre verschiedenen Strömungen zu analysieren und ihre Grenzen sowie Möglichkeiten aufzuzeigen.
- Die Entstehung und historische Entwicklung der Antipädagogik
- Die wichtigsten Vertreter und ihre theoretischen Ansätze
- Dialoge und Kontroversen zwischen Antipädagogen und Pädagogen
- Grenzen und Möglichkeiten der Antipädagogik in der Praxis
- Die Relevanz der Antipädagogik für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Antipädagogik und beschreibt ihren Ursprung in den 1970er Jahren. Es beleuchtet die grundlegenden philosophischen und anthropologischen Annahmen der Bewegung, die sich von der traditionellen Pädagogik deutlich unterscheiden.
Das zweite Kapitel stellt die wichtigsten Vertreter und Strömungen der Antipädagogik vor, beginnend mit der Kinderrechtsbewegung und ihrer Forderung nach rechtlicher Gleichstellung von Kindern und Erwachsenen. Es werden auch die Ansätze von Heinrich Kupffer, Maud Mannoni, Ekkehard von Braunmühl, Katharina Rutschky, Alice Miller und Hubertus von Schoenebeck erörtert.
Das dritte Kapitel analysiert Dialoge zwischen Pädagogen und Antipädagogen, insbesondere mit Blick auf die Positionen von Hubertus von Schoenebeck. Es beleuchtet verschiedene Streitpunkte wie die Schulpflicht, die Verantwortung für das Kind und die Frage der Authentizität von Gefühlsäußerungen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Grenzen der Antipädagogik, indem es ihre praktische Umsetzung und ihre Auswirkungen auf die Realität in den Blick nimmt.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Möglichkeiten der Antipädagogik, indem es kritische Punkte der Erziehungsinstitutionen aufzeigt und alternative Ansätze wie non-direktive Pädagogik vorstellt.
Schlüsselwörter
Antipädagogik, Kinderrechte, Selbstbestimmung, Emanzipation, Erziehungskritis, Anthropologie, Pädagogik, Non-direktive Pädagogik, Diskussionen, Grenzen, Möglichkeiten, Verantwortung, Kinderrechtsbewegung, Richard Farson, John Holt, Christiane Rochefort, Heinrich Kupffer, Andreas Flitner, Jürgen Oelkers, Thomas Lehmann, Michael Winkler, Hubertus von Schoenebeck.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Grundgedanke der Antipädagogik?
Die Antipädagogik lehnt jede Form von Erziehung als manipulative Machtausübung ab. Sie geht davon aus, dass Kinder von Geburt an fähig sind, selbst zu bestimmen, was gut für sie ist.
Wer sind die bekanntesten Vertreter der Antipädagogik?
Wichtige Namen sind Hubertus von Schoenebeck, Ekkehard von Braunmühl und Katharina Rutschky. Auch Alice Miller wird oft im Kontext der Erziehungskritik genannt.
Was fordert die Kinderrechtsbewegung?
Sie fordert die rechtliche und soziale Gleichstellung von Kindern und Erwachsenen, einschließlich der Abschaffung der Schulpflicht und des Rechts auf Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen.
Welche Grenzen hat das Konzept der Antipädagogik?
Kritiker weisen auf die Schutzbedürftigkeit von Kindern und die notwendige Verantwortung der Erwachsenen hin. In der Realität stoßen antipädagogische Ansätze oft an gesellschaftliche und rechtliche Grenzen.
Was bedeutet „Freundschaft mit Kindern“ statt Erziehung?
Anstelle von Hierarchie und Erziehungsansprüchen tritt ein Modell des gegenseitigen Respekts und der gleichberechtigten Begleitung, ähnlich einer Freundschaft unter Erwachsenen.
- Quote paper
- Christian Uhrheimer (Author), 2002, Möglichkeiten und Grenzen der Antipädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37837