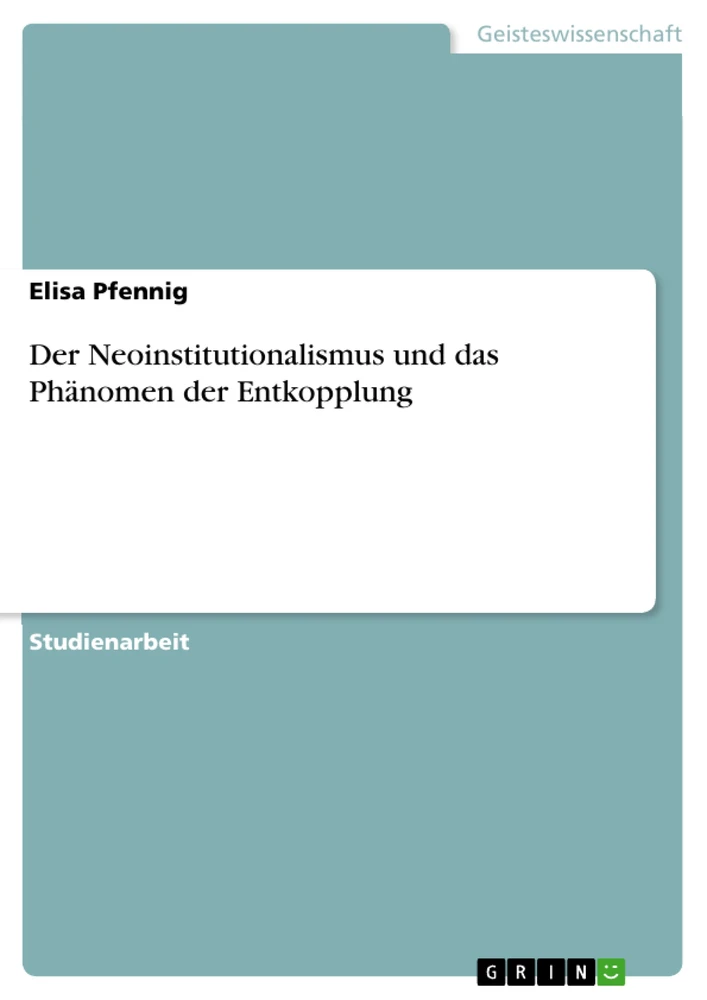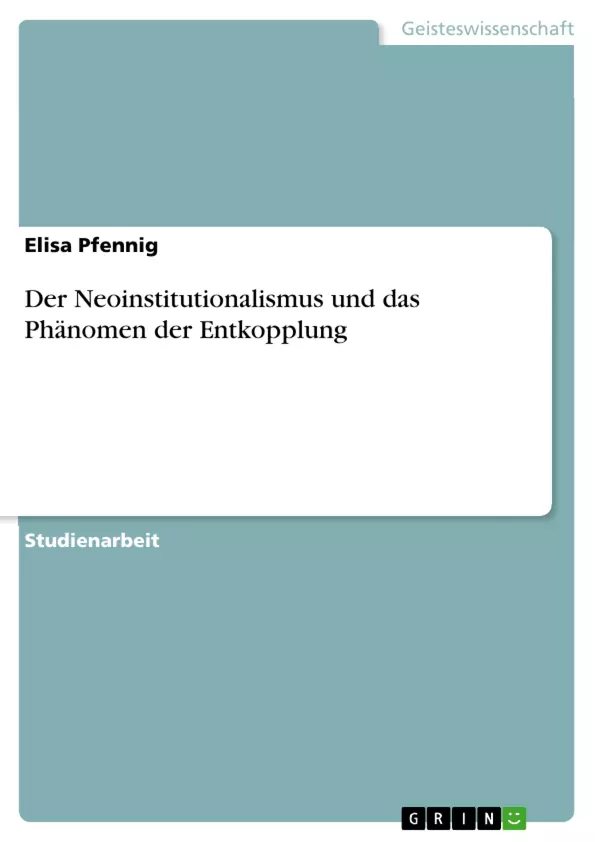Diese Arbeit beschäftigt sich mit Organisationen anhand des konzeptionellen Zugangs des Neoinstitutionalismus. Dies beinhaltet einen Institutionenbegriff, welcher ein Ensemble sozialer Handlungsregeln beschreibt, die von Dauer, maßgeblich und verbindlich sind. Die sozialen Handlungsregeln können als institutionelle Umwelt beschrieben werden. Der Neoinstitutionalismus ist hierbei ein Ansatz, der Strukturen und Operationsweisen von Organisationen durch Bezug auf Normen, Erwartungen und Leitbilder der institutionellen Umwelt erklärt.
Wie verbindlich sind soziale Handlungsregeln für Organisationen wirklich? Wie unterscheidet sich die an Umwelterwartungen orientierte Formalstruktur von Organisationen von ihrer Aktivitätsstruktur? Was verschafft Organisationen institutionelle Legitimität? Diese Arbeit versucht zu klären, ob Formalstruktur und Aktivitätsstruktur einer Organisation deckungsgleich sind oder sich voneinander entkoppeln.
Zu Beginn sollen kurz die Beispielorganisation GleisBeet e.V. und ihr Fassadenbau erläutert werden. Anschließend folgt eine Einführung in das theoretische Konzept des Neoinstitutionalismus. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Phänomen der Entkopplung. Dieses Phänomen soll anhand der Formalstruktur des GleisBeet e.V. untersucht werden. Diese wird mit der Aktivitätsstruktur, also der Vereinspraxis, abgeglichen, um die Frage zu beantworten, ob für den Verein GleisBeet e.V. das Phänomen der Entkopplung wirkt und worauf dies zurückzuführen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fassadenbau im GleisBeet e.V.
- Neoinstitutionalismus und das Phänomen der Entkopplung
- GleisBeet e.V.
- Formalstruktur
- Aktivitätsstruktur
- Vereinszweck
- Vereinsmitglieder
- Vereinsvorstand
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Strukturen und Funktionsweisen von Organisationen im Kontext des Neoinstitutionalismus. Sie konzentriert sich auf das Phänomen der Entkopplung, bei dem die Formalstruktur einer Organisation (z. B. die Vereinssatzung) von ihrer tatsächlichen Aktivitätsstruktur abweicht. Die Arbeit analysiert dieses Phänomen anhand des Beispiels des Vereins GleisBeet e.V. und untersucht, wie die Organisation ihre Formalstruktur an den Erwartungen ihrer institutionellen Umwelt anpasst, während sie gleichzeitig ihre interne Funktionsweise an anderen Logiken ausrichtet.
- Neoinstitutionalismus und seine zentralen Konzepte
- Das Phänomen der Entkopplung in Organisationen
- Die Formalstruktur und Aktivitätsstruktur des GleisBeet e.V.
- Die Bedeutung von institutioneller Legitimität für Organisationen
- Die Herausforderungen der Abstimmung von Formalstruktur und Aktivitätsstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen Organisationen agieren. Kapitel 2 beleuchtet das Phänomen des Fassadenbaus am Beispiel des GleisBeet e.V. und verdeutlicht den Unterschied zwischen der nach außen hin konstruierten Fassade und den tatsächlichen inneren Prozessen des Vereins. Kapitel 3 bietet eine Einführung in den Neoinstitutionalismus und erläutert die Konzepte von Isomorphie, organisationalen Feldern und Entkopplung. Im Mittelpunkt des Kapitels steht das Phänomen der Entkopplung als zentrale Wirkungsmechanismus des Neoinstitutionalismus. In Kapitel 4 wird die Formalstruktur des GleisBeet e.V. anhand seiner Vereinssatzung analysiert. Diese wird anschließend mit der Aktivitätsstruktur des Vereins abgeglichen, um das Phänomen der Entkopplung im konkreten Fall zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Neoinstitutionalismus, Entkopplung, Formalstruktur, Aktivitätsstruktur, Organisation, Verein, Legitimität, Umwelterwartungen, Fassadenbau, GleisBeet e.V., Vereinsstruktur, Vereinszweck, Vereinsmitglieder, Vereinsvorstand, soziale Handlungsregeln, institutionelle Umwelt.
- Quote paper
- Elisa Pfennig (Author), 2015, Der Neoinstitutionalismus und das Phänomen der Entkopplung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378409