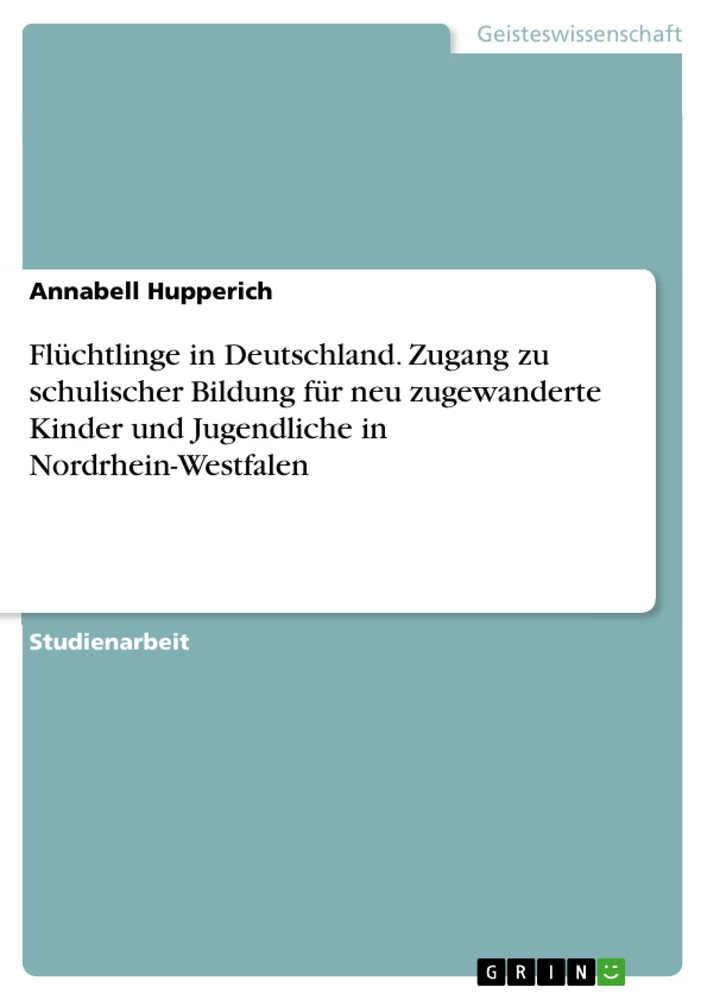In dieser Arbeit werden vorab die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Dazu wird kurz der Ablauf des Asylverfahrens erläutert und daran anschließend die Aufenthaltserlaubnis, die Duldung, sowie der illegale Aufenthalt in Deutschland abgrenzend voneinander dargestellt. Dies ist hinsichtlich der vorab skizzierten Fragestellung relevant, weil sich daraus sowohl verschiedene Möglichkeiten der Integration in das deutsche Schulsystem, als auch verschiedene spezifische Herausforderungen und Probleme für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen, ergeben. Es folgt anschließend ein kurzer Blick auf die aktuellen Flüchtlingszahlen im Land Nordrhein-Westfalen. Im Folgenden werden dann das Bildungsrecht in Bezug auf neu zugewanderte Kinder und Jugendliche dargestellt und in den Kontext verschiedener Aufenthaltstitel gestellt. Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie sich das Aufenthaltsrecht auf den Zugang ins nordrheinwestfälische Schulsystem gestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.1 Asylverfahren
- 2.2 Asyl in Deutschland
- 2.3 Die Duldung
- 2.4 Illegalität
- 2.5 Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen
- 3 Bildungsrecht für „Flüchtlinge“
- 3.1 Ressource Bildung
- 3.2 Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem
- 3.3 Zugang zu Schulbildung in Nordrhein-Westfalen
- 4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der schulischen Bildungssituation von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Deutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Sie untersucht, inwiefern aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingungen den Zugang zur Bildung beeinflussen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Asylsuchende in Deutschland
- Integration von Flüchtlingen in das deutsche Schulsystem
- Hürden und Herausforderungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche
- Der Einfluss von Aufenthaltsrechten auf Bildungsmöglichkeiten
- Aktuelle Forschungslage zur Bildungssituation von minderjährigen Flüchtlingen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in das Thema und beleuchtet die aktuelle Situation von Flüchtlingen weltweit und in Deutschland. Das zweite Kapitel befasst sich mit den relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, darunter das Asylverfahren, verschiedene Aufenthaltstitel und die spezifischen Herausforderungen für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das Bildungsrecht für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche und untersucht den Einfluss von Aufenthaltstiteln auf den Zugang zum nordrhein-westfälischen Schulsystem.
Schlüsselwörter
Flüchtlinge, Bildung, Integration, Schulsystem, Asylverfahren, Aufenthaltsrecht, Nordrhein-Westfalen, Zugang zu Bildung, Bildungsverläufe, Minderjährige, Flüchtlingsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflussen den Schulzugang für Flüchtlinge in NRW?
Der Zugang zum Schulsystem wird maßgeblich durch den Aufenthaltsstatus (Aufenthaltserlaubnis, Duldung oder illegaler Aufenthalt) und den Ablauf des Asylverfahrens bestimmt.
Was ist das Ziel dieser Untersuchung?
Die Arbeit untersucht, wie aufenthaltsrechtliche Bedingungen die Integration neu zugewanderter Kinder in das deutsche Schulsystem in Nordrhein-Westfalen beeinflussen.
Welche spezifischen Herausforderungen ergeben sich für geflüchtete Kinder?
Herausforderungen entstehen durch unterschiedliche Bildungsbiografien, sprachliche Barrieren und die rechtliche Unsicherheit je nach Aufenthaltstitel.
Gibt es ein Recht auf Bildung für Kinder ohne legalen Aufenthaltsstatus?
Die Arbeit setzt das Bildungsrecht in den Kontext verschiedener Aufenthaltstitel und beleuchtet auch die Situation bei Illegalität.
Wie aktuell sind die in der Arbeit genannten Flüchtlingszahlen?
Die Arbeit wirft einen Blick auf die damals aktuellen Flüchtlingszahlen im Land Nordrhein-Westfalen als Kontext für die bildungsrechtliche Analyse.
- Arbeit zitieren
- Annabell Hupperich (Autor:in), 2016, Flüchtlinge in Deutschland. Zugang zu schulischer Bildung für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378546