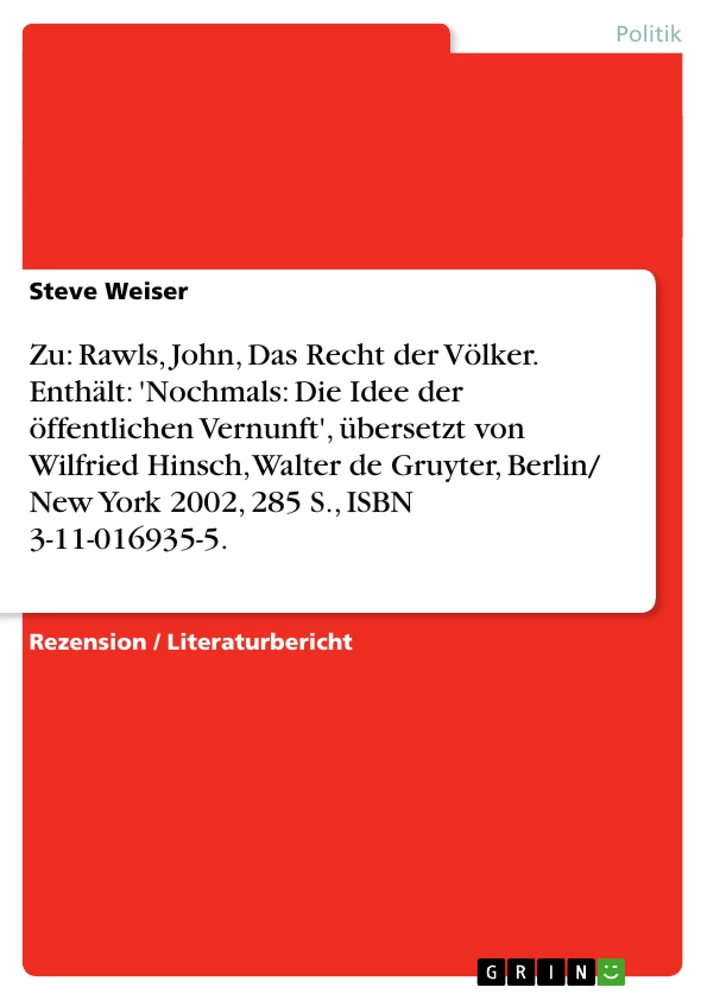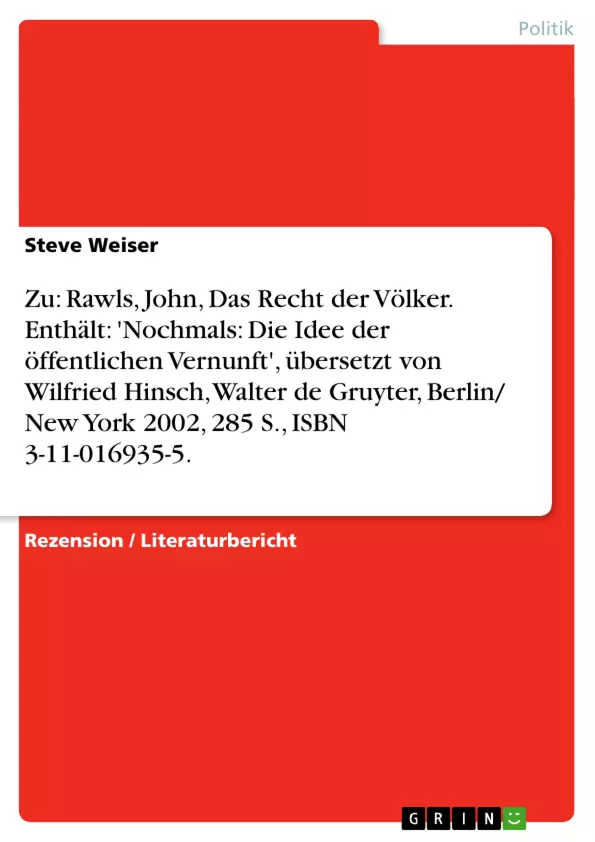John Borden Rawls (geb. 1921, gest. 2002) war einer der bekanntesten politischen Philosophen und der Vertragstheoretiker unserer Zeit. Während seiner fast vierzigjährigen Tätigkeit als Professor für politische Philosophie an der Harvard University, veröffentlichte er 1971 sein wohl berühmtestes Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ („A Theory of Justice“) und wurde somit zum Begründer des egalitären Liberalismus. Sein letztes Werk „Das Recht der Völker“ („The Law of Peoples“, 1999) ist die konsequente Weiterentwicklung des schon in „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ begonnenen Ansatzes einer Ausweitung seiner liberalen Gerechtigkeitskonzeption von nationaler Ebene auf die multilaterale Ebene. Rawls setzt dabei sein Modell eines gerechten Gesellschaftsvertrages ein, um eine friedliche und gerecht Weltordnung - das Recht der Völker - zu entwickeln und so den großen Übeln der Menschheit (Krieg, Unterdrückung und Ungerechtigkeit) zu begegnen.
Die Konzeption ist hierbei allgemeiner und wird auf fünf Gesellschaftstypen angewandt, welche sich in einem hypothetischen Urzustand und hinter dem Wissen einschränkenden „Schleier des Nichtwissens“ befinden. Erstens „vernünftige liberale [und demokratische] Gesellschaften“, die im ersten Teil „der Idealtheorie“ - behandelt werden. Im zweiten Teil der Idealtheorie werden die „achtbaren [hierarchischen] Völker“ näher behandelt, die sich durch Konsultationshierarchien auszeichnen, aber nicht liberal sind. Zusammen werden diese Typen als „wohlgeordnete Völker“ bezeichnet. Drittens gibt es „Schurkenstaaten“, viertens „durch ungünstige Umstände belastete Gesellschaften“ mit denen sich im dritten Teil, der nichtidealen Theorie, auseinandergesetzt wird. Und letztlich „wohlwollende absolutistische Gesellschaften“, die Menschenrecht achten, aber nicht wohlgeordnet sind, weil sie ihren Bürgern politische Partizipation verweigern.
Inhaltsverzeichnis
- Der Idealtheorie
- Das Recht der Völker: Eine realistische Utopie
- Gerechtigkeit als Fairneß und die internationale Ebene
- Die „Schleier des Nichtwissens“ und die Souveränität der Gesellschaften
- Der Urzustand auf internationaler Ebene
- Gerechtigkeitsgrundsätze für die Völkergemeinschaft
- Die Idealtheorie: Erweiterung auf achtbare Gesellschaften
- Toleranz und der Aufbau gerechter Beziehungen zwischen Gesellschaften
- Menschenrechte als Mindeststandards für eine wohlgeordnete Gesellschaft
- Die Rolle der Konsultationshierarchie in achtbaren Gesellschaften
- Die nichtideale Theorie: Anwendungsprobleme
- Schurkenstaaten und ihre Ablehnung des Völkerrechts
- Gesellschaften mit ungünstigen Bedingungen
- Der Krieg als letztes Mittel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
John Rawls’ „Das Recht der Völker“ befasst sich mit der Erweiterung seiner liberalen Gerechtigkeitskonzeption von nationaler Ebene auf die internationale Ebene. Er zielt darauf ab, ein friedliches und gerechtes Weltordnung, das Recht der Völker, zu entwickeln, um den großen Übeln der Menschheit (Krieg, Unterdrückung und Ungerechtigkeit) zu begegnen.
- Entwicklung eines Gerechtigkeitskonzepts für die internationale Ebene
- Analyse verschiedener Gesellschaftstypen und ihrer Rolle in der internationalen Ordnung
- Der „Schleier des Nichtwissens“ und seine Bedeutung für die Entwicklung eines Völkerrechts
- Die Anwendung von Gerechtigkeitsgrundsätzen auf internationale Beziehungen
- Der Einsatz von Krieg als letztes Mittel
Zusammenfassung der Kapitel
Der Idealtheorie
Rawls stellt eine Welt vor, in der ein auf demokratischen Werten basierendes Völkerecht existiert, das alle Völker akzeptieren können. Dieses Recht berücksichtigt die Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaften und soll durch seinen Pluralismus und seine Vernunft für alle als anerkennbar gelten. Der Fokus liegt auf der „Gerechtigkeit als Fairneß“ innerhalb von Gesellschaften, die sich auf internationaler Ebene manifestieren soll.
Die Idealtheorie: Erweiterung auf achtbare Gesellschaften
Rawls erweitert seine Theorie auf „achtbare Gesellschaften“, die zwar nicht liberal sind, aber bestimmte Bedingungen erfüllen, wie die Einhaltung von Menschenrechten, die Förderung von Frieden und die Nutzung diplomatischer Mittel. Der Urzustand ist auch für hierarchische Völker ein geeignetes Darstellungsmittel, da die Vertreter vernünftig handeln und von bestimmten Gründen geleitet werden.
Die nichtideale Theorie: Anwendungsprobleme
Rawls behandelt die Herausforderungen bei der Umsetzung des Völkerrechts auf die Völkergemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf Schurkenstaaten und Gesellschaften mit ungünstigen Bedingungen. Er argumentiert, dass Krieg nur zur Selbstverteidigung und zum Schutz von anderen Gesellschaften gerechtfertigt ist. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Kriegen und der Heranführung nicht wohlgeordneter Gesellschaften an die Völkergemeinschaft.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte von Rawls’ „Das Recht der Völker“ sind: Gerechtigkeit als Fairneß, Völkerrecht, Ideal- und nichtideale Theorie, „Schleier des Nichtwissens“, Urzustand, Menschenrechte, wohlgeordnete Gesellschaften, achtbare Gesellschaften, Schurkenstaaten, Krieg, und internationale Kooperation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von John Rawls' Werk "Das Recht der Völker"?
Rawls zielt darauf ab, seine liberale Gerechtigkeitskonzeption auf die internationale Ebene auszuweiten, um eine friedliche und gerechte Weltordnung zu begründen.
Was bedeutet der "Schleier des Nichtwissens" im internationalen Kontext?
Es ist ein Gedankenexperiment, bei dem Vertreter von Völkern über Gerechtigkeitsgrundsätze entscheiden, ohne ihre spezifische Machtposition oder Ressourcen zu kennen, um Fairness zu garantieren.
Welche Gesellschaftstypen unterscheidet Rawls?
Er unterscheidet vernünftige liberale Völker, achtbare hierarchische Völker, Schurkenstaaten, belastete Gesellschaften und wohlwollende absolutistische Gesellschaften.
Was charakterisiert "achtbare Völker" nach Rawls?
Achtbare Völker sind nicht liberal, halten aber Menschenrechte ein, sind friedfertig und besitzen eine Konsultationshierarchie, die politische Teilhabe ermöglicht.
Wann ist Krieg laut Rawls gerechtfertigt?
Innerhalb seiner nichtidealen Theorie argumentiert Rawls, dass Krieg nur als letztes Mittel zur Selbstverteidigung oder zum Schutz von Menschenrechten gegen Schurkenstaaten zulässig ist.
- Citar trabajo
- Steve Weiser (Autor), 2005, Das Konzept von Gerichtigkeit auf multilateraler Ebene. John Rawls "Das Recht der Völker", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37863