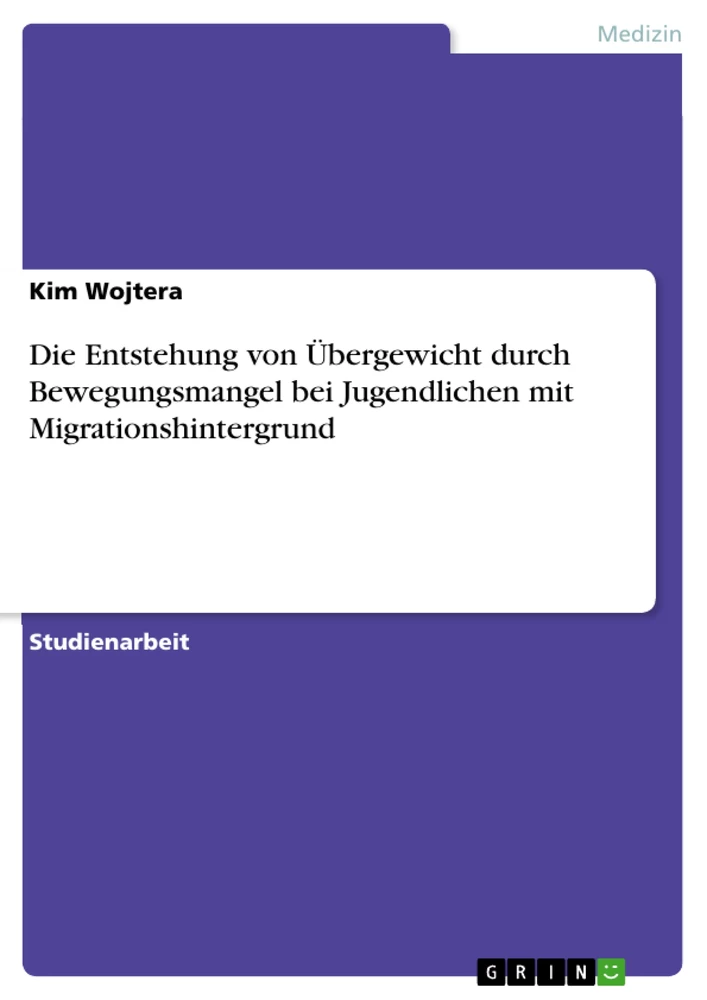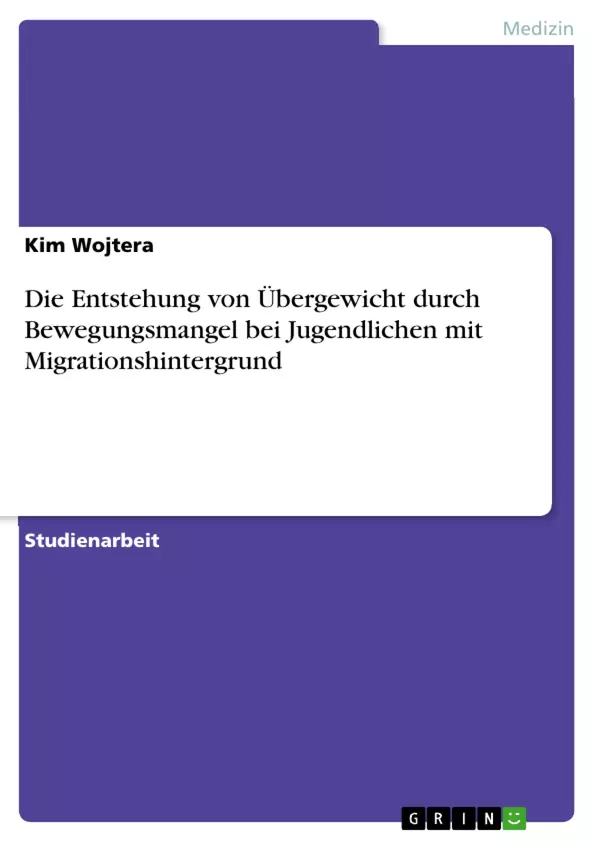In dieser Hausarbeit beschäftigt sich die Autorin mit der Fragestellung, warum gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund zur Risikogruppe für Übergewicht durch zu wenig körperliche Aktivität gehören. Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist relativ neu und hat bisher keine einheitliche Definition. Daher werden unter diesem Begriff alle Zuwanderergruppen, als auch deren Nachkommen verstanden. Danach haben bereist eingebürgerte Migranten/innen und ebenfalls die in Deutschland geborenen Nachkommen dieser Familien einen Migrationshintergrund.
2014 lebten in Deutschland rund 16,4 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund (20,3% der Bevölkerung) (vgl. Statistisches Bundesamt, 2015, S. 1). Durch die hohe Zahl der Zuwanderer wird der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund immer weiter ansteigen. Aus diesem Grund ist es entscheidend, auch diese Menschen vor gesundheitlichen Problemen zu beschützen und die Prävalenz von Übergewicht zu minimieren ist ein Ansatzpunkt, um der Entstehung verschiedener Krankheitsbilder präventiv entgegenzuwirken.
Ziel der Arbeit ist es Maßnahmen abzuleiten, die dem Problem des Übergewichts entgegenwirken. Eine Möglichkeit die Jugendlichen zu erreichen, ist es das Setting Schule zu nutzen, um die Schüler für mehr sportliche Betätigung zu begeistern. In dieser Hausarbeit wird beschrieben, aus welchen Gründen sich das Setting Schule zur Anwendung der Förderungsmaßnahmen für Bewegung und Sport bei Jugendlichen eignet. Die Autorin entwickelt daher Handlungsempfehlungen für Schulen, um die Bewegung bei Jugendlichen in der Schule mit dem Fokus auf Migranten/innen zu fördern. Dadurch soll das Risiko für die Entstehung von Übergewicht minimiert werden. In dieser Arbeit werden als Jugendliche alle in Deutschland lebenden Menschen zwischen 11 und 18 Jahren definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Übergewicht
- 2.1. Abgrenzung von Übergewicht und Adipositas
- 2.2. Entstehung von Übergewicht
- 2.3. Folgeerkrankungen von Übergewicht
- 2.4. Bestimmung von Übergewicht bzw. Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- 3. Methodisches Vorgehen für den weiteren Verlauf der Hausarbeit
- 3.1. Auswahlkriterien für Literatur
- 3.2. Vorgehensweise bei der Literaturrecherche
- 3.3. Übersicht der wichtigsten Literatur für die Hausarbeit
- 4. Prävalenz von Übergewicht bei Jugendlichen in Deutschland
- 4.1. Vorstellung relevanter Studien
- 4.2. Vergleich der Prävalenz von Übergewicht bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit der Prävalenz bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund
- 5. Risikofaktor: Bewegungsmangel bei Jugendlichen
- 5.1. Auswirkungen von Bewegungsmangel auf die Gesundheit Jugendlicher
- 5.2. Bewegungsmangel bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- 5.3. Auswirkungen sozialer Ungleichheiten bei Jugendlichen auf das Gesundheitsverhalten
- 6. Maßnahmen zur Förderung von Bewegung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Setting Schule
- 6.1. Vorteile der Anwendung von bewegungsfördernden Maßnahmen für Jugendliche im Setting Schule
- 6.2. Handlungsempfehlungen für Schulen in Bezug auf das Bewegungsangebot für Jugendliche mit Migrationshintergrund
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Problematik des Übergewichts bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie untersucht die Entstehung von Übergewicht durch Bewegungsmangel in dieser Gruppe und analysiert die relevanten Faktoren, die zur Risikogruppe beitragen. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Förderung von Bewegung im Setting Schule entwickelt, um die Prävalenz von Übergewicht zu senken und die Gesundheit der Jugendlichen zu verbessern.
- Prävalenz von Übergewicht bei Jugendlichen in Deutschland
- Risikofaktor Bewegungsmangel
- Soziale Ungleichheiten und Gesundheitsverhalten
- Bewegungsförderung im Setting Schule
- Handlungsempfehlungen für Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik von Übergewicht bei Jugendlichen in Deutschland, das immer weiter zunimmt und eine Belastung für das Gesundheitssystem darstellt. Die Arbeit fokussiert sich auf Jugendliche mit Migrationshintergrund als Risikogruppe. Kapitel 2 definiert Übergewicht und Adipositas, erläutert die Entstehung und Folgeerkrankungen sowie die Bestimmung des BMI bei Kindern und Jugendlichen. Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Hausarbeit, inklusive der Auswahlkriterien für Literatur und der Literaturrecherche. Kapitel 4 untersucht die Prävalenz von Übergewicht bei Jugendlichen in Deutschland und vergleicht diese mit der Prävalenz bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Kapitel 5 analysiert den Risikofaktor Bewegungsmangel bei Jugendlichen, seine Auswirkungen auf die Gesundheit und die Besonderheiten bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Kapitel 6 behandelt Maßnahmen zur Förderung von Bewegung im Setting Schule, wobei die Vorteile und Handlungsempfehlungen für Schulen im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Übergewicht, Bewegungsmangel, Migrationshintergrund, Prävalenz, Gesundheit, Jugendliche, Schule, Handlungsempfehlungen und Prävention. Die Analyse fokussiert sich auf die Rolle sozialer Ungleichheiten im Zusammenhang mit dem Gesundheitsverhalten von Jugendlichen und den Möglichkeiten zur Förderung von Bewegung im schulischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Jugendliche mit Migrationshintergrund stärker von Übergewicht betroffen?
Die Arbeit nennt Bewegungsmangel und soziale Ungleichheiten als zentrale Faktoren, die diese Gruppe zur Risikogruppe machen.
Wie wird der Begriff „Migrationshintergrund“ in der Arbeit definiert?
Er umfasst alle Zuwanderergruppen sowie deren in Deutschland geborene Nachkommen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Prävention?
Das Setting Schule eignet sich ideal, um alle Jugendlichen zu erreichen und sie nachhaltig für mehr sportliche Betätigung zu begeistern.
Welche Altersgruppe steht im Fokus der Untersuchung?
Die Arbeit definiert als Jugendliche alle in Deutschland lebenden Menschen im Alter zwischen 11 und 18 Jahren.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Autorin für Schulen?
Es werden spezifische Maßnahmen zur Bewegungsförderung entwickelt, die besonders auf die Bedürfnisse von Migranten/innen zugeschnitten sind.
- Quote paper
- Kim Wojtera (Author), 2016, Die Entstehung von Übergewicht durch Bewegungsmangel bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378994