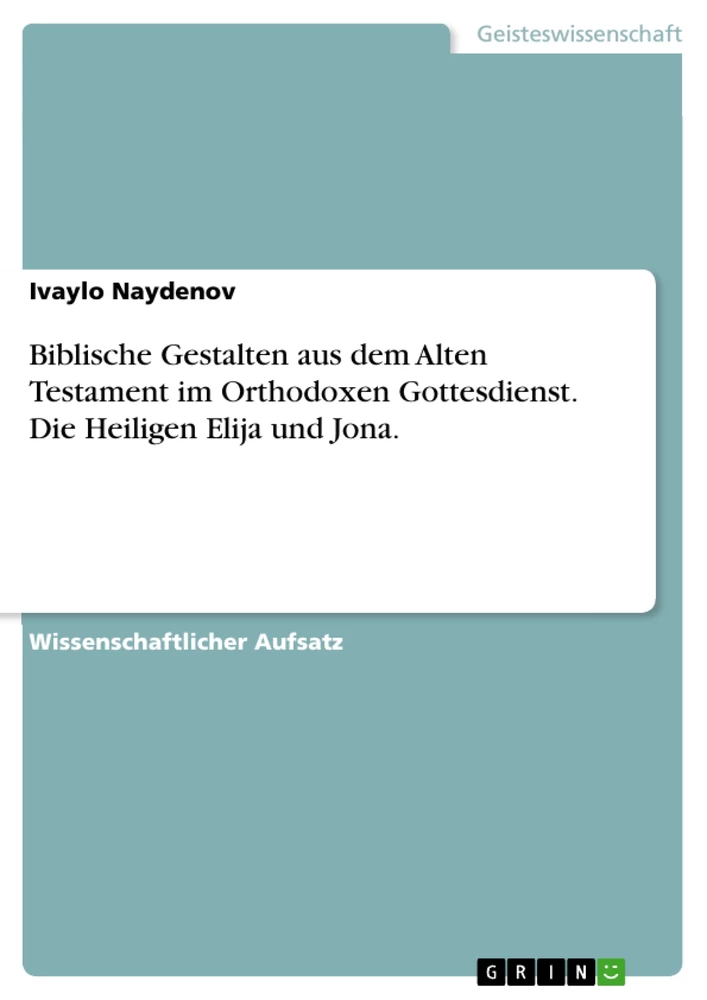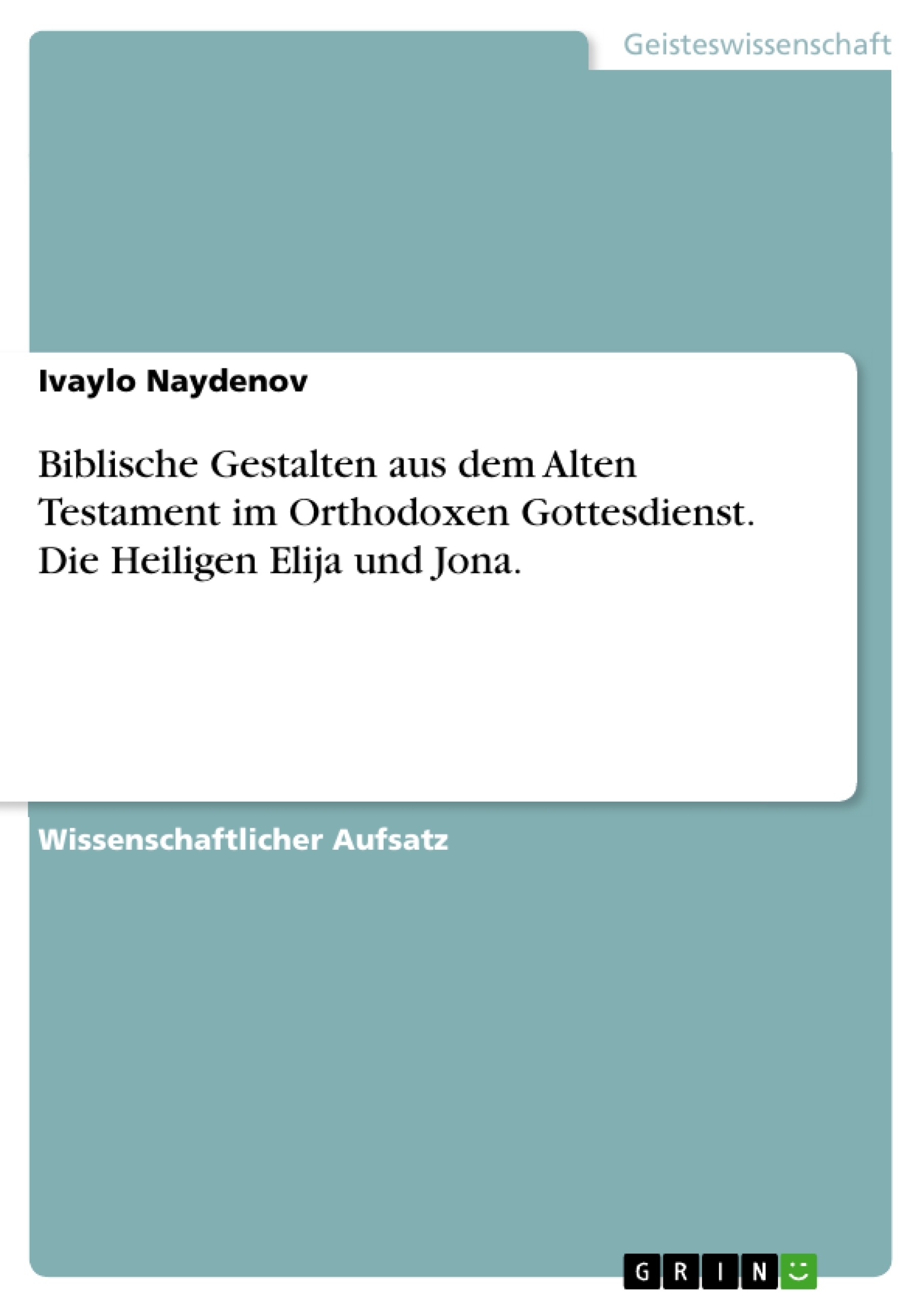Die Orthodoxe Kirche verehrt die Heiligen als Sieger über die Sünde, als Leute, die Tugend durch frommes Leben erlangt haben. Diese Ehre wird ausgedrückt durch: die Bestimmung eines speziellen Erinnerungstags für sie, durch Aufbau von Kirchen, die ihnen gewidmet sind, durch Verehrung ihrer heiligen Reliquien und die Abbildung ihrer Gestalten auf den heiligen Ikonen, in den Lobpreisungen ihres Lebens und Tugend durch die Hymnographie und durch das Erbitten ihrer Fürsprache für uns.
Erste bekannte Zeugnisse von einem Kult für einen Heiligen finden sich seit der Mitte des 2 Jh. n.Ch. Nach dem Tod des 86-jährigen Bischofs von Smyrna, Polykarp (23.02.156).
Zwei alttestamentlichen Gestalten sind besonders interessant in diesem Hinsicht – Jona und Elija. Die sind aber nur ein kleiner Teil der reichen hymnographischen Schatzkammer aus der klassischen byzantinischen Periode der Orthodoxie (orthodoxia byzantina), mit einigen Parallelen im gottesdienstlichen Schaffen der slavia orthodoxa.
Dieser kurze Einblick in die hymnologische Lobpreisung hat nicht den Anspruch, ausführlich zu sein, aber er belegt ein neues Herangehen an die christliche Hymnographie als eine eigene Art biblischer Exegese.
Inhaltsverzeichnis
- Die Heiligen Elija und Jona
- Erste bekannte Zeugnisse von einem Kult für einen Heiligen
- Feiertage, die einem Heiligen gewidmet werden
- Exkurs: Besonders interessant ist die Anordnung der Feiertage nach ihrer Wichtigkeit
- Viel einfacher ist es mit der Stellung des Propheten Jona im Gottesdienst
- Die Basis für die christliche Hymnographie bildet das poetische und lehrmäßige Material, das aus der Bibel entlehnt ist
- Exkurs: Oden, Kanon, Hirmos und Troparion
- Der Kanon (gr. Kavóv) ist die umfassendste, komplexeste und vollständigste polystrophische hymnographische Form in der byzantinischen und slawischen Hymnographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung und Verehrung biblischer Gestalten, insbesondere des Propheten Elija und des Propheten Jona, im orthodoxen Gottesdienst. Der Fokus liegt auf der Rolle, die diese Figuren in der Liturgie, der Hymnographie und den Feiertagskalendern der Orthodoxen Kirche spielen.
- Die Bedeutung der Heiligenverehrung in der Orthodoxie
- Die Einbindung biblischer Figuren in den christlichen Gottesdienst
- Die Entwicklung der Hymnographie und ihre Verbindung zur Bibel
- Die Bedeutung der Kanonform in der byzantinischen und slawischen Hymnographie
- Die Interpretation biblischer Texte und Ereignisse in der Liturgie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Heiligen Elija und Jona: Dieser Abschnitt stellt die beiden biblischen Figuren, Elija und Jona, vor und erläutert, wie die Orthodoxe Kirche sie als Heilige verehrt. Es werden die verschiedenen Formen der Verehrung, wie zum Beispiel Festtage, Ikonen und Hymnen, hervorgehoben.
- Erste bekannte Zeugnisse von einem Kult für einen Heiligen: Hier wird die Entwicklung des Heiligenkults in der frühen Kirche untersucht. Als Beispiel dient die Verehrung des Bischofs Polykarp von Smyrna.
- Feiertage, die einem Heiligen gewidmet werden: In diesem Abschnitt werden verschiedene Kategorien von Heiligen und ihren jeweiligen Festtagen vorgestellt. Die Entstehung und Entwicklung dieser Feiertage im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Christentums wird beleuchtet.
- Exkurs: Besonders interessant ist die Anordnung der Feiertage nach ihrer Wichtigkeit: Der Abschnitt analysiert die unterschiedliche Bedeutung von Heiligenfesten in der Orthodoxie. Die Rangfolge der Feiertage und ihre hierarchische Anordnung innerhalb des Kirchenjahres werden untersucht.
- Viel einfacher ist es mit der Stellung des Propheten Jona im Gottesdienst: Die Bedeutung des Propheten Jona in der Orthodoxie wird im Vergleich zu anderen Heiligen betrachtet. Der Abschnitt beleuchtet die Rolle der Propheten-Schriftsteller im Gottesdienst.
- Die Basis für die christliche Hymnographie bildet das poetische und lehrmäßige Material, das aus der Bibel entlehnt ist: Die Arbeit betrachtet die starke Verbindung zwischen der Hymnographie der Orthodoxen Kirche und der Bibel. Die Einflüsse biblischer Texte, Psalmen und Lieder auf die christliche Liturgie werden hervorgehoben.
- Exkurs: Oden, Kanon, Hirmos und Troparion: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über verschiedene Formen der Hymnographie und ihre Bedeutung im orthodoxen Gottesdienst. Die biblische Grundlage der Oden und die Entstehung des Kanons werden erklärt.
- Der Kanon (gr. Kavóv) ist die umfassendste, komplexeste und vollständigste polystrophische hymnographische Form in der byzantinischen und slawischen Hymnographie: Die Entstehung und Entwicklung der komplexen Kanonform werden detailliert dargestellt. Die Verbindung zur biblischen Poesie und die Funktion der Hirmoi und Troparien werden erklärt.
Schlüsselwörter
Heiligenverehrung, Orthodoxe Kirche, Elija, Jona, Hymnographie, Kanon, Bibel, Liturgie, Feiertage, Kirchenjahr, Psalmen, biblische Lieder, Propheten, Märtyrer, Kirchenkalender, Byzantinische Hymnographie, Hirmoi, Troparien.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Heilige in der orthodoxen Kirche verehrt?
Die Verehrung erfolgt durch spezielle Gedenktage, den Bau von Kirchen, die Verehrung von Reliquien, Ikonen sowie durch hymnographische Lobpreisungen.
Warum sind Elija und Jona im orthodoxen Gottesdienst besonders wichtig?
Sie werden als alttestamentliche Vorbilder und Sieger über die Sünde betrachtet, deren Leben und Tugenden in der christlichen Hymnographie als biblische Exegese dienen.
Was ist ein "Kanon" in der byzantinischen Hymnographie?
Ein Kanon ist eine komplexe, mehrstrophige hymnographische Form, die auf biblischen Oden basiert und im orthodoxen Gottesdienst eine zentrale Rolle spielt.
Welche biblischen Texte bilden die Basis für orthodoxe Hymnen?
Die Basis bilden Psalmen, biblische Lieder und prophetische Texte, die poetisch und lehrmäßig in die Liturgie integriert werden.
Seit wann gibt es Zeugnisse für den christlichen Heiligenkult?
Erste klare Zeugnisse finden sich ab der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr., beispielsweise nach dem Tod des Bischofs Polykarp von Smyrna.
- Quote paper
- Ass. Prof. Dr. Ivaylo Naydenov (Author), 2017, Biblische Gestalten aus dem Alten Testament im Orthodoxen Gottesdienst. Die Heiligen Elija und Jona., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379443