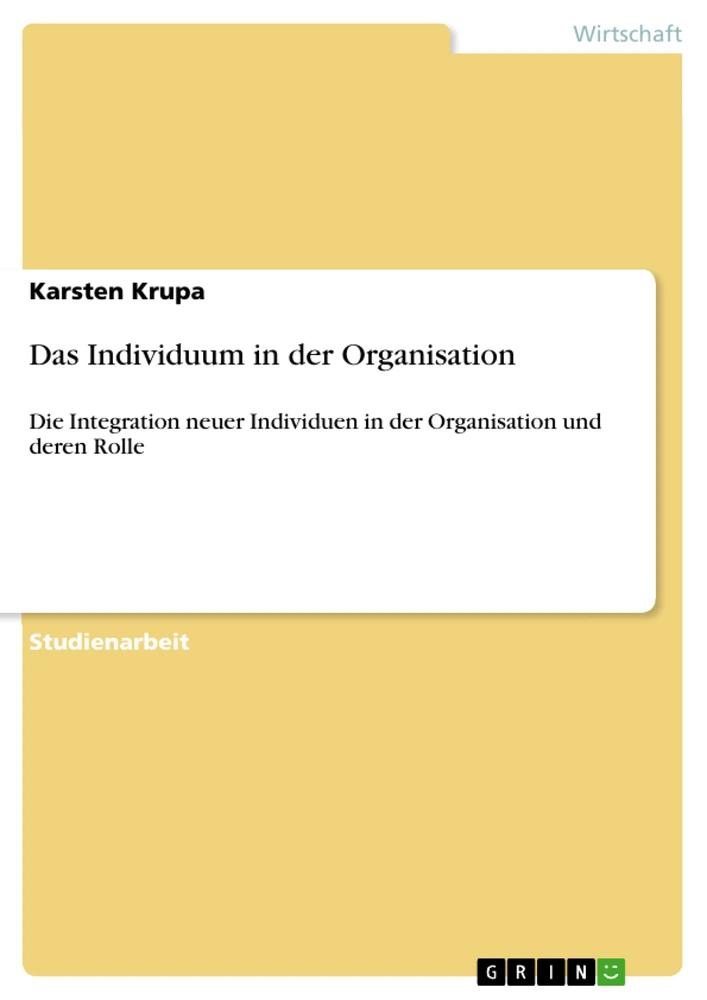Der kleinsten Einheit einer Organisation, dem Individuum, wurde früher eine größere Aufmerksamkeit gewidmet, aber in Zeiten des demografischen Wandels wird nicht mehr das einzelne Individuum betrachtet, sondern das Individuum als Gruppenmitglied. Es wird angenommen, dass die Überlegenheit der Gruppe soweit geht, dass Management in der Gruppe als Allheilmittel vieler Probleme gilt. Allerdings sind nicht immer alle Individuen gleicher Meinung, sie verfolgen eigene Ziele und Wünsche, diese Ungleichheiten werden deutlich, wenn Mitarbeiter ersetzt werden müssen. Da Organisationen aber verschiedene konstitutive Elemente verfügen, darunter ein „koordinatives Mitgliedssystem“, ist die Integration neuer Mitarbeiter ein wichtiger Punkt in Organisationen.
Eine Integration von nur einem Mitarbeiter ist aus verschiedenen Blickwinkeln als problematisch anzusehen. Ohne jede Priorisierung vorzunehmen ist z.B. darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der neu eingestellten Mitarbeiter bereits nach kurzer Zeit das Unternehmen bzw. die Organisation wieder verlässt. Organisationen sind Ressourcenpools oder korporative Akteure: Sie entstehen, wenn Individuen einen Teil ihrer Ressourcen einer zentralen Disposition unterstellen, die außerhalb ihrer selbst liegt, sie sind „soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen“, daraus lässt sich schließen, dass es schon bereits funktionierende soziale und hierarchische Strukturen in Organisationen gibt diese erschweren die Einbindung neuer Unbekannter erheblich. Quantitative Angaben bewegen sich bis zu einer Größenordnung von 40% aller neu eingestellten Mitarbeiter, die bereits in den ersten 12 Monaten aus der Organisation wieder ausscheiden. Aus diesen Informationen lässt sich feststellen, dass es für neue Mitarbeiter sehr schwierig ist sich zu integrieren, aber auch für Organisation schwierig ist sich auf neue Mitarbeiter einzulassen. Daraus stellt sich dem Betrachter die Frage nach dem Grund für dieses Ereignis, anders als den Unternehmen, denn es ist bekannt, dass Organisationen der Integration von neuen Mitarbeitern nur sehr wenig Bedeutung widmen. Dies liegt unter anderem an Sparmaßnahmen, aber auch daran, dass erst ein neuer Mitarbeiter arbeiten muss, um zu sehen, was verbessert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung in die Thematik
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Untersuchungsansätze
- 1.3 Rollentheorie nach Neuberger
- 2 Erwartungen als Auslöser von Rollenkonflikten
- 3 Theoretische Grundlagen der Integration
- 3.1 Individualbezug
- 3.2 Soziale Unterstützung
- 3.3 Organisationsbezug
- 3.4 Commitment
- 4 Kieser et al. Studie
- 5 Rehn Längsschnittstudie
- 6 Individuelle Anpassung
- 7 Elementarmaßnahmen
- 7.1 Konzept zur Integration nach Kieser
- 8 Integrationsprogramme in deutschen Organisationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Integration neuer Individuen in Organisationen und deren Rolle im Kontext des demografischen Wandels. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die mit der Einarbeitung neuer Mitarbeiter verbunden sind, und analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieses Prozesses. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Faktoren zu entwickeln, die die erfolgreiche Integration beeinflussen.
- Die Herausforderungen der Integration neuer Mitarbeiter in Organisationen
- Theoretische Grundlagen der Integration (Rollenkonflikte, Commitment, soziale Unterstützung)
- Empirische Studien zur Integration (Kieser et al., Rehn)
- Individuelle Anpassungsprozesse neuer Mitarbeiter
- Möglichkeiten zur Verbesserung von Integrationsprogrammen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung in die Thematik: Die Einleitung führt in die Thematik der Integration neuer Individuen in Organisationen ein. Sie stellt die Problemstellung heraus, dass ein Großteil der neu eingestellten Mitarbeiter frühzeitig das Unternehmen verlässt. Es wird auf die Bedeutung der Integration angesichts der bestehenden Organisationsstrukturen und Ressourcenpools hingewiesen. Die Einleitung skizziert die Untersuchungsansätze der Arbeit, die sich auf die Erkennung von Integrationsprozessen und die Klärung des Rollenbegriffs konzentrieren. Die Rollentheorie nach Neuberger wird als Grundlage eingeführt, wobei der Fokus auf asymmetrische Machtverhältnisse in den Beziehungen liegt.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Integration neuer Individuen in Organisationen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Integration neuer Mitarbeiter in Organisationen, insbesondere im Kontext des demografischen Wandels. Sie untersucht die Herausforderungen und Schwierigkeiten der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieses Prozesses. Ziel ist es, die Faktoren für eine erfolgreiche Integration besser zu verstehen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Herausforderungen der Integration neuer Mitarbeiter, theoretische Grundlagen der Integration (Rollenkonflikte, Commitment, soziale Unterstützung), empirische Studien zur Integration (Kieser et al., Rehn), individuelle Anpassungsprozesse und Möglichkeiten zur Verbesserung von Integrationsprogrammen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Seminararbeit stützt sich auf die Rollentheorie nach Neuberger, wobei asymmetrische Machtverhältnisse in den Beziehungen im Fokus stehen. Zusätzlich werden theoretische Grundlagen der Integration wie Rollenkonflikte, Commitment und soziale Unterstützung behandelt.
Welche empirischen Studien werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Studien von Kieser et al. und Rehn, wobei die Studie von Rehn als Längsschnittstudie angelegt ist.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemstellung, Untersuchungsansätze, Rollentheorie nach Neuberger), Erwartungen als Auslöser von Rollenkonflikten, Theoretische Grundlagen der Integration (Individualbezug, Soziale Unterstützung, Organisationsbezug, Commitment), die Kieser et al. Studie, die Rehn Längsschnittstudie, Individuelle Anpassung, Elementarmaßnahmen (inkl. Integrationskonzept nach Kieser) und Integrationsprogramme in deutschen Organisationen.
Was ist die zentrale Problemstellung der Arbeit?
Die zentrale Problemstellung ist die hohe Fluktuation von neu eingestellten Mitarbeitern und die damit verbundene Notwendigkeit, Integrationsprozesse in Organisationen zu verbessern.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen sind im bereitgestellten Auszug nicht explizit genannt. Die Arbeit zielt jedoch darauf ab, ein besseres Verständnis für die Faktoren zu entwickeln, die die erfolgreiche Integration beeinflussen, und Möglichkeiten zur Verbesserung von Integrationsprogrammen aufzuzeigen.
- Quote paper
- Karsten Krupa (Author), 2015, Das Individuum in der Organisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379547