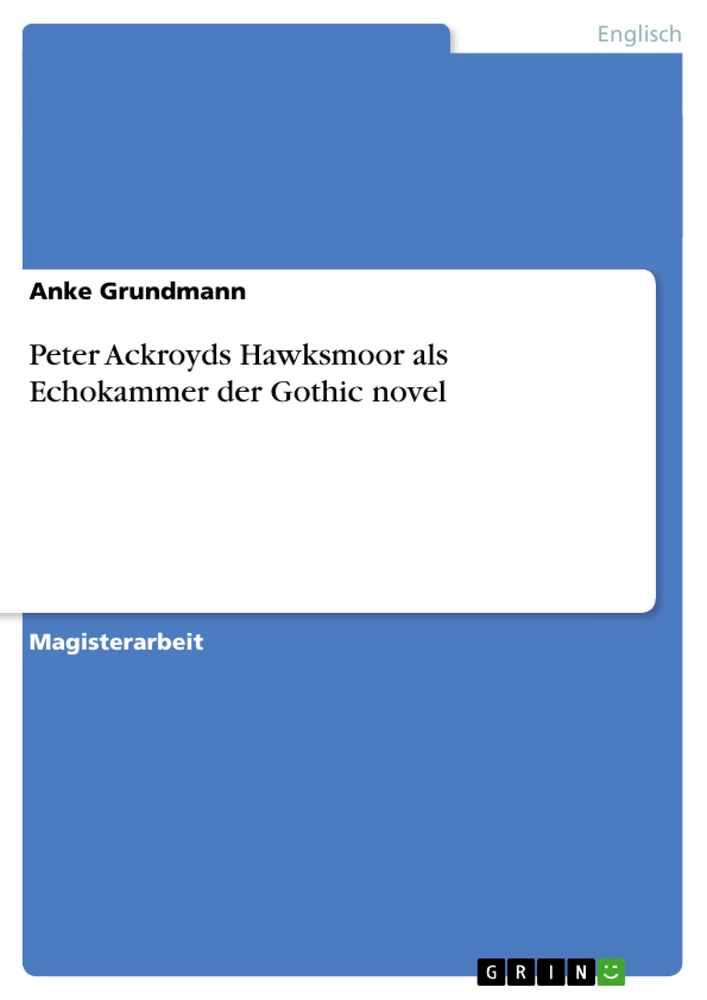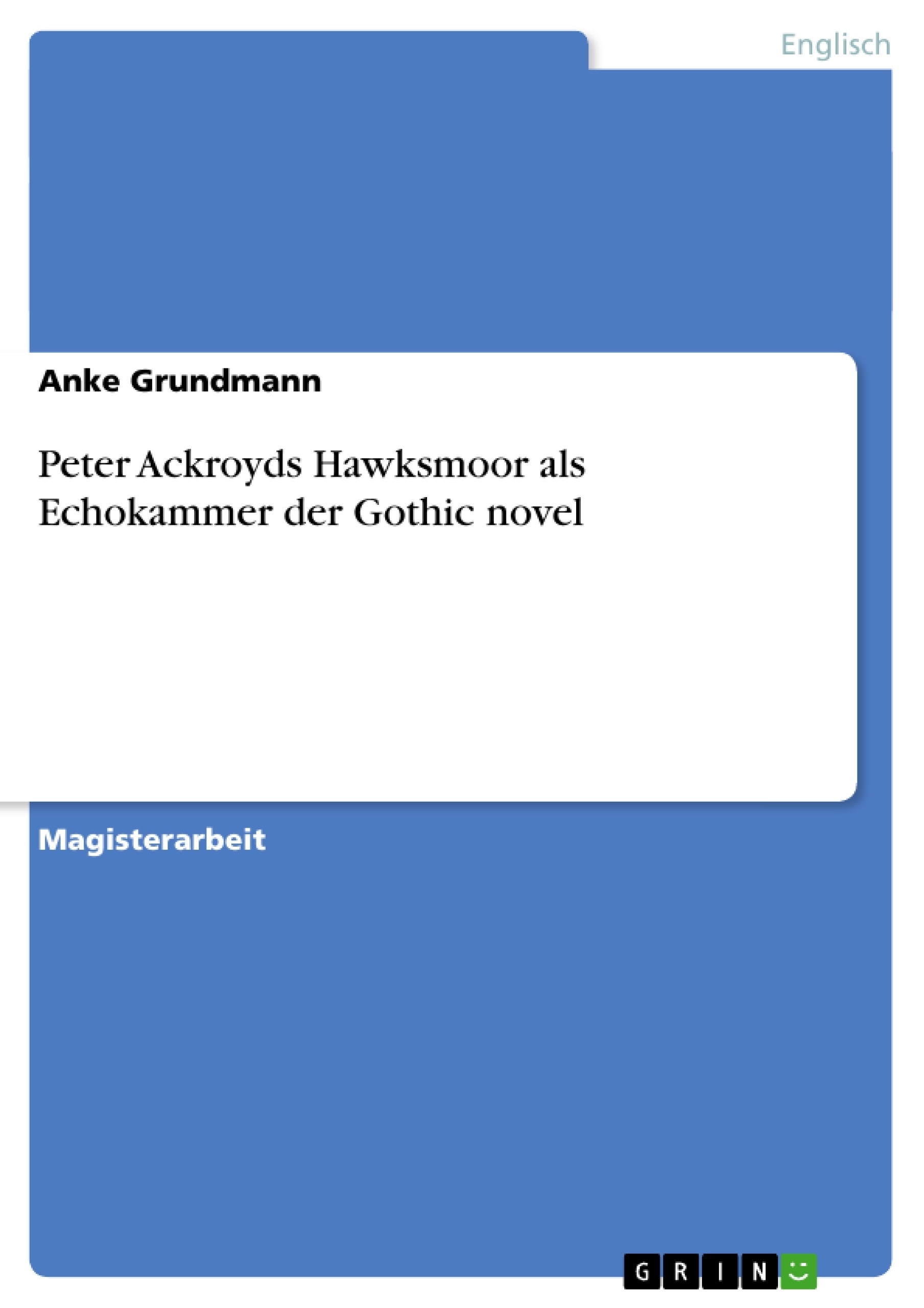Unter dem Einfluß postmoderner Theorien und Konzepte hat sich in der englischsprachigen Gegenwartsliteratur eine Richtung entwickelt, die traditionelle literarische Gattungen und Themen aufgreift und dabei trotzdem auf eine innovative Weise mit den konventionellen Mustern und Formen von Literatur spielt. Besonders deutlich wird diese Kombination von tradierten und experimentellen Elementen in den Texten, die sich im weitesten Sinne mit Geschichte bzw. der Darstellung historischer Ereignisse beschäftigen. Ein Vertreter dieser Richtung ist der 1949 in London geborene Autor und Literaturkritiker Peter Ackroyd. Der Großteil seiner Werke zeichnet sich durch eine Gemeinsamkeit aus: Romane wie The Great Fire of London (1982), The Last Testament of Oscar Wilde (1983), Hawksmoor (1985), Chatterton (1987), First Light (1989), English Music (1992) und Dan Leno and the Limehouse Golem (1994) spielen in vergangenen Epochen oder stellen einen intertextuellen Bezug dazu her. Die Bandbreite der dafür gewählten literarischen Genres reicht von der fiktiven Autobiographie über den Detektivroman, den Künstlerroman, den historischen Roman bis hin zur Gothic novel.
Die konventionelle Gothic novel, für die sich im deutschen Sprachgebrauch die Bezeichnung Schauerroman etabliert hat, wird im allgemeinen auf den Zeitraum von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis etwa 1820 datiert. Diese recht exakte zeitliche Festlegung läßt vermuten, daß es sich bei diesem Genre um eine literarische Strömung handelt, deren Entstehung und Ende von epochenspezifischen Bedingungen abhängig waren. Die Gothic novel scheint somit eine Gattung zu sein, die nur im Kontext des Dualismus von Absolutismus und Aufklärung existieren konnte und deren Ende durch die Rationalisierung und Mechanisierung im 19. Jahrhundert bedingt war.
Der Blick auf die zeitgenössische, vor allem postmoderne Literatur zeigt jedoch, daß die im Schauerroman verwendeten Elemente und Motive keineswegs überkommen sind, sondern auch in der Gegenwartsliteratur immer noch den Effekt erzeugen, der für die Gothic novel charakteristisch ist: wohligen Schauer beim Leser hervorzurufen. Auf welche Weise diese Elemente und Motive in Peter Ackroyds Roman Hawksmoor verwendet werden, inwiefern sie eine den Theorien der Postmoderne folgende Modifikation erfahren und welche Wirkungen sie beim Rezipienten erzielen, soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elemente der Gothic novel
- Der Gothic villain
- Dyer und sein reales Pendant Nicholas Hawksmoor
- Der Erzähler Dyer
- Der Satanist Dyer
- Dyer als mittelalterlicher Schurke
- Dyer als „ewiger Wanderer”
- Die Verfolgungsstruktur
- Der Handlungs- und Erlebnisraum: die Kirchen
- Die Kirchen als Metapher des Todes
- Die Kirchen als Sinnbild des Schurken
- Die Kirchen als Mittel der postmodernen Selbstreflexion
- Die Kirchen als zeitliche Konstanten
- Der Gothic villain
- Das Geschichtskonzept
- Geschichte als Kreislauf
- Das zirkuläre Zeitkonzept als Element des magischen Weltbilds
- Subjektive vs. objektive Geschichte
- Angst und Schrecken
- Angst und Schrecken im konventionellen Schauerroman
- Angst und Schrecken in Hawksmoor
- Angst und Schrecken durch Verunsicherung
- Innerer Schrecken vs. äußerer Schrecken
- Die Verunsicherung des Lesers
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Roman „Hawksmoor“ von Peter Ackroyd und analysiert, wie der Autor Elemente der Gothic novel verwendet, diese im Kontext postmoderner Theorien modifiziert und welche Wirkungen sie beim Rezipienten erzielen. Die Arbeit fokussiert auf die genretypischen Elemente und Motive der Gothic novel, um diese als Folie für die Analyse des Romans zu nutzen. Darüber hinaus wird das dem Roman zugrundeliegende Geschichtskonzept beleuchtet, um den Einfluss postmoderner Theorien auf das Verhältnis von Fiktionalität, Realität und Geschichte aufzuzeigen.
- Die Verwendung von Elementen der Gothic novel in Ackroyds „Hawksmoor“
- Die Modifikation dieser Elemente im Kontext postmoderner Theorien
- Die Wirkungen der Elemente und Motive auf den Rezipienten
- Das Geschichtskonzept in „Hawksmoor“ und sein Verhältnis zu Fiktionalität, Realität und Geschichte
- Die Rolle von Intertextualität und Metafiktion in der Schaffung einer „Echokammer“ der englischen Kulturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Entstehung der Gothic novel und deren zeitgenössische Relevanz im Kontext postmoderner Literatur beleuchtet.
Das zweite Kapitel analysiert die genretypischen Elemente der Gothic novel, insbesondere die Figur des „Gothic villain“ im Roman. Es werden die verschiedenen Facetten von Dyer, dem Protagonisten des Romans, und seine Beziehung zu dem realen Architekten Nicholas Hawksmoor untersucht. Das Kapitel beleuchtet auch die Verfolgungsstruktur in „Hawksmoor“ und die symbolische Bedeutung der Kirchen im Roman.
Das dritte Kapitel untersucht das Geschichtskonzept in „Hawksmoor“, das auf einem zirkulären Zeitverständnis basiert, das an magische Weltbilder anknüpft. Es werden die Unterschiede zwischen subjektiver und objektiver Geschichte in Bezug auf den Roman beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Thema „Angst und Schrecken“ in „Hawksmoor“. Es werden sowohl die traditionellen Elemente des Schauerromans als auch die spezifischen Mechanismen der Angst und Verunsicherung in Ackroyds Roman beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Gothic novel, dem „Gothic villain“, dem Konzept der Intertextualität und Metafiktion, dem Geschichtskonzept und der Zeitlichkeit in „Hawksmoor“. Darüber hinaus werden die Themen Angst, Schrecken und Verunsicherung im Kontext des Romans beleuchtet. Die Arbeit analysiert die literarischen Techniken von Peter Ackroyd und seinen Umgang mit traditionellen Genreregeln und postmodernem Denken.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Peter Ackroyds Roman „Hawksmoor“?
Der Roman verknüpft die Geschichte eines barocken Architekten mit einem modernen Detektivroman und nutzt dabei Elemente der Gothic Novel (Schauerroman), um Themen wie Geschichte, Zeit und Okkultismus zu behandeln.
Wer ist der „Gothic Villain“ in dem Roman?
Die Figur Nicholas Dyer (basierend auf dem realen Nicholas Hawksmoor) fungiert als der klassische Schurke des Schauerromans – ein Satanist und „ewiger Wanderer“, der durch seine Taten Schrecken verbreitet.
Welche Bedeutung haben die Kirchen in „Hawksmoor“?
Die Kirchen dienen als Metaphern des Todes, Sinnbilder des Schurken und als zeitliche Konstanten, die die verschiedenen Epochen des Romans miteinander verbinden.
Wie wird das Konzept der Zeit im Roman dargestellt?
Ackroyd nutzt ein zirkuläres Zeitkonzept, das an magische Weltbilder anknüpft. Geschichte wird nicht linear, sondern als Kreislauf dargestellt, in dem sich Ereignisse wiederholen.
Was macht „Hawksmoor“ zu einem postmodernen Roman?
Der Einsatz von Intertextualität, Metafiktion und die bewusste Modifikation traditioneller Genreregeln kennzeichnen das Werk als postmodernes Spiel mit der Literaturgeschichte.
Wie erzeugt der Autor Angst und Schrecken beim Leser?
Neben klassischen Schauerelementen nutzt Ackroyd die Verunsicherung des Lesers durch die Verwischung von Realität und Fiktion sowie den Kontrast zwischen innerem und äußerem Schrecken.
- Citar trabajo
- M.A. Anke Grundmann (Autor), 2002, Peter Ackroyds Hawksmoor als Echokammer der Gothic novel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38025