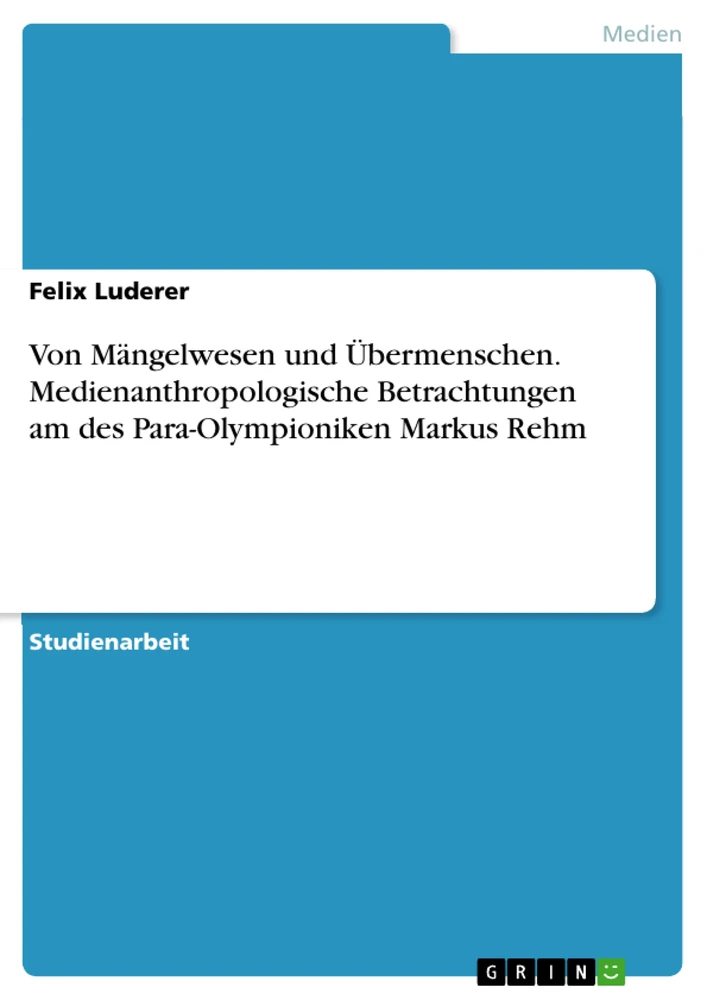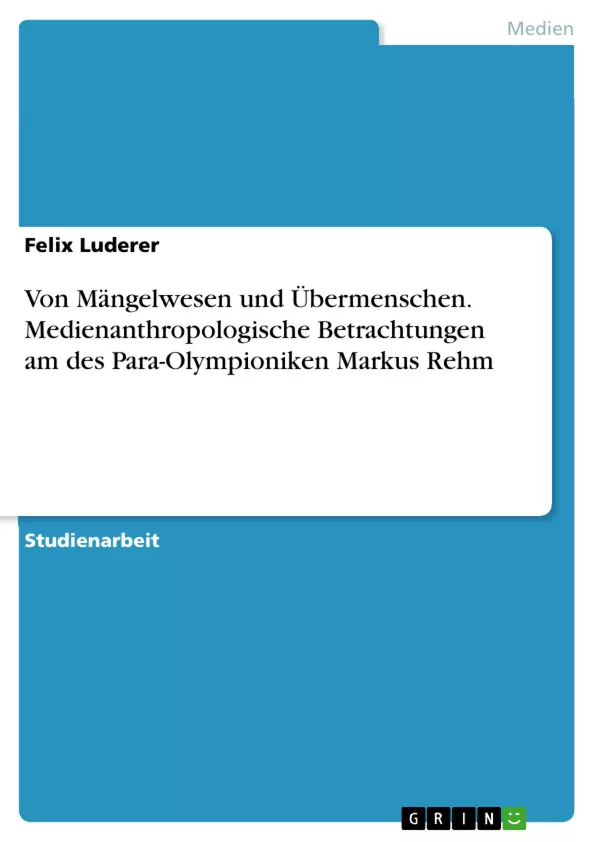Markus Rehm ist Weitspringer und Kurzstreckenläufer. Seit einem Unfall in seiner Jugend, als ihm ein Bootmotor im August 2003 den Unterschenkel zerriss, trägt er am rechten Bein eine Unterschenkelprothese. Dennoch war es ihm nicht vergönnt, im Jahr 2014 an den Deutschen Leitathletik-Meisterschaften der nichtbehinderten Sportler teilzunehmen, die er prompt gewann.
Spätestens mit diesem Erfolg begann jedoch die Kontroverse um seine Leistung. Zu einer Titelverteidigung im Jahr darauf durfte er zwar teilnehmen, eine Einbeziehung in die offizielle Wertung wurde ihm aber aus Gründen der Unvergleichbarkeit der sportlichen Leistung gegenüber unversehrten Sportlern verweigert. Nicht zuletzt seit dieser Kontroverse befindet sich die internationale Sportwelt in einem Dilemma. Andere Sportarten leben sozusagen von dem technischen Fortschritt, der ein Teil des Wettkampfs ist. Im Radsport, beim Schwimmen oder im Skisport – um nur einige zu nennen – gehört ein perfekt präpariertes Material zum sportlichen Erfolg dazu. Im Rennsport ist die Ingenieursleistung und die technische Verbesserung untrennbar mit dem sportlichen Erfolg des Autorennfahrers verknüpft.
Es stellt sich daher die Frage, wo technische Unterstützung im Sport als solche anfängt und wie die Vergleichbarkeit im sportlichen Wettkampf gewährleistet bleibt. Dieser Frage versucht die Hausarbeit aus medienanthropologischer Sicht nachzugehen. Die Analyse des Menschen als mangelhaftes Wesen ist vermutlich so alt wie die Philosophie selbst. Es versucht werden, einige zentrale Theorien insofern anzureißen, wie es der Argumentationsstruktur der Arbeit dienlich erscheint.
Diese Arbeit versucht auch keine Antwort auf die sportethische Diskussion um Fairness und Inklusion zu geben – nicht zuletzt, weil ein eindeutiger Vor- oder Nachteil der Prothesen wissenschaftlich nicht erwiesen werden kann. Stattdessen soll der Mensch – am Beispiel von Markus Rehm und Oscar Pistorius der Sportler – in den (historisch gewachsenen) Kontext des technisch durchdrungenen Menschen im Rahmen einer prothetischen Medienanthropologie gestellt werden. Die Fragestellung kreist also darum, wie sehr der Mensch technisch verfasst ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kampf um Olympia: ethische Debatte um Fairness und Inklusion im Sport
- Eine kurze Geschichte der Prothetik
- Vom Mängelwesen zum Übermenschen.....
- Der Mensch als (un)vollkommenes Wesen
- Der Übermensch bei Nietzsche
- Der Prothesengott bei Freud..
- Der halbe Mensch bei Plessner
- Das Mängelwesen bei Gehlen
- Die Übung an sich selbst – Anthropotechniken bei Peter Sloterdijk..
- Die Technizität des Sports..
- Der behinderte Sportler als Übermensch und Mängelwesen.
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die medienanthropologische Relevanz der Debatte um die Teilnahme von Sportlern mit Prothesen an Wettkämpfen. Sie beleuchtet die Frage, wie sich der Einsatz technischer Hilfsmittel im Sport auf das Verständnis des Menschen als Naturwesen und Kulturwesen auswirkt.
- Die ethische Debatte um Fairness und Inklusion im Sport im Kontext von Prothesen.
- Die historische Entwicklung des Menschenbildes als Mängelwesen und seine Beziehung zur Technik.
- Die medienanthropologische Betrachtung der Prothese als Ausdruck der menschlichen Natur und Künstlichkeit.
- Die Rolle von Anthropotechniken und die Frage der Verbesserung des Menschen durch technologische Mittel.
- Der Fall Markus Rehm und die Frage nach der Vergleichbarkeit der Leistungen von behinderten und nichtbehinderten Sportlern.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Debatte um die Teilnahme von Sportlern mit Prothesen am Beispiel von Markus Rehm und stellt die medienanthropologische Relevanz des Themas dar.
- Der Kampf um Olympia: Die Debatte um Fairness und Inklusion im Sport wird im Kontext der Paralympischen Spiele und den Fällen von Oscar Pistorius und Markus Rehm beleuchtet. Der Konflikt zwischen dem Einsatz technischer Hilfsmittel und dem Fairnessgedanken im Sport wird thematisiert.
- Eine kurze Geschichte der Prothetik: Die Geschichte der Prothetik wird kurz skizziert und die Entwicklung von technischen Hilfsmitteln im Hinblick auf die menschliche Natur und Künstlichkeit erläutert.
- Vom Mängelwesen zum Übermenschen: Verschiedene Denker wie Nietzsche, Freud, Plessner und Gehlen werden vorgestellt und ihre Konzepte von Mensch, Mängelwesen, Übermensch und Prothesengott diskutiert. Diese Konzepte bilden den theoretischen Rahmen für die weitere Betrachtung des Themas.
- Die Übung an sich selbst – Anthropotechniken bei Peter Sloterdijk: Die Arbeit stellt das Konzept von Anthropotechniken nach Peter Sloterdijk vor und untersucht, wie der Mensch sich selbst durch Technik formt und verbessert.
- Die Technizität des Sports: Die Arbeit beleuchtet die zunehmende Vertechnisierung des Sports und die Frage, wie sich die technische Unterstützung auf die Vergleichbarkeit der Leistungen auswirkt.
- Der behinderte Sportler als Übermensch und Mängelwesen: Die Arbeit diskutiert den ambivalenten Blick auf behinderte Sportler als Übermenschen und Mängelwesen und stellt die Frage nach dem Verhältnis von Natur und Kultur in diesem Zusammenhang.
Schlüsselwörter
Prothetik, Medienanthropologie, Fairness, Inklusion, Behinderung, Sport, Übermensch, Mängelwesen, Anthropotechniken, Technik, Kultur, Natur, Disability Studies, Oscar Pistorius, Markus Rehm, Paralympische Spiele,
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Markus Rehm?
Markus Rehm ist ein Para-Olympionike (Weitspringer), dessen Teilnahme an Meisterschaften für nichtbehinderte Sportler eine Debatte über technische Vorteile auslöste.
Was untersucht die prothetische Medienanthropologie?
Sie untersucht, wie sehr der Mensch technisch verfasst ist und wie Prothesen das Verständnis von Natur und Künstlichkeit verändern.
Was bedeutet der Begriff "Mängelwesen" bei Gehlen?
Der Mensch wird als biologisch unvollkommenes Wesen gesehen, das seine Mängel durch Technik und Kultur kompensieren muss.
Warum ist die Vergleichbarkeit im Sport umstritten?
Es ist wissenschaftlich schwer zu beweisen, ob moderne Prothesen einen mechanischen Vor- oder Nachteil gegenüber biologischen Beinen bieten.
Was sind "Anthropotechniken" nach Sloterdijk?
Es sind Techniken, durch die der Mensch sich selbst formt, übt und technologisch verbessert.
- Quote paper
- Felix Luderer (Author), 2016, Von Mängelwesen und Übermenschen. Medienanthropologische Betrachtungen am des Para-Olympioniken Markus Rehm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380329