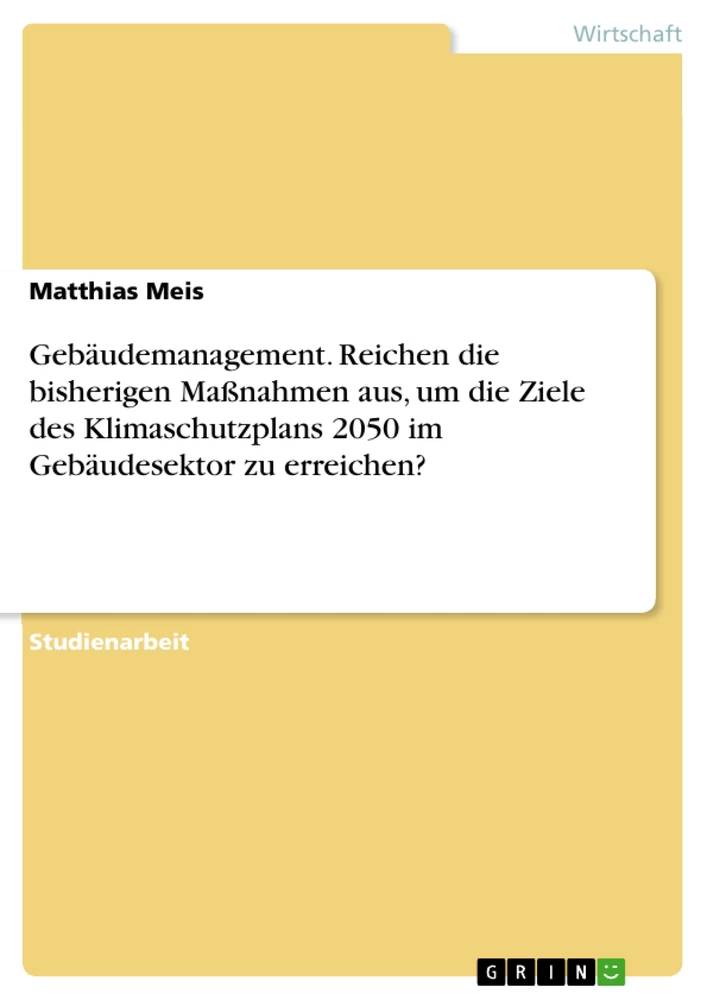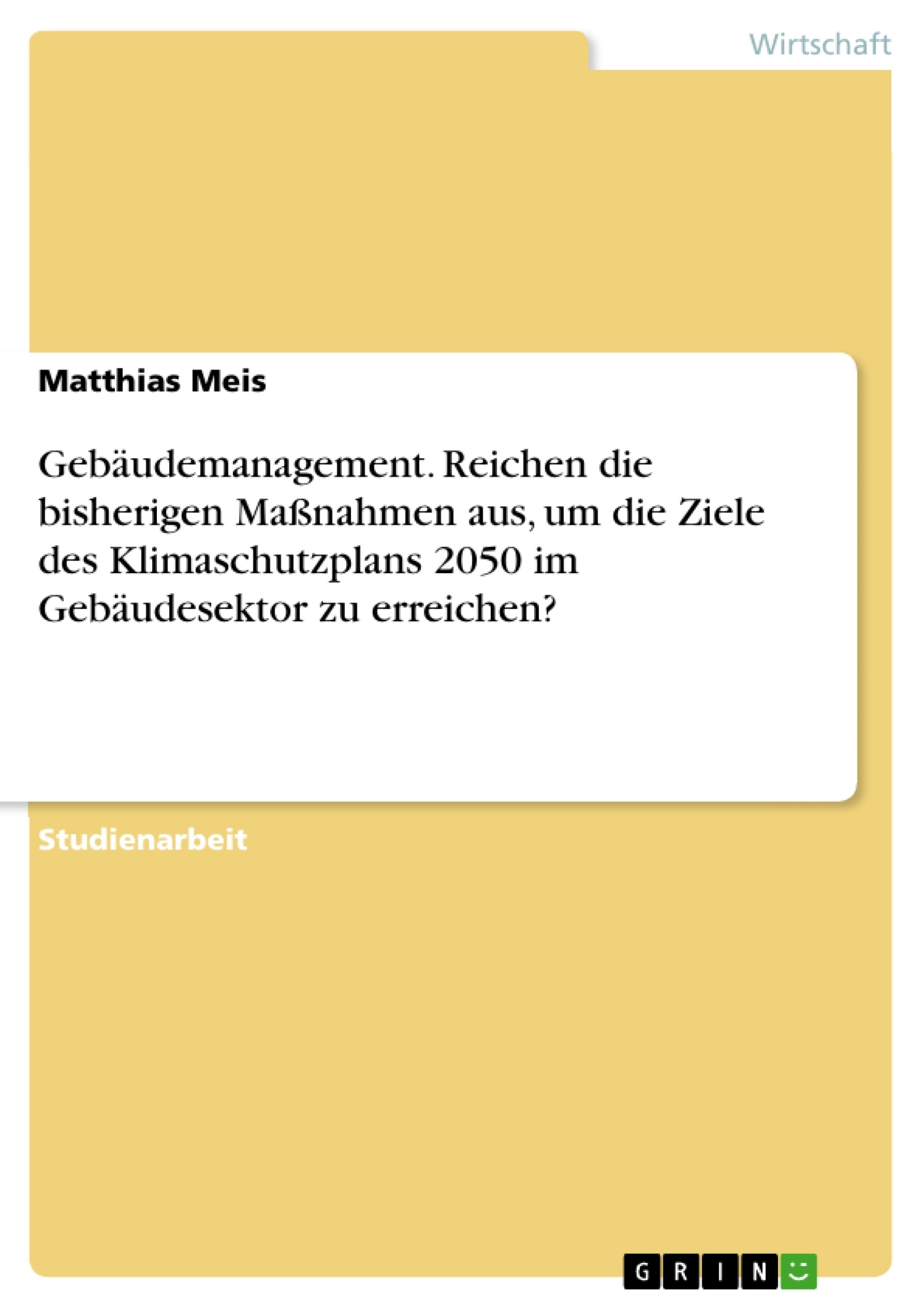Da der Gebäudebereich für circa 35 % des Endenergieverbrauchs und etwa 30 % der CO2-Emissionen verantwortlich ist, wird auf ihn ein besonderes Augenmerk gelegt. Durch ein Zusammenspiel aus Energieeinsparungen und erneuerbaren Energien soll der deutsche Gebäudebestand bis 2050 nahezu klimaneutral gestaltet werden, was konkret bedeutet, dass der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf bis 2050 um mindestens 80 % gegenüber dem Jahr 2008 gesenkt werden soll.
Jedoch zeigt sich das Problem, dass zahlreiche Bau- und Dämmmaterialien aus nicht erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden und dadurch eine extrem schlechte CO2-Bilanz besitzen. Beispielsweise im Bereich der Dämmstoffe besitzen erdölbasierte Stoffe einen Marktanteil von über 40 %.
Ob für die Erreichung der genannten Ziele die bisherigen Maßnahmen des Gebäudemanagements zielführend sind, soll in dieser Hausarbeit beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gegenwärtiger Zustand des deutschen Gebäudebestandes
- 2.1 Anteil der Gebäude am Endenergieverbrauch
- 2.2 Heizungsarten und Energieträger in Deutschland
- 3. Fördermaßnahmen der Bundesregierung
- 3.1 Für Wohngebäude
- 3.2 Für kommunale und soziale Einrichtungen
- 3.3 Für gewerbliche Gebäude
- 4. Umweltauswirkungen häufig verwendeter konventioneller Baustoffe
- 4.1 Beton
- 4.2 Baustoffe auf petrochemischer Basis
- 4.3 Mineralwolle
- 5. Recyclingpotenzial im Bauwesen
- 6. Bauen mit nachwachsenden Baustoffen
- 6.1 Cellulose
- 6.2 Weichholzfaserplatten
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit die derzeitigen Maßnahmen im Gebäudemanagement ausreichen, um die Klimaziele des Klimaschutzplans 2050 im Gebäudesektor zu erreichen. Der Fokus liegt auf der Analyse des deutschen Gebäudebestands, der bestehenden Förderprogramme und der Umweltauswirkungen verschiedener Baustoffe.
- Anteil des Gebäudebereichs am Energieverbrauch und CO2-Emissionen
- Bewertung der Effektivität der staatlichen Förderprogramme für energetische Sanierungen
- Umweltbelastung durch konventionelle Baustoffe
- Potenziale von Recycling und nachwachsenden Rohstoffen im Bauwesen
- Analyse der Diskrepanz zwischen den Klimazielen und dem aktuellen Stand der Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Klimaschutzplans 2050 und dessen Relevanz für den Gebäudesektor ein. Sie hebt den hohen Anteil des Gebäudebestands am Energieverbrauch und den CO2-Emissionen hervor und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Effektivität der bisherigen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele. Die Einbettung in die Ziele der Vereinten Nationen (SDG 11) unterstreicht die globale Bedeutung der Thematik.
2. Gegenwärtiger Zustand des deutschen Gebäudebestandes: Dieses Kapitel beschreibt den aktuellen Zustand des deutschen Gebäudebestands, bestehend aus Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Es analysiert den Anteil der Gebäude am Energieverbrauch und beleuchtet die verschiedenen Heizungsarten und Energieträger. Ein wichtiger Punkt ist die Herausforderung der energetischen Sanierung, insbesondere im Hinblick auf denkmalgeschützte Gebäude und die geringe Sanierungsrate, die im Vergleich zu den Klimazielen als unzureichend dargestellt wird.
3. Fördermaßnahmen der Bundesregierung: Das Kapitel analysiert die Förderprogramme der Bundesregierung für energetische Sanierungen im Gebäudebereich, unterteilt in Programme für Wohngebäude, kommunale und soziale Einrichtungen sowie gewerbliche Gebäude. Es beleuchtet die verschiedenen Fördermöglichkeiten und evaluiert deren Wirksamkeit bei der Erreichung der Klimaziele. Der Fokus liegt auf den Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
4. Umweltauswirkungen häufig verwendeter konventioneller Baustoffe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Umweltbelastung, die durch die Verwendung gängiger Baustoffe wie Beton, petrochemische Produkte und Mineralwolle entsteht. Es werden die negativen Auswirkungen auf die CO2-Bilanz und die Umwelt ausführlich diskutiert. Der hohe Anteil erdölbasierter Dämmstoffe wird als besonders problematisch hervorgehoben.
5. Recyclingpotenzial im Bauwesen: Das Kapitel erörtert das Potenzial des Recyclings im Bauwesen als Maßnahme zur Reduktion der Umweltbelastung und zur Schonung von Ressourcen. Es analysiert die Möglichkeiten der Wiederverwendung und des Recyclings von Baustoffen und bewertet den Beitrag dieser Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele.
6. Bauen mit nachwachsenden Baustoffen: Hier werden die Möglichkeiten des Bauens mit nachwachsenden Rohstoffen wie Cellulose und Weichholzfaserplatten vorgestellt. Es werden die Vorteile dieser Materialien im Hinblick auf ihre Umweltbilanz und ihr Potenzial zur Erreichung der Klimaziele diskutiert. Die Kapitel beleuchtet die ökologischen und ökonomischen Aspekte dieser nachhaltigen Bauweise.
Schlüsselwörter
Klimaschutzplan 2050, Gebäudebestand, Energieeffizienz, Energetische Sanierung, Förderprogramme, nachwachsende Baustoffe, CO2-Emissionen, Recycling, Umweltbelastung, Klimaneutralität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des deutschen Gebäudebestands im Hinblick auf den Klimaschutzplan 2050
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert, inwieweit die derzeitigen Maßnahmen im Gebäudemanagement ausreichen, um die Klimaziele des Klimaschutzplans 2050 im Gebäudesektor zu erreichen. Der Fokus liegt auf dem deutschen Gebäudebestand, bestehenden Förderprogrammen und den Umweltauswirkungen verschiedener Baustoffe.
Welche Aspekte des deutschen Gebäudebestands werden untersucht?
Die Analyse umfasst den Anteil der Gebäude am Energieverbrauch und den CO2-Emissionen, die verschiedenen Heizungsarten und Energieträger, sowie die Herausforderungen der energetischen Sanierung, insbesondere im Hinblick auf denkmalgeschützte Gebäude und die Sanierungsrate.
Welche Fördermaßnahmen der Bundesregierung werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht Förderprogramme für Wohngebäude, kommunale und soziale Einrichtungen sowie gewerbliche Gebäude. Es wird deren Wirksamkeit bei der Erreichung der Klimaziele und die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bewertet.
Welche Umweltauswirkungen konventioneller Baustoffe werden beleuchtet?
Die negative Umweltbelastung durch Beton, petrochemische Produkte und Mineralwolle wird hinsichtlich der CO2-Bilanz und der Umwelt ausführlich diskutiert, wobei der hohe Anteil erdölbasierter Dämmstoffe besonders hervorgehoben wird.
Welches Recyclingpotenzial im Bauwesen wird untersucht?
Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten der Wiederverwendung und des Recyclings von Baustoffen und bewertet deren Beitrag zur Reduktion der Umweltbelastung und zur Erreichung der Klimaziele.
Welche nachwachsenden Baustoffe werden betrachtet?
Die Möglichkeiten des Bauens mit Cellulose und Weichholzfaserplatten werden vorgestellt. Die ökologischen und ökonomischen Aspekte dieser nachhaltigen Bauweise im Hinblick auf die Umweltbilanz und das Erreichen der Klimaziele werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Klimaschutzplan 2050, Gebäudebestand, Energieeffizienz, Energetische Sanierung, Förderprogramme, nachwachsende Baustoffe, CO2-Emissionen, Recycling, Umweltbelastung, Klimaneutralität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum gegenwärtigen Zustand des deutschen Gebäudebestands, zu Fördermaßnahmen der Bundesregierung, zu Umweltauswirkungen konventioneller Baustoffe, zum Recyclingpotenzial im Bauwesen, zum Bauen mit nachwachsenden Baustoffen und ein Fazit. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Welche Ziele werden mit dieser Arbeit verfolgt?
Die Arbeit untersucht die Effektivität der staatlichen Förderprogramme für energetische Sanierungen, die Umweltbelastung durch konventionelle Baustoffe, das Potenzial von Recycling und nachwachsenden Rohstoffen und die Diskrepanz zwischen den Klimazielen und dem aktuellen Stand der Maßnahmen. Die Einbettung in die Ziele der Vereinten Nationen (SDG 11) unterstreicht die globale Bedeutung der Thematik.
- Citar trabajo
- Matthias Meis (Autor), 2017, Gebäudemanagement. Reichen die bisherigen Maßnahmen aus, um die Ziele des Klimaschutzplans 2050 im Gebäudesektor zu erreichen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380382