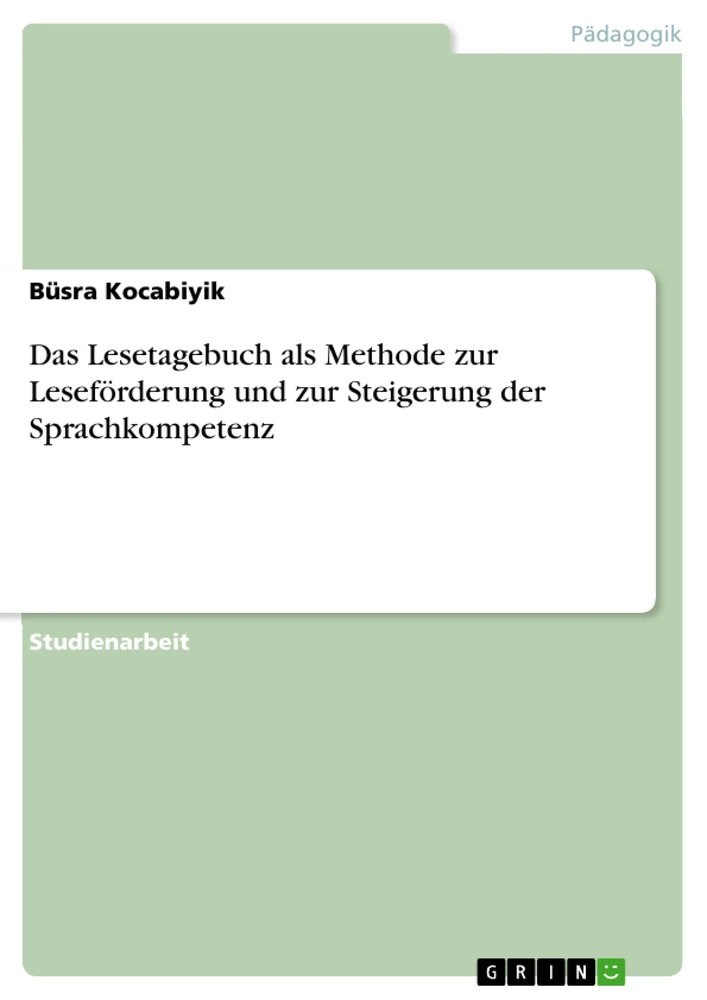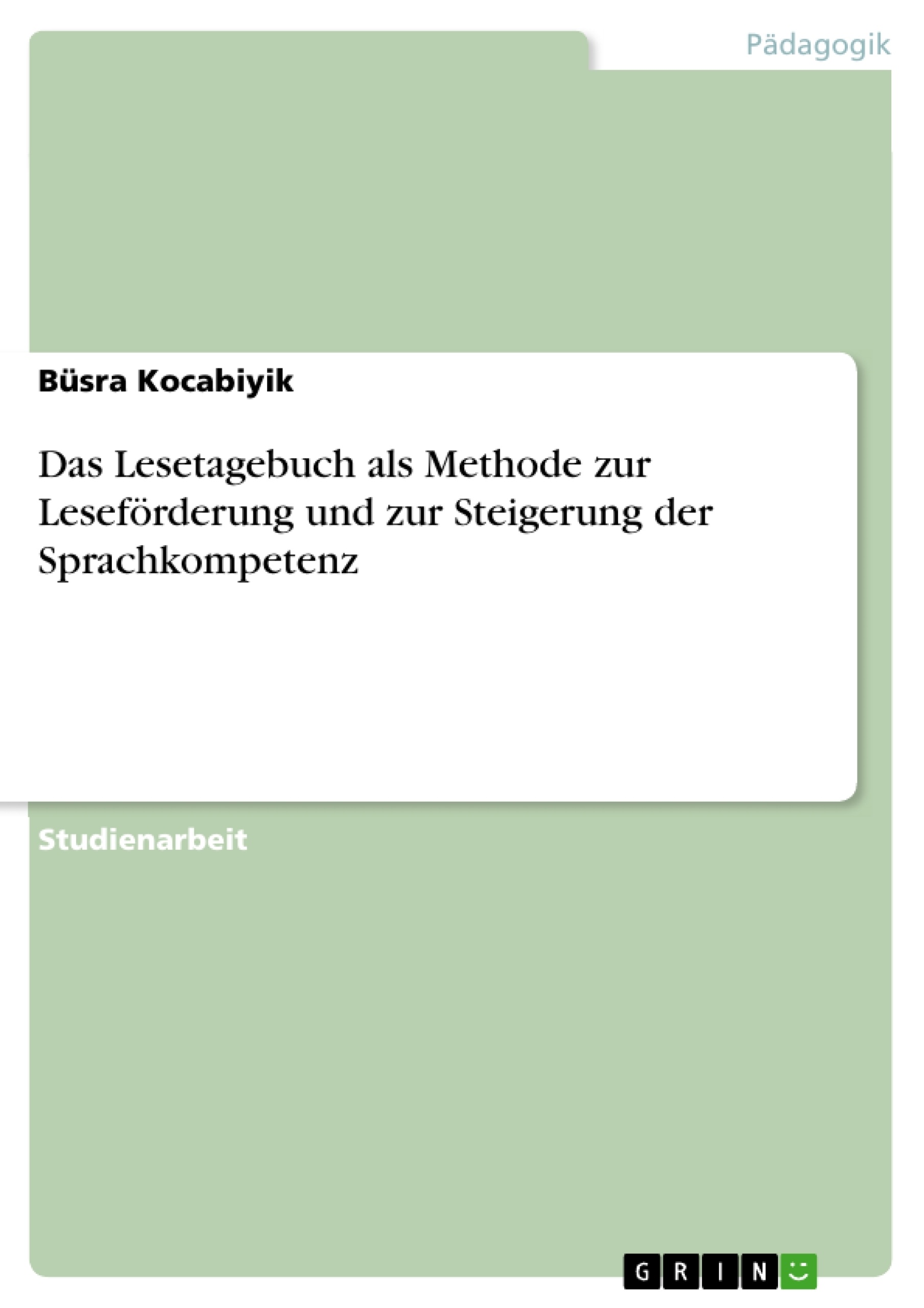Lesen ist tatsächlich ein komplexer Vorgang, der Leistungen auf ganz verschiedenen Ebenen verlangt. Wer den Herausforderungen gewachsen ist, die sich angesichts der Textvielfalt stellen, hat nicht nur Zugang zu Informationen und vielerlei Möglichkeiten der Kommunikation, sondern auch die Voraussetzung zu ästhetischen Erfahrungen im Umgang mit Schrift, mit den kunstvollen Spielformen des Erzählens und Reflektierens, welche poetisch gestaltete Texte anbieten.
Für Menschen, die im Umgang mit Texten geübt sind, ist Lesen also ein mehrfacher Gewinn. Nicht zuletzt bedeutet Lesefähigkeit auch Mitgliedschaft, das heißt Zugehörigkeit zu jenem Teil der Gesellschaft, der sich mithilfe von Schrift austauschen und verständigen kann und der auch in der Lage ist, schriftbezogene Kultur zu genießen. Lesen ist eine der wichtigsten, zu erstrebenden Kompetenzen im Leben jedes Menschen. Wer lesen kann und sich bemüht, diese Fähigkeit kontinuierlich zu fördern, hat die Möglichkeit, sich weiterzubilden.
Es ist ein Fakt, dass ein großer Teil der Heranwachsenden im Laufe der Zeit und ihrer Entwicklung, die Lust am Lesen verliert, dies tritt oftmals im Zeitraum der siebten bis zur neunten Klasse ein, da die Kinder sich zu diesem Zeitpunkt in der Pubertät befinden. Eine Möglichkeit zur Leseförderung ist die Nutzung des Lesetagebuches. Dieses wird Gegenstand dieser Hausarbeit sein. Dabei erläutert wird die Definition der Leseförderung, die Begriffe intrinsische und extrinsische Lesemotivation und schließlich wird die Frage, inwiefern das Lesetagebuch zur Leseförderung geeignet ist, unter Einbezug möglicher Aufgabenstellungen zum Jugendroman "Nichts" von Janne Teller, erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Leseförderung
- 2.1 Konzepte der Leseförderung
- 3. Lesemotivation – Intrinsische und extrinsische Motivation
- 4. Das Lesetagebuch
- 4.1 Lesetagebücher im Deutschunterricht
- 4.2 Mögliche Aufgaben zu Nichts von J. Teller
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Lesetagebuchs als Methode der Leseförderung, insbesondere im Kontext des Jugendromans "Nichts" von Janne Teller. Die Zielsetzung besteht darin, die verschiedenen Konzepte der Leseförderung zu beleuchten und deren Relevanz für die Motivation von Jugendlichen zu analysieren. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Lesetagebuch dazu beitragen kann, die Lesekompetenz und das Leseverständnis zu verbessern.
- Leseförderung im Deutschunterricht
- Intrinsische und extrinsische Lesemotivation
- Das Lesetagebuch als Methode der Leseförderung
- Anwendungsbeispiele am Jugendroman "Nichts"
- Herausforderungen der Leseförderung im Jugendalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Lesekompetenz als Schlüsselkompetenz und die Herausforderungen der Leseförderung im Jugendalter, insbesondere den Leseverlust im Übergang zur Sekundarstufe. Sie führt in die Thematik des Lesetagebuchs als Methode zur Leseförderung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition von Leseförderung, die Betrachtung intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie die Analyse des Lesetagebuchs am Beispiel von Janne Tellers "Nichts" umfasst. Die Einleitung verdeutlicht den dringenden Bedarf an effektiven Methoden zur Leseförderung, um junge Menschen für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz nachhaltig zu stärken. Der Bezug auf den komplexen Akt des Lesens und dessen gesellschaftliche Relevanz unterstreicht den Stellenwert der Arbeit.
2. Definition von Leseförderung: Dieses Kapitel definiert Leseförderung als pädagogische Aufgabe, die Kinder und Jugendliche zum Lesen schriftlicher Literatur motivieren und ihr Interesse daran wecken soll. Es verortet Leseförderung im Kontext des hessischen Kerncurriculums und diskutiert zwei gegensätzliche Modelle: das kognitionstheoretisch orientierte Modell der PISA-Studie, das sich auf die Messung der Leseleistung konzentriert, und das kulturwissenschaftlich orientierte Modell der Lesesozialisationsforschung, welches den individuellen Bildungsprozess durch das Lesen betont. Die Diskussion dieser beiden Modelle unterstreicht die Komplexität des Begriffs "Leseförderung" und die verschiedenen Ansätze, die zur Förderung der Lesekompetenz verfolgt werden können. Die Bedeutung der Lehrkraft als zentrale Figur der Lesesozialisation wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Leseförderung, Lesetagebuch, Lesemotivation, Jugendroman, Janne Teller, Nichts, Lesekompetenz, Deutschunterricht, Sekundarstufe, Intrinsische Motivation, Extrinsische Motivation, Lesesozialisation.
Häufig gestellte Fragen zu: Leseförderungsmethoden am Beispiel von Janne Tellers "Nichts"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Lesetagebuchs als Methode der Leseförderung, insbesondere im Kontext des Jugendromans "Nichts" von Janne Teller. Sie analysiert verschiedene Konzepte der Leseförderung und deren Einfluss auf die Motivation von Jugendlichen. Ein zentrales Thema ist die Verbesserung der Lesekompetenz und des Leseverständnisses durch den Einsatz des Lesetagebuchs.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Leseförderung im Deutschunterricht, intrinsische und extrinsische Lesemotivation, das Lesetagebuch als Methode der Leseförderung, Anwendungsbeispiele am Jugendroman "Nichts", und die Herausforderungen der Leseförderung im Jugendalter. Sie vergleicht auch verschiedene Modelle der Leseförderung (kognitionstheoretisch und kulturwissenschaftlich orientiert).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition von Leseförderung (inkl. Konzepte der Leseförderung), Lesemotivation, Das Lesetagebuch (inkl. Einsatz im Deutschunterricht und Aufgabenbeispielen zu "Nichts"), und Schlussbetrachtung.
Wie wird das Lesetagebuch in der Arbeit betrachtet?
Das Lesetagebuch wird als Methode der Leseförderung analysiert, insbesondere im Bezug auf den Jugendroman "Nichts" von Janne Teller. Die Arbeit zeigt mögliche Aufgaben und Anwendungsmöglichkeiten des Lesetagebuchs im Deutschunterricht auf.
Welche Rolle spielt die Lesemotivation in der Arbeit?
Die Arbeit unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation und untersucht, wie diese durch das Lesetagebuch und andere Methoden der Leseförderung beeinflusst werden können.
Welche Definition von Leseförderung wird verwendet?
Leseförderung wird definiert als pädagogische Aufgabe, die Kinder und Jugendliche zum Lesen schriftlicher Literatur motivieren und ihr Interesse daran wecken soll. Die Arbeit diskutiert dabei unterschiedliche Modelle der Leseförderung, die sich auf kognitionstheoretische und kulturwissenschaftliche Ansätze stützen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leseförderung, Lesetagebuch, Lesemotivation, Jugendroman, Janne Teller, Nichts, Lesekompetenz, Deutschunterricht, Sekundarstufe, Intrinsische Motivation, Extrinsische Motivation, Lesesozialisation.
Was ist das Fazit der Einleitung?
Die Einleitung betont die Bedeutung der Lesekompetenz und die Herausforderungen der Leseförderung im Jugendalter. Sie hebt den dringenden Bedarf an effektiven Methoden zur Leseförderung hervor, um junge Menschen für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Sie führt in die Thematik des Lesetagebuchs ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was ist das zentrale Ergebnis der Kapitel zur Definition von Leseförderung?
Dieses Kapitel definiert Leseförderung und diskutiert gegensätzliche Modelle: ein kognitionstheoretisches (PISA-Studie) und ein kulturwissenschaftliches (Lesesozialisationsforschung). Es hebt die Komplexität des Begriffs "Leseförderung" und die Rolle der Lehrkraft in der Lesesozialisation hervor.
- Arbeit zitieren
- Büsra Kocabiyik (Autor:in), 2017, Das Lesetagebuch als Methode zur Leseförderung und zur Steigerung der Sprachkompetenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380421