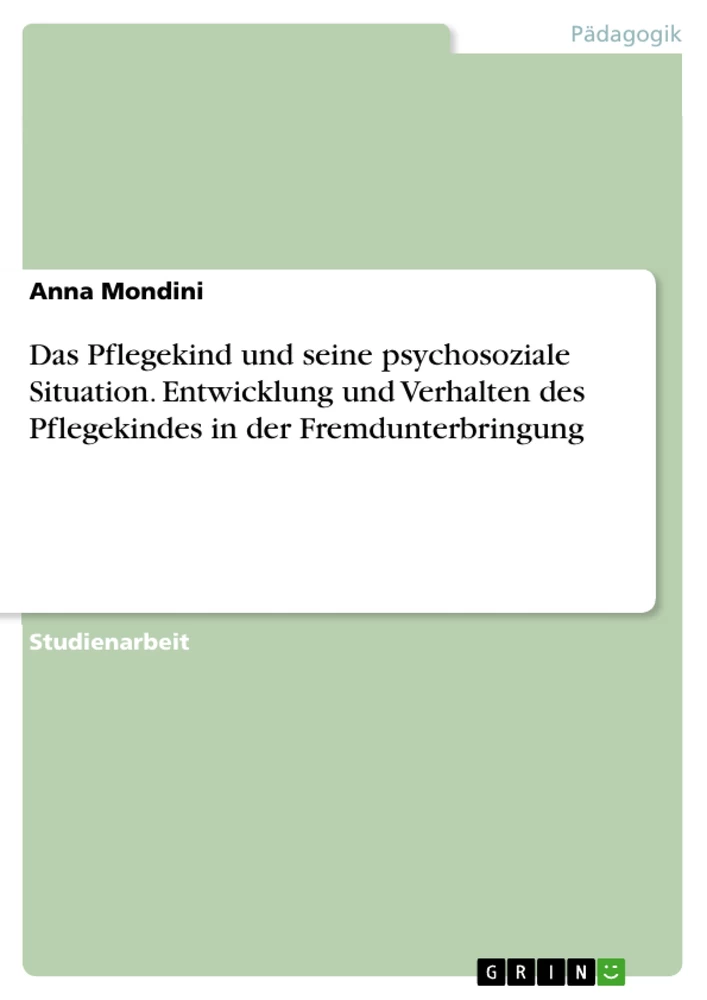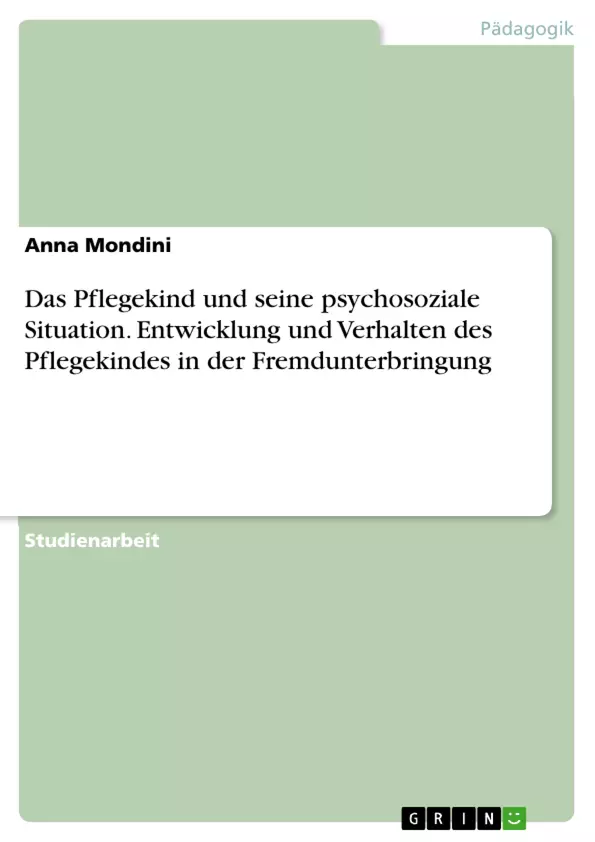Derzeit leben in Deutschland rund 84.000 Kinder in einer Fremdunterbringung bei Pflegeeltern. Ihre leiblichen Eltern hatten erhebliche Schwierigkeiten, die notwendige Erziehung und Versorgung des Kindes zu gewährleisten. Viele der Kinder waren zu der Zeit, die sie bei ihren Eltern verbrachten, schutzlos Situationen wie Vernachlässigung, Misshandlungen oder Missbrauch ausgesetzt, die in vielen Fällen schlimme Auswirkungen bei ihnen hinterlassen haben. Durch diese einschneidenden Erlebnisse sowie die häufigen Bindungsabbrüche stellen Pflegekinder eine stark belastete Gruppe dar, die nicht selten diverse Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
Da in der Kinder- und Jugendhilfe mehrere Formen der Fremdunterbringung existieren, wie beispielsweise die Tages- oder Kurzzeitpflege, beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die Vollzeitpflege. Die Vollzeitpflege ist darauf ausgelegt, dass das Kind für einen längeren Zeitraum bei seiner Pflegefamilie leben wird und zu seinen Pflegeeltern eine tiefergreifende Beziehung aufbaut. Bezugnehmend auf die Vollzeitpflege untersucht die Arbeit, wie sich die Entwicklung und das Verhalten eines Pflegekindes hinsichtlich seiner psychosozialen Situation in der Fremdunterbringung gestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Herkunftsfamilie des Pflegekindes
- Erfahrungen in der Herkunftsfamilie - Traumatische Erlebnisse
- Vernachlässigung
- Misshandlungen
- Sexueller Missbrauch
- Die Bindungen der Pflegekinder
- Bindungstheorie nach John Bowlby
- Bindungserfahrungen des Pflegekindes
- Das Verhältnis zur Pflegefamilie
- Der Prozess des Ablösens zur Herkunftsfamilie
- Anbahnung zu den Pflegeeltern
- Trennungsüberwindung zur Herkunftsfamilie
- Beziehungsaufbau zur Pflegefamilie - Die Phasen der Integration
- Anpassungs- bzw. Übergangsphase
- Übertragungsphase
- Regressionsphase
- Das Pflegekind zwischen zwei Familien
- Besuchskontakte zur Herkunftsfamilie
- Besuchskontakte - eine Ansicht von Irmela Wiemann
- Risiko- und Schutzfaktoren der Besuchskontakte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychosozialen Situation von Pflegekindern in der Fremdunterbringung. Sie beleuchtet die Auswirkungen traumatischer Erlebnisse in der Herkunftsfamilie und untersucht, wie sich die Bindungserfahrungen und das Verhältnis zur Pflegefamilie auf die Entwicklung und das Verhalten des Kindes auswirken.
- Traumatische Erlebnisse in der Herkunftsfamilie (Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch)
- Bindungstheorie und Bindungserfahrungen des Pflegekindes
- Prozesse der Integration in die Pflegefamilie und die Herausforderungen der Doppelbindung
- Besuchskontakte zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilie: Risiken und Schutzfaktoren
- Folgen für die psychosoziale Entwicklung des Pflegekindes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der Vollzeitpflege für die psychosoziale Entwicklung von Pflegekindern. Im zweiten Kapitel werden die Erfahrungen des Pflegekindes in der Herkunftsfamilie, insbesondere traumatische Erlebnisse wie Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch, thematisiert. Kapitel 3 fokussiert auf die Bindungstheorie nach John Bowlby und beleuchtet die Auswirkungen der Bindungserfahrungen des Pflegekindes auf seine Entwicklung. Kapitel 4 betrachtet den Prozess der Integration in die Pflegefamilie und beschreibt die Phasen des Beziehungsaufbaus. Schließlich befasst sich Kapitel 5 mit den Besuchskontakten zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilie, analysiert deren Risiken und Schutzfaktoren und diskutiert ihre Auswirkungen auf das Kind.
Schlüsselwörter
Pflegekinder, Fremdunterbringung, Herkunftsfamilie, Traumatisierung, Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch, Bindungstheorie, Integration, Besuchskontakte, psychosoziale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Form der Fremdunterbringung wird in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschränkt sich auf die Vollzeitpflege, bei der das Kind für einen längeren Zeitraum in einer Pflegefamilie lebt.
Welche traumatischen Erfahrungen machen Pflegekinder häufig in ihrer Herkunftsfamilie?
Häufige Erfahrungen sind Vernachlässigung, Misshandlungen oder sexueller Missbrauch, die oft zu erheblichen Verhaltensauffälligkeiten führen.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie nach John Bowlby?
Die Bindungstheorie dient als Grundlage, um die Auswirkungen von Bindungsabbrüchen und die Entwicklung neuer Beziehungen zu den Pflegeeltern zu verstehen.
Was sind die Phasen der Integration in eine Pflegefamilie?
Der Prozess umfasst die Anpassungs- bzw. Übergangsphase, die Übertragungsphase und die Regressionsphase.
Wie wirken sich Besuchskontakte zur Herkunftsfamilie aus?
Besuchskontakte bergen sowohl Risiken als auch Schutzfaktoren; die Arbeit analysiert diese Spannungsfelder und deren Einfluss auf die psychosoziale Entwicklung.
- Quote paper
- Anna Mondini (Author), 2017, Das Pflegekind und seine psychosoziale Situation. Entwicklung und Verhalten des Pflegekindes in der Fremdunterbringung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380448