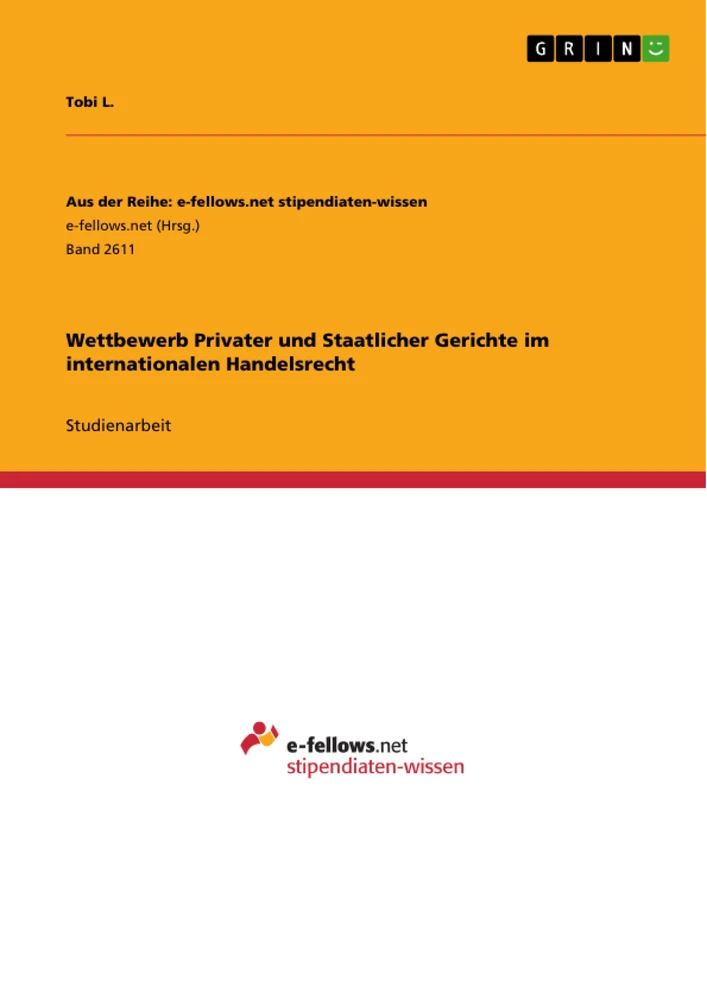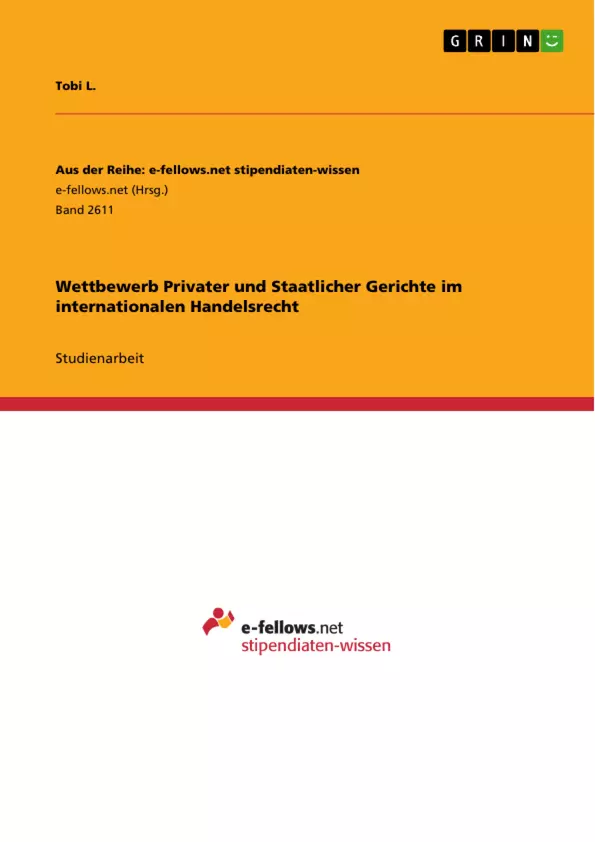Während in der Europäischen Union vereinheitlichte Regeln herrschen, scheint die Schaffung eines Weltprivatrechts über völkerrechtliche Verträge weitgehend gescheitert. Die Unsicherheiten bestehen im transnationalen Handel weiter. Getroffene transnationalen Abkommen täuschen nicht über das Unvermögen der Staaten hinweg, Rechtssicherheit für den internationalen Handel in Zeiten der Globalisierung bereitzustellen. In Ermangelung staatlich garantierter Rechtssicherheit hat sich ein großer Markt alternativer Methoden zur Gewährleistung von Rechtssicherheit im internationalen Handel entwickelt.
Diese alternativen Methoden stehen im Wettbewerb zur staatlichen Justiz, den jene im internationalen Handelsrecht zu verlieren scheint. Es ist die Rede von dem "Vanishing Trial", der "Entstaatlichung der Justiz" und von der "Flucht des grenzüberschreitenden Handels in die Schiedsgerichtsbarkeit".
Welche Implikationen ergeben sich aus einem Wettbewerb der Institutionen? Was sind die Ursachen der "Flucht in die Schiedsgerichtsbarkeit" und anderer alternativer Streitbeilegungsverfahren? Sind starke staatliche Gerichte im internationalen Handel aus ökonomischer und verfassungsrechtlicher Sicht notwendig?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird der Wettbewerb der Institutionen mithilfe von ökonomischen Theorien beschrieben und anschließend bewertet. Im nächsten Abschnitt wird die Dominanz der Handelsschiedsgerichtsbarkeit im internationalen Handel durch empirische Studien nachgewiesen und deren Ursachen betrachtet. Danach erfolgt eine Beurteilung der Entwicklung aus ökonomischer als auch aus verfassungsrechtlicher Sicht. Am Ende werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengeführt und mit einem Fazit abgeschlossen. Die Ausführungen dieser Arbeit beziehen sich, wenn nicht anders kenntlich gemacht wird, auf den Staat Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Wettbewerb der Institutionen
- I. „Wettbewerb der Justizdienstleistungen“
- 1. Neue Institutionenökonomik
- 2. Rechtsicherheit als Produkt
- 3. Anbieter
- a.) Staatliche Gerichte
- b.) Private Streitschlichtungsorgane
- (1). Alternative Methoden der Streitbeilegung
- (2). Schiedsgerichtsbarkeit
- 4. Nachfrager
- 5. Zwischenfazit
- II. Wirkung des Wettbewerbs der Institutionen
- 1. Positive Effekte des Wettbewerbs
- a.) Innovationsfunktion
- b.) Präferenzaufdeckung und -befriedigung
- c.) Kontrollfunktion
- 2. Negative Effekte des Wettbewerbs
- a.) Rechtsunsicherheit
- b.) Pfadabhängigkeit und Netzwerkexternalitäten
- c.) Informationskosten
- 3. Zusammenfassung
- III. Bewertung des Wettbewerbs der Institutionen
- C. Dominanz der Schiedsgerichte im internationalen Handel
- I. Empirische Studien
- II. Ursachen der Dominanz
- 1. Vorteile der Handelsschiedsgerichtsbarkeit gegenüber staatlichen Gerichten aus Sicht der Nachfrager
- a.) Vollstreckbarkeit
- b.) Sachkompetenz
- c.) Verfahrens- und materiell rechtliche Freiheit
- d.) Verfahrensdauer
- e.) Vertraulichkeit
- 2. Nachteile der Handelsschiedsgerichtsbarkeit gegenüber staatlichen Gerichten aus Sicht der Nachfrager
- a.) Kosten
- Ib.) Rechtsunsicherheit
- 3. Eignung für den internationalen Handel
- 4. Reaktionen der Parteien
- III. Kritische Betrachtung der Entwicklung
- 1. Ökonomische Betrachtung
- 2. Verfassungsrechtliche Betrachtung
- a.) Justizgewährleistungsanspruch
- b.) Rechtsfortbildung
- 3. Umfassende Bewertung
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht den Wettbewerb zwischen staatlichen und privaten Gerichten im internationalen Handelsrecht. Die Arbeit analysiert die ökonomischen und rechtlichen Implikationen dieses Wettbewerbs und untersucht insbesondere die Dominanz der Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Handel.
- Neue Institutionenökonomik und Rechtsicherheit
- Vorteile und Nachteile des Wettbewerbs der Institutionen
- Empirische Studien zur Dominanz der Schiedsgerichtsbarkeit
- Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Handel
- Verfassungsrechtliche Implikationen des Wettbewerbs der Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Wettbewerbs der Institutionen im internationalen Handelsrecht beleuchtet. Anschließend wird der Begriff „Wettbewerb der Justizdienstleistungen“ näher untersucht und die neuen Institutionenökonomischen Ansätze zur Analyse von Rechtsicherheit als Produkt vorgestellt. Die Arbeit analysiert die Anbieter von Justizdienstleistungen, einschließlich staatlicher Gerichte und privater Streitschlichtungsorgane, und betrachtet die Bedürfnisse der Nachfrager.
Kapitel B untersucht die Auswirkungen des Wettbewerbs der Institutionen. Hierbei werden sowohl positive Aspekte wie Innovationsförderung, Präferenzaufdeckung und Kontrollfunktion als auch negative Aspekte wie Rechtsunsicherheit, Pfadabhängigkeit und Informationskosten beleuchtet. Schließlich wird eine umfassende Bewertung des Wettbewerbs der Institutionen vorgenommen.
Kapitel C konzentriert sich auf die Dominanz der Schiedsgerichte im internationalen Handel. Die Arbeit analysiert empirische Studien, die diese Entwicklung belegen, und identifiziert die Ursachen für diese Dominanz. Neben den Vorteilen der Schiedsgerichtsbarkeit werden auch Nachteile im Vergleich zu staatlichen Gerichten beleuchtet, um die Eignung der Schiedsgerichtsbarkeit für den internationalen Handel besser zu verstehen. Abschließend werden die Reaktionen der Parteien auf diese Entwicklung und die kritische Betrachtung der Entwicklung aus ökonomischer und verfassungsrechtlicher Perspektive beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit wichtigen Themen und Konzepten im internationalen Handelsrecht, darunter die neue Institutionenökonomik, Rechtsicherheit als Produkt, Wettbewerb der Justizdienstleistungen, staatliche und private Gerichte, Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit, Vollstreckbarkeit, Sachkompetenz, Verfahrensdauer, Vertraulichkeit, Rechtsunsicherheit, Pfadabhängigkeit und Netzwerkexternalitäten.
Häufig gestellte Fragen
Warum bevorzugen Unternehmen im internationalen Handel Schiedsgerichte?
Schiedsgerichte bieten Vorteile wie schnellere Verfahren, Vertraulichkeit, höhere Sachkompetenz der Richter und eine bessere weltweite Vollstreckbarkeit von Urteilen im Vergleich zu staatlichen Gerichten.
Was bedeutet der Begriff "Vanishing Trial"?
Er beschreibt das Phänomen, dass immer weniger grenzüberschreitende Handelsstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten ausgetragen werden, da die Parteien in die private Schiedsgerichtsbarkeit "flüchten".
Welche Rolle spielt die Institutionenökonomik in diesem Wettbewerb?
Die neue Institutionenökonomik betrachtet Rechtssicherheit als ein "Produkt". Staatliche und private Akteure stehen im Wettbewerb um die effizienteste Bereitstellung dieses Produkts.
Gibt es Nachteile bei der Schiedsgerichtsbarkeit?
Ja, dazu gehören oft sehr hohe Verfahrenskosten und eine potenzielle Rechtsunsicherheit, da es meist keine Instanzenzüge für eine Überprüfung des Urteils gibt.
Was ist der Justizgewährleistungsanspruch?
Es ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, der besagt, dass der Staat den Bürgern effektiven Rechtsschutz garantieren muss. Der Wettbewerb durch private Gerichte wirft die Frage auf, ob der Staat dieser Pflicht noch ausreichend nachkommt.
- Arbeit zitieren
- Tobi L. (Autor:in), 2017, Wettbewerb Privater und Staatlicher Gerichte im internationalen Handelsrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380515