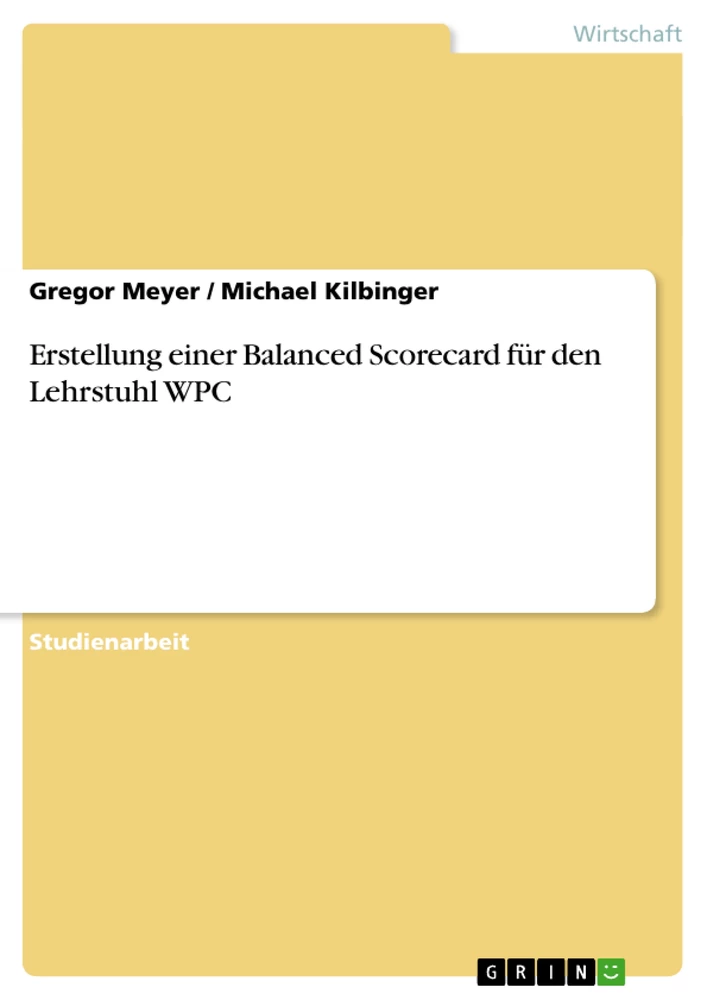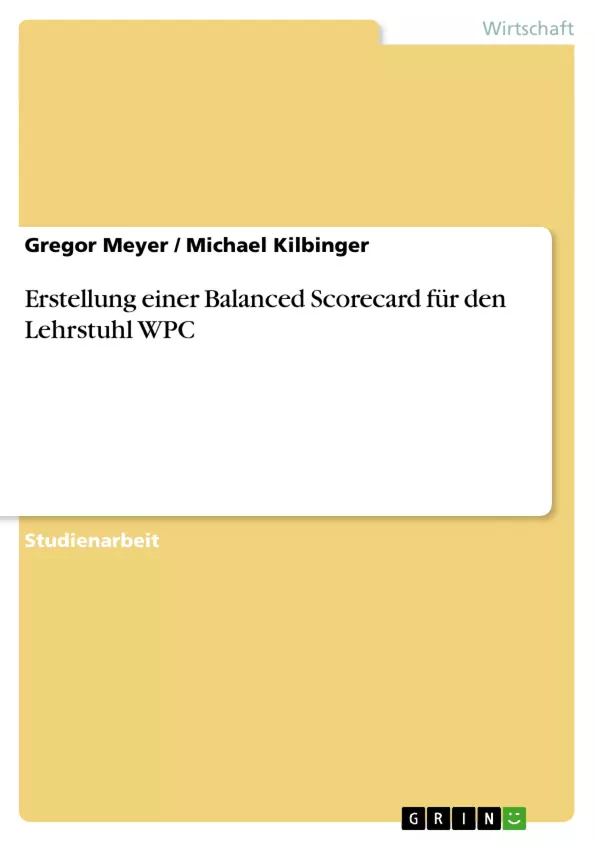Ende des 20. Jahrhunderts führten der Einsatz neuer Technologien zur Informationsverarbeitung, sowie der Zerfall des Ostblocks in wirtschaftlicher Hinsicht zum heutigen Phänomen der Globalisierung. Globalisierung bedeutet für Unternehmen wachsende Chancen, jedoch zugleich mehr Wettbewerbsdruck durch weltweite Konkurrenz.
Angesichts des gestiegenen Wettbewerbdrucks sahen und sehen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre Geschäftsprozesse und Unternehmensstrukturen neu zu organisieren. Dies führte zur Entwicklung vieler neuer Management- und Steuerungsmodelle, von denen die Balanced Scorecard (BSC), die von Robert S. Kaplan und David P. Norton entwickelt wurde, eines der erfolgreichsten ist, da sie traditionelle Ergebniskennzahlen mit zukunftsbezogenen Leistungstreibern ergänzt.
Auch der öffentliche Sektor und hier gerade Hochschulen sehen sich in den letzten Jahren starken Veränderungen ausgesetzt. Für Hochschulen ist es in Anbetracht steigender Studierendenzahlen und knapper öffentlicher Kassen immer schwerer ihren Auftrag - Forschung und Lehre - zu erfüllen. Gleichzeitig ist in den vergangenen Monaten in den Medien immer wieder von der Notwendigkeit einer Verbesserung des Bildungsstandortes Deutschland die Rede, da Humankapital die wichtigste Ressource Deutschlands sei.
Angesichts dieses Spannungsfelds von einerseits steigenden Anforderungen, andererseits geringeren Mitteln, wächst auf die Hochschulen der Druck, Konkurrenz- und Zukunftsfähigkeit herzustellen, zu sichern und zu verbessern. Die in der Politik diskutierten Lösungsansätze, wie bspw. Elite-Universitäten, Studiengebühren und Hochschulautonomie, sollen vor allem mehr Wettbewerb zwischen Hochschulen bzw. Fachbereichen oder Schwerpunkten initiieren.
In dieser Arbeit wird am Beispiel des Schwerpunkts Wirtschaftsprüfung und Controlling (WPC) des Fachbereichs IV der Universität Trier ein auf der BSC beruhendes Kennzahlensystem entwickelt. Dazu wird in einer einführenden Darstellung das veränderte Umfeld von Non-Profit-Organisationen (NPOs) und danach die grundsätzliche Möglichkeit des Einsatzes der BSC im Non-Profit-Bereich, sowie an Hochschulen analysiert. Im Hauptteil der Arbeit werden nach einer vorbereitenden Charakterisierung des Lehrstuhls konkrete Ziele, Kennzahlen und Informationsquellen vorgeschlagen, Ursache-Wirkungsbeziehungen dargestellt und anschließend kritische Faktoren beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die BSC für staatliche und andere Non-Profit-Organisationen
- Öffentliche Verwaltungen und NPOs in verändertem Umfeld
- Die BSC in NPOS
- BSC an Hochschulen
- Entwurf einer BSC für den Fachbereich WPC
- Vorbereitende Charakterisierung des Lehrstuhls
- Zielsetzungen des Schwerpunktes WPC
- Ist-Situation am Schwerpunkt WPC
- Entwicklung der Perspektiven, Ziele und Kennzahlen
- Kundenperspektive
- Interne Prozessperspektive
- Potentialperspektive
- Finanzielle Perspektive
- Ursache-Wirkungsbeziehungen
- Kritische Faktoren
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Kennzahlensystems für den Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Controlling (WPC) am Fachbereich IV der Universität Trier. Hierzu wird die Balanced Scorecard (BSC) als Instrument zur Performancemessung und -steuerung im Non-Profit-Bereich, insbesondere an Hochschulen, angewendet.
- Analyse des veränderten Umfelds von Non-Profit-Organisationen (NPOs), insbesondere Hochschulen
- Eignung und Einsatzmöglichkeiten der BSC im Non-Profit-Bereich
- Entwicklung eines konkreten BSC-Modells für den Schwerpunkt WPC
- Definition von Zielen, Kennzahlen und Informationsquellen für die verschiedenen Perspektiven der BSC
- Identifizierung von Ursache-Wirkungsbeziehungen und kritischen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Spannungsfeld zwischen steigenden Anforderungen und knapperen Ressourcen an Hochschulen vor. Sie erklärt die Notwendigkeit eines Kennzahlensystems zur Steigerung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.
Kapitel 2 analysiert das veränderte Umfeld von Non-Profit-Organisationen und erläutert die Einsatzmöglichkeiten der BSC in diesem Kontext. Dabei wird die BSC als ein erfolgreiches Modell zur Performancemessung und -steuerung im Non-Profit-Bereich vorgestellt.
Kapitel 3 entwickelt ein BSC-Modell für den Schwerpunkt WPC. Es beinhaltet die Definition von Zielen, Kennzahlen und Informationsquellen für die Kundenperspektive, die interne Prozessperspektive, die Potentialperspektive und die finanzielle Perspektive. Außerdem werden Ursache-Wirkungsbeziehungen und kritische Faktoren für die einzelnen Perspektiven dargestellt.
Schlüsselwörter
Balanced Scorecard (BSC), Non-Profit-Organisation (NPO), Hochschule, Wirtschaftsprüfung und Controlling (WPC), Performancemessung, Performance-Steuerung, Kennzahlen, Ziele, Informationsquellen, Ursache-Wirkungsbeziehungen, kritische Faktoren
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC)?
Ein Managementmodell, das finanzielle Kennzahlen mit zukunftsbezogenen Leistungstreibern wie Kunden- und Prozessperspektiven ergänzt.
Warum ist die BSC für Hochschulen relevant?
Angesichts knapper Kassen und steigendem Wettbewerb hilft die BSC Hochschulen dabei, Forschung und Lehre effizienter zu steuern und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Welche Perspektiven werden für den Lehrstuhl WPC entwickelt?
Es werden die Kundenperspektive (Studierende), die interne Prozessperspektive, die Potenzialperspektive und die finanzielle Perspektive analysiert.
Was sind Ursache-Wirkungsbeziehungen in der BSC?
Sie zeigen auf, wie Verbesserungen in einem Bereich (z. B. Mitarbeiterqualifikation) direkt den Erfolg in anderen Bereichen (z. B. Prozessqualität) beeinflussen.
Kann man die BSC einfach auf Non-Profit-Organisationen übertragen?
Ja, die Arbeit zeigt, dass die BSC flexibel genug ist, um auch die nicht-finanziellen Ziele staatlicher Organisationen und NPOs abzubilden.
- Citation du texte
- Gregor Meyer (Auteur), Michael Kilbinger (Auteur), 2004, Erstellung einer Balanced Scorecard für den Lehrstuhl WPC, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38054