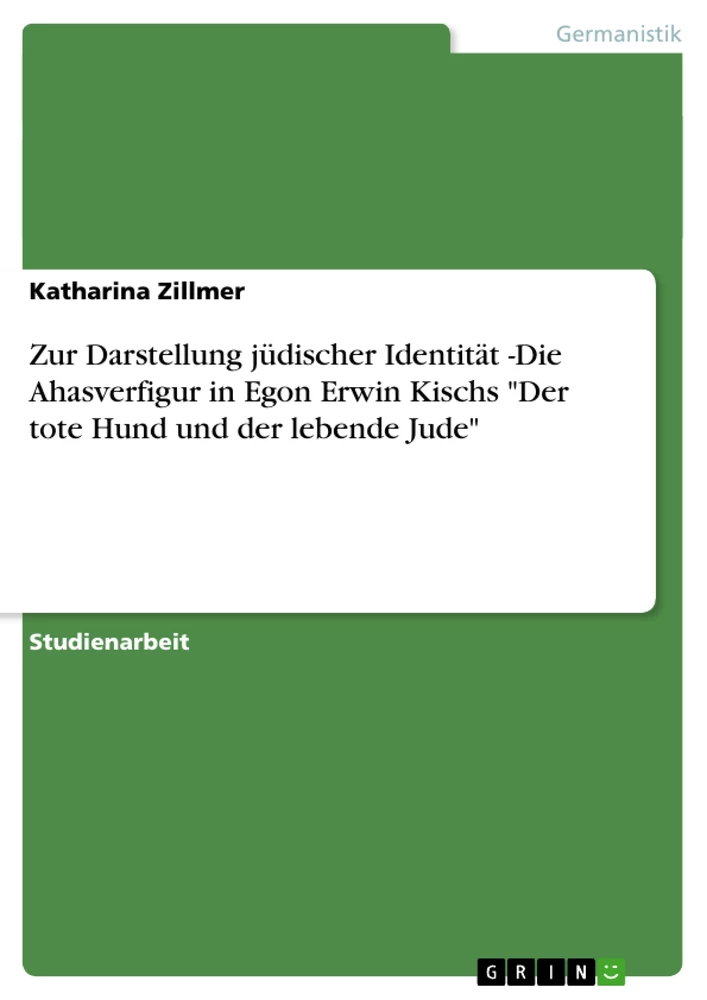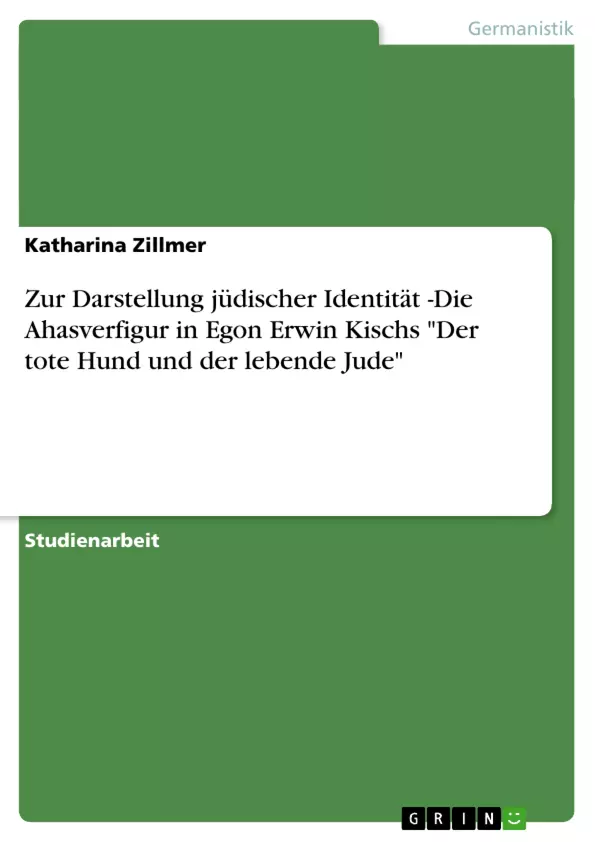Solange man lebt, wird man gehetzt von einem Ort zum andern, unstet und flüchtig, und erst wenn einer tot ist, läßt man ihn leben.1 Diese Worte, geäußert von einem der Hauptfiguren in der Erzählung von Egon Erwin Kisch „Der tote Hund und der lebende Jude“, drücken Gefühle einer Flüchtlingssituation aus, deren Leiden wohl erst durch den Tod beendet wird. Was ist nun, wenn man nicht sterben kann? Es einem nicht erlaubt ist, sein Leben zu beenden? Diese Situation scheint eher mystischen Ursprungs. Und genau diese Mystik des ewigen Lebens spiegelt sich, neben dem Glauben an Untote und andere dunkle Wesen, auch in dem Mythos des Ewigen Juden – Ahasver wieder. Von namhaften Schriftstellern, wie Johann Wolfgang von Goethe, Christian Friedrich Daniel Schubart, Achim von Arnim u. a., thematisiert, ist Ahasver (auch Ahasveros oder Ahasverus) wegen der Blasphemie an Jesus, von demselben zur Unsterblichkeit verdammt worden (weitere Erklärung dazu unter dem Gliederungspunkt 2). Der Untersuchungsgegenstand meiner Seminararbeit soll die Figur des Ahasver in Egon Erwin Kischs Werk „Der tote Hund und der lebende Jude“ sein. Die Person in seiner Erzählung, an der ich versuchen werde die Gestalt des „Ewigen Juden“ nachzuweisen, ist einer der Hauptpersonen und wird bis zum Schluss nicht namentlich benannt. Aus diesem Grund betitle ich die Figur als der Alte bzw. der Greis. Diese Bezeichnungen sind auch im Text fundiert.2 Ich gehe bei der Ausarbeitung wie folgt vor: Zuerst werde ich eine kurzen Einblick in den Mythos des Ahasver geben, auf den die Ansätze zur einer kritischen Auseinandersetzung der Glaubwürdigkeit folgen. Auf der Basis des erarbeiteten Wissens über die Figur des Ewigen Juden, gehe ich auf die im Text verwendeten Charaktereigenschaften der vermeintlichen Ahasverfigur ein. Dabei bediene ich mich einer Einteilung der Erzählung in drei Abschnitte und versuche in diesen meine Behauptung systematisch darzustellen. Abschließend werde ich der Geschichte eine Bedeutung zuweisen. 1 Kisch, Egon Erwin, Der tote Hund und der lebende Jude. In: Geschichten aus sieben Ghettos. In: Ders: Gesammelte Werke in Einzelausgabe. Bd. VI. Berlin, Weimar: Aufbau Verlag, 1973. S. 100. 2 Vgl. ebd., S. 99.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mythos des Ahasver
- Die Umstrittenheit der Ahasverfigur
- Die Ahasverfigur in der Erzählung
- Prager Judenfriedhof - Erstes Auftreten der Ahasverfigur
- Die Begegnung in Ungarn mit Wiedererkennungswert
- Die letzte und aufschlussreichste Begegnung
- Die Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Ahasverfigur in Egon Erwin Kischs Erzählung „Der tote Hund und der lebende Jude“. Ziel ist es, die Darstellung des „Ewigen Juden“ in der Figur des Alten/Greises nachzuweisen und die Bedeutung dieser Darstellung im Kontext der Erzählung zu beleuchten.
- Der Mythos des Ewigen Juden (Ahasver) und seine verschiedenen Überlieferungen.
- Die kritische Auseinandersetzung mit der Glaubwürdigkeit des Ahasver-Mythos.
- Analyse der Charaktereigenschaften der Ahasverfigur in Kischs Erzählung.
- Die Bedeutung der Ahasverfigur im Kontext der Erzählung „Der tote Hund und der lebende Jude“.
- Das Verhältnis von Glaube und Unglaube in Kischs Erzählung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Ausgangssituation der Erzählung, die den Mythos des Ewigen Juden aufgreift. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung des "Ewigen Juden" in der Figur des Alten/Greises in Kischs Werk dar und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die zentrale These ist die Identifizierung der namenlosen Hauptfigur mit dem Archetyp des Ahasver. Die Einleitung basiert auf einem Zitat aus der Erzählung und legt den Fokus auf den Zusammenhang zwischen Flucht, Tod und dem mystischen Aspekt des ewigen Lebens.
Der Mythos des Ahasver: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Versionen des Ahasver-Mythos, angefangen von den mittelalterlichen Quellen wie der Historia major von Matthäus Parisiensis, bis hin zur präziseren Darstellung im 17. Jahrhundert. Es werden unterschiedliche Namen und Variationen der Geschichte des Ewigen Juden vorgestellt, um die Entwicklung und die Vielschichtigkeit des Mythos aufzuzeigen. Besonders wird die Entwicklung der Figur vom heidnischen Torhüter Cartaphilus zum jüdischen Schuster Ahasver hervorgehoben, der Jesus die Ruhe verweigerte und zur ewigen Wanderung verdammt wurde. Das Kapitel untermauert die Bedeutung des Mythos als Grundlage für die spätere Analyse der Figur im Werk Kischs.
Die Umstrittenheit der Ahasverfigur: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit der Glaubwürdigkeit des Ahasver-Mythos. Es zitiert Avram Andrei Baleanu, der die sensationelle Natur der Erzählung und ihre propagandistische Veränderung im Laufe der Zeit betont und die inkonsistente Darstellung der Nationalität der Figur hervorhebt. Der Abschnitt stellt die scheinbar fundierte Wirklichkeit des Mythos (durch Augenzeugenberichte und Niederschriften) der kritischen Auseinandersetzung gegenüber, um das Phänomen des Wahrgeglaubten im Kontext von Glaube und Unglaube zu illustrieren. Diese Auseinandersetzung mit der Glaubwürdigkeit bildet den Kontext für die anschließende Analyse der Figur in Kischs Erzählung.
Die Ahasverfigur in der Erzählung: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Alten/Greises in Kischs Erzählung und untersucht, inwiefern er als Ahasverfigur interpretiert werden kann. Die Analyse gliedert sich in drei Abschnitte, die jeweils eine Begegnung mit dem Alten beschreiben und die verschiedenen Aspekte des Mythos in der Figur beleuchten. Es wird untersucht, wie Kisch Elemente des Mythos aufgreift und in seinen Text integriert, welche Eigenschaften des Alten auf die Ahasverfigur hindeuten und wie diese Darstellung im Kontext der Erzählung funktioniert. Die Bedeutung der drei Begegnungen für die Gesamtauslegung der Ahasverfigur wird ausführlich betrachtet. Der Fokus liegt auf einer systematischen Darstellung der angeblichen Ahasver-Eigenschaften der Figur und deren Verbindung mit der Handlung.
Schlüsselwörter
Ahasver, Ewiger Jude, Egon Erwin Kisch, Der tote Hund und der lebende Jude, Jüdische Identität, Mythos, Glaubwürdigkeit, Flucht, Exil, Identitätswandel, Glaube, Unglaube.
Häufig gestellte Fragen zu Egon Erwin Kischs „Der tote Hund und der lebende Jude“
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Darstellung der Ahasverfigur in Egon Erwin Kischs Erzählung „Der tote Hund und der lebende Jude“. Sie untersucht, wie Kisch den Mythos des Ewigen Juden in seiner Erzählung verwendet und welche Bedeutung diese Figur im Kontext der Geschichte hat. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Auseinandersetzung mit dem Ahasver-Mythos, eine kritische Betrachtung der Glaubwürdigkeit des Mythos und eine detaillierte Analyse der Ahasverfigur in Kischs Erzählung, gegliedert in drei Begegnungen des Protagonisten. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Mythos des Ewigen Juden (Ahasver), seine verschiedenen Überlieferungen und die kritische Auseinandersetzung mit seiner Glaubwürdigkeit. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Ahasverfigur in Kischs Erzählung, ihre Charaktereigenschaften und ihre Bedeutung für die Handlung. Weitere Themen sind das Verhältnis von Glaube und Unglaube in der Erzählung, jüdische Identität, Flucht und Exil sowie der Identitätswandel.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Mythos des Ahasver, Die Umstrittenheit der Ahasverfigur, Die Ahasverfigur in der Erzählung (mit Unterkapiteln zu den drei Begegnungen) und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Die Kapitel zum Ahasver-Mythos liefern den historischen und mythischen Hintergrund. Das Hauptkapitel analysiert die Ahasverfigur in der Erzählung. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methode wird in der Seminararbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode, die sich auf eine detaillierte Analyse des Textes konzentriert. Sie untersucht die sprachlichen Mittel, die Kisch verwendet, um die Ahasverfigur darzustellen, und setzt diese in den Kontext der Erzählung und des Ahasver-Mythos. Die Arbeit stützt sich auf Quellen und Zitate aus der Erzählung selbst sowie auf Sekundärliteratur, um den Mythos und seine Interpretationen zu beleuchten. Die Analyse der drei Begegnungen in Kischs Erzählung bildet einen zentralen Bestandteil der Methodik.
Welche Schlüsselfiguren und -begriffe sind wichtig für das Verständnis der Arbeit?
Die Schlüsselfiguren sind Ahasver (der Ewige Jude) und die namenlose Hauptfigur in Kischs Erzählung, die als Ahasver interpretiert wird. Wichtige Begriffe sind „Ewiger Jude“, „Jüdische Identität“, „Mythos“, „Glaubwürdigkeit“, „Flucht“, „Exil“, „Identitätswandel“, „Glaube“ und „Unglaube“. Der Autor Egon Erwin Kisch und seine Erzählung „Der tote Hund und der lebende Jude“ sind natürlich ebenfalls zentrale Elemente.
Welche Schlussfolgerung zieht die Seminararbeit?
Die genaue Schlussfolgerung wird im Text der Seminararbeit selbst dargelegt. Die Arbeit argumentiert für die Identifizierung der namenlosen Hauptfigur mit dem Archetyp des Ahasver und beleuchtet die Bedeutung dieser Darstellung im Kontext der Erzählung. Der Fokus liegt auf der systematischen Untersuchung, wie Kisch Elemente des Ahasver-Mythos in seiner Erzählung einbaut und welche Funktion diese Figur für das Verständnis der gesamten Geschichte hat.
- Quote paper
- Katharina Zillmer (Author), 2005, Zur Darstellung jüdischer Identität -Die Ahasverfigur in Egon Erwin Kischs "Der tote Hund und der lebende Jude", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38064