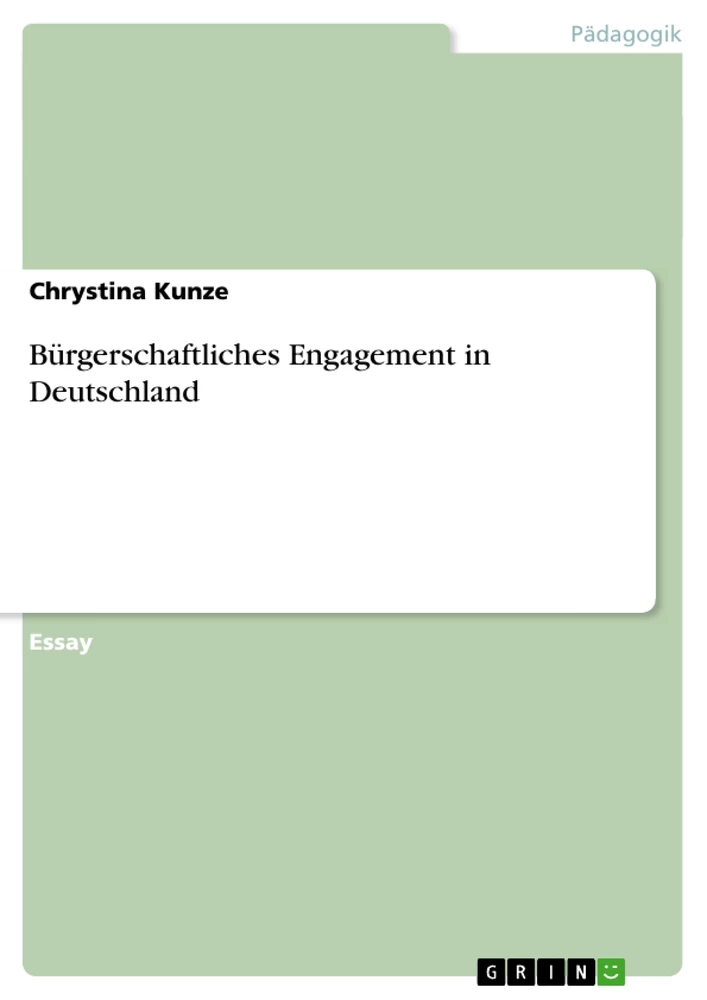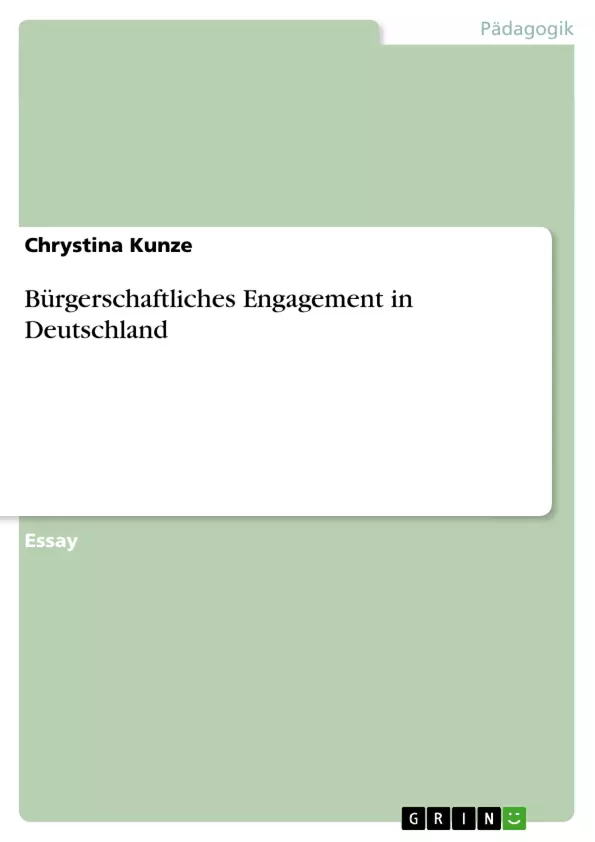Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führte das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest Sozialforschung repräsentative Telefonumfragen in den Jahren 1999 und 2004 durch. Mit Hilfe von etwa 15.000 zufällig ausgewählten BürgerInnen ab 14 Jahren sollte die Entwicklung sowie die gegenwärtige Situation des freiwilligen Engagements, dem „wichtigsten Thema der modernen Bürgergesellschaft“ in Deutschland erfasst werden.
Anhand dieser Umfrage war insgesamt zu erkennen, dass sich bereits das öffentliche Bild gemeinnütziger Arbeit und freiwilligen Engagements in einem Zeitintervall von lediglich fünf Jahren deutlich verbessert hat. So konnten 70% der im Jahr 2004 befragten BürgerInnen die Frage nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit bejahen, was im Vergleich zum Jahr 1999 einen Anstieg des freiwilligen Engagements um zwei Prozentpunkte bedeutet. Dabei verwiesen 36% der Engagierten auf eine längerfristige Tätigkeit vor allem in den Bereichen: Sport und Bewegung, Kultur und Musik, Kirche und Religion und betreuenden Einrichtungen wie z.B. Kindergarten und Schule. 42% der Befragten gab an, sogar in mehr als nur einer Tätigkeit ehrenamtlich wirksam zu sein, was im Vergleich zur Erstbefragung im Jahr 1999 einen Anstieg um fünf Prozentpunkte ausmachte.
Das Hauptaugenmerk engagierter Frauen lag dabei sowohl auf den Bereichen Schule und Kindergarten, Kirche und Religion als auch auf dem sozialen sowie sportlichen Bereich. Dem entgegen waren Männer vorrangig in den Bereichen Freizeit / Geselligkeit, Kultur und Musik, Kirche und Religion sowie Politik und Interessenvertretung ehrenamtlich tätig.
Inhaltsverzeichnis
- Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland
- Strukturwandel des bürgerschaftlichen Engagements
- Der Kommunitarismus
- Die Zivilgesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Entwicklung und den aktuellen Stand des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Er analysiert anhand repräsentativer Daten aus den Jahren 1999 und 2004, wie sich die Motivation, die Formen und die Bereiche des Engagements im Laufe der Zeit verändert haben.
- Veränderungen im öffentlichen Bild des bürgerschaftlichen Engagements
- Motivationsfaktoren für Engagement, insbesondere im Vergleich zu familiären Bindungen
- Strukturwandel des Engagements in Bezug auf Form, Dauer und Ausrichtung
- Theoretische Konzepte, die den Wandel des Engagements erklären, wie z.B. Kommunitarismus und Zivilgesellschaft
- Politisch-programmatische Veränderungen im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement
Zusammenfassung der Kapitel
Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer repräsentativen Telefonumfrage, die 1999 und 2004 durchgeführt wurde, um die Entwicklung und den aktuellen Stand des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland zu erforschen. Die Studie zeigt einen deutlichen Anstieg des Engagements in der Bevölkerung, insbesondere in den Bereichen Schule, Soziales und Jugendarbeit. Die Ergebnisse werden nach Altersgruppen, Geschlecht und Bundesland differenziert analysiert.
Strukturwandel des bürgerschaftlichen Engagements
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Wandel des bürgerschaftlichen Engagements, der seit den 1980er Jahren beobachtet wird. Der Text beleuchtet die veränderte Motivation, Form und Dauer des Engagements und veranschaulicht, wie sich das „alte“ Ehrenamt in ein „neues“ Engagement transformiert. Die Analyse bezieht sich auf die wachsende Bedeutung von nicht-familialen Beziehungen und die Suche nach sinnvollen Lebenserfahrungen als wichtige Motivatoren für Engagement.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Textes sind: bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, Sozialkapital, Kommunitarismus, Zivilgesellschaft, Strukturwandel, Motivation, Lebenserfahrung, soziale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland entwickelt?
Zwischen 1999 und 2004 stieg der Anteil der engagierten Bürger leicht an, und das öffentliche Bild gemeinnütziger Arbeit verbesserte sich deutlich.
In welchen Bereichen engagieren sich Deutsche am häufigsten?
Hauptbereiche sind Sport und Bewegung, Kultur und Musik, Kirche und Religion sowie soziale Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede beim Ehrenamt?
Ja, Frauen engagieren sich verstärkt im sozialen Bereich und in Bildungseinrichtungen, während Männer häufiger in den Bereichen Freizeit, Politik und Interessenvertretung aktiv sind.
Was ist der "Strukturwandel des bürgerschaftlichen Engagements"?
Der Wandel beschreibt den Übergang vom "alten" traditionellen Ehrenamt hin zu einem "neuen" Engagement, das stärker durch individuelle Sinnsuche und Flexibilität geprägt ist.
Welche theoretischen Konzepte werden im Text erwähnt?
Der Text thematisiert Konzepte wie den Kommunitarismus, die Zivilgesellschaft und das Sozialkapital.
- Citation du texte
- Chrystina Kunze (Auteur), 2005, Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38084