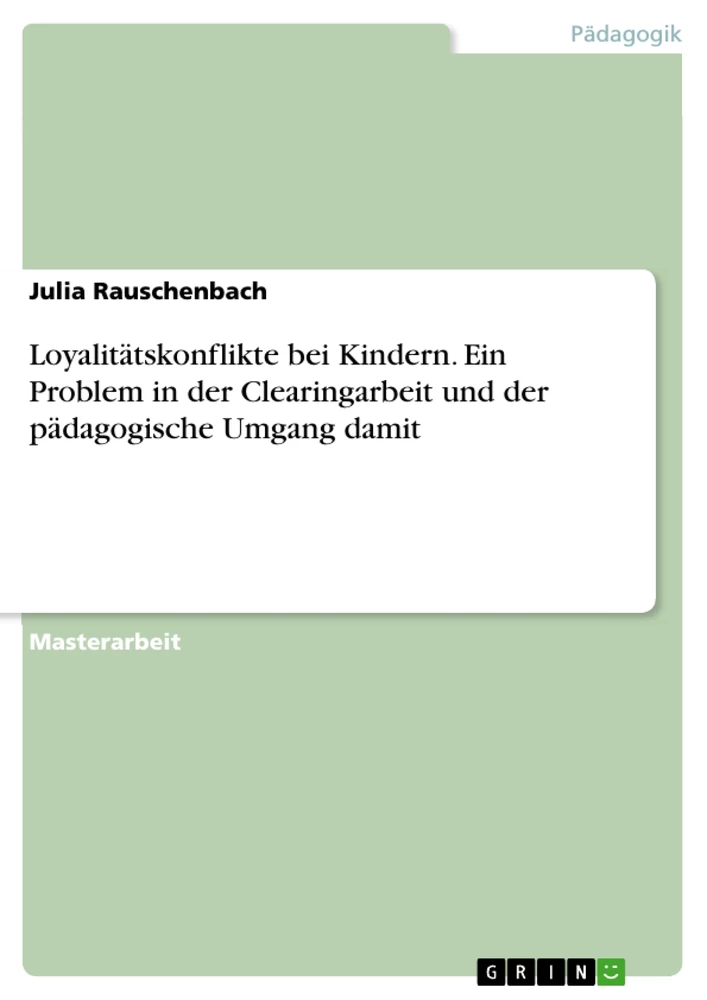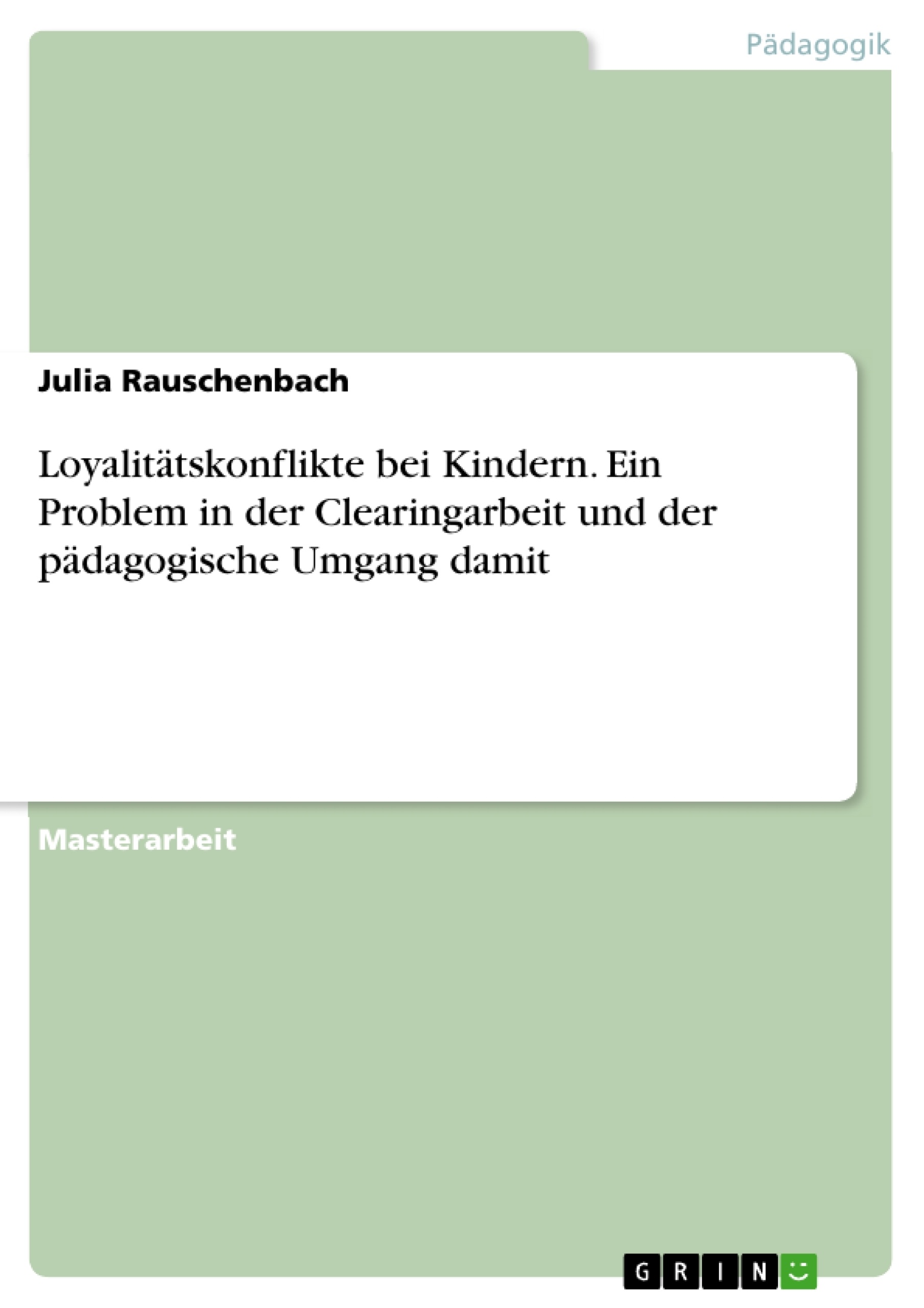Diese Masterarbeit wird sich einerseits mit den Themen befassen, wie Loyalitätskonflikte bei einem Kind entstehen und sich äußern und andererseits, wie MitarbeiterInnen einer Krisenunterbringung pädagogisch reagieren. Ziel der Arbeit soll es sein, die in Interviews erhaltenen praxisnahen Informationen mit einem theoretischen Teil zu verknüpfen und so die Forschungsfrage umfassend beantworten zu können. An dieser Stelle soll betont werden, dass nicht nur Loyalitätskonflikte während einer Clearingphase auftreten können, diese aber explizit Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind.
Laut des Statistischen Bundesamtes führten Jugendämter im Jahr 2015 insgesamt 129.000 Einschätzungen durch, die das Wohl des Kindes betrafen. Davon wurde bei 45.000 Verfahren eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung festgestellt, was etwa 36% der Gesamtheit darstellt. Können Bezugspersonen des Kindes die gefährdenden Aspekte nicht abwenden, weil sie dazu nicht in der Lage sind oder es nicht wollen, kann eine stationäre Unterbringung initiiert werden. Das Kind wird durch die Hilfe von der Familie getrennt und in einer Krisenwohngruppe untergebracht, was einen großen Einschnitt in das Familiensystem darstellt. In einer solchen Trennungsperiode kommen vor allem unsichtbare Bindungen zum Vorschein.
Loyalität spielt in destruktiven Familiensystemen eine große Rolle, denn sie ist es oft, die die Mitglieder aneinander bindet. Derartige Bindungen können während einer Krisenunterbringung allerdings emotionale Konflikte auslösen, sogenannte Loyalitätskonflikte. Durch die erhöhte Sensibilität für das Wohl des Kindes und die dadurch zu erklärenden steigenden Zahlen der stationären Hilfen, nehmen auch derartige emotionale Konflikte zu. Diese wirken sich,auf die Kooperation aller an der Hilfe beteiligten Personen aus. Bevor ein Kooperationsprozess beginnen kann, ist es wichtig, den Konflikt zu verbalisieren und wenn möglich aufzulösen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Unsichtbare Bindungen
- Bindung
- Loyalität
- Familie
- Eltern-Kind-Beziehung
- Krisen
- Destruktive Familiendynamik
- Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
- Gewalt
- Formen und Verhalten
- Beziehungen in stationären Einrichtungen
- Trennung von den Eltern
- Vertrauen
- Kommunikation
- Bindungsverhalten
- Zwangskontext und Zusammenarbeit
- Eltern- und Kinderrechte
- Kinder- und Jugendhilfe
- Ziele und Aufgaben
- Inobhutnahme und Unterbringung
- Vollzeitpflege
- Soziale Arbeit in Zwangskontexten
- Professionelle HelferInnen, KlientInnen und deren Beziehung
- Kontaktaufnahme
- Grundhaltung
- Einfluss
- Problemdefinition
- Arbeitsbündnis
- Pädagogisches Vorgehen
- Methodisches Vorgehen
- Forschungsfrage
- Untersuchungsfeld
- Berliner Krisengruppe
- Wahl der Interviewpartner
- Wahl der Methode
- Das Experteninterview
- Aufbereitung der Daten
- Inhaltsanalyse nach Mayring
- Ablaufmodell nach Mayring
- Inhaltsanalytische Gütekriterien
- Auswertung
- Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht Loyalitätskonflikte bei Kindern im Kontext der Clearingarbeit. Ziel ist es, den pädagogischen Umgang mit diesen Konflikten zu analysieren und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und den professionellen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe.
- Loyalitätskonflikte bei Kindern in Clearingprozessen
- Der Einfluss von Bindung und Familie auf die Konfliktdynamik
- Der Umgang mit Gewalt und Krisen in der Arbeit mit betroffenen Kindern
- Die Rolle professioneller HelferInnen und die Gestaltung des Arbeitsbündnisses
- Methodische Ansätze zur Analyse von Loyalitätskonflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik der Loyalitätskonflikte bei Kindern im Kontext der Clearingarbeit ein. Sie beschreibt die Problematik und die Relevanz des Themas, skizziert den Forschungsansatz und umreißt den Aufbau der Arbeit. Es wird die Notwendigkeit eines differenzierten Verständnisses der Herausforderungen hervorgehoben, denen Kinder in solchen Situationen gegenüberstehen, sowie die Bedeutung des professionellen Handelns der beteiligten Akteure.
Unsichtbare Bindungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Konzepte von Bindung und Loyalität, sowie deren Bedeutung im Familiensystem. Es analysiert verschiedene Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung, wie z.B. die soziale und emotionale Entwicklung, Krisen, destruktive Familiendynamiken und die Gefährdung des Kindeswohls. Die Ausführungen bilden eine zentrale Grundlage für das Verständnis der Loyalitätskonflikte im späteren Verlauf der Arbeit. Der Fokus liegt auf der komplexen Interdependenz dieser Faktoren und deren Einfluss auf das kindliche Erleben und Verhalten. Die Darstellung von Gewalt in unterschiedlichen Formen und deren Auswirkung auf die kindliche Entwicklung wird ebenfalls thematisiert.
Zwangskontext und Zusammenarbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit Loyalitätskonflikten. Es analysiert die Rolle der professionellen HelferInnen, die Herausforderungen der Kontaktaufnahme und die Bedeutung der Entwicklung eines tragfähigen Arbeitsbündnisses. Das Kapitel beleuchtet den Aspekt der Inobhutnahme und Unterbringung von Kindern und geht auf verschiedene pädagogische Vorgehensweisen ein. Der Schwerpunkt liegt auf der ethischen und professionellen Verantwortung im Umgang mit Kindern in Zwangskontexten und der Notwendigkeit einer ressourcenorientierten Perspektive.
Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die gewählte Forschungsmethodik. Es wird die Forschungsfrage präzisiert, das Untersuchungsfeld und die Auswahl der Interviewpartner erläutert. Die detaillierte Darstellung der Methode des Experteninterviews, der Datenaufbereitung und der Inhaltsanalyse nach Mayring bildet den methodologischen Rahmen der Arbeit. Die Auswahl der Methode wird begründet und die Gütekriterien der Inhaltsanalyse werden explizit genannt.
Schlüsselwörter
Loyalitätskonflikt, Clearingarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Bindung, Familie, Gewalt, professionelles Handeln, Experteninterview, Inhaltsanalyse, Kindeswohl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Loyalitätskonflikte bei Kindern im Kontext der Clearingarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht Loyalitätskonflikte bei Kindern im Kontext der Clearingarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Sie analysiert den pädagogischen Umgang mit diesen Konflikten und entwickelt Handlungsempfehlungen für die Praxis. Ein Schwerpunkt liegt auf den komplexen Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und professionellen Akteuren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Loyalitätskonflikte bei Kindern in Clearingprozessen, den Einfluss von Bindung und Familie auf die Konfliktdynamik, den Umgang mit Gewalt und Krisen, die Rolle professioneller Helfer und die Gestaltung des Arbeitsbündnisses sowie methodische Ansätze zur Analyse von Loyalitätskonflikten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einführung, Unsichtbare Bindungen, Zwangskontext und Zusammenarbeit, Methodisches Vorgehen, Auswertung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit der Einführung in die Problematik und endend mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Was wird unter „Unsichtbare Bindungen“ verstanden?
Das Kapitel „Unsichtbare Bindungen“ befasst sich mit den Konzepten von Bindung und Loyalität im Familiensystem. Es analysiert die Eltern-Kind-Beziehung, Krisen, destruktive Familiendynamiken, Kindeswohlgefährdung und verschiedene Formen von Gewalt und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung.
Wie wird der „Zwangskontext und die Zusammenarbeit“ behandelt?
Das Kapitel „Zwangskontext und Zusammenarbeit“ beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe, die Rolle professioneller Helfer, die Herausforderungen der Kontaktaufnahme, die Bedeutung des Arbeitsbündnisses, Inobhutnahme und Unterbringung von Kindern sowie verschiedene pädagogische Vorgehensweisen im Umgang mit Kindern in Zwangskontexten.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet die Methode des Experteninterviews, die Datenaufbereitung und die Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Forschungsfrage, das Untersuchungsfeld und die Auswahl der Interviewpartner werden detailliert beschrieben. Die Gütekriterien der Inhaltsanalyse werden explizit genannt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Analyse des pädagogischen Umgangs mit Loyalitätskonflikten bei Kindern im Kontext der Clearingarbeit und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Praxis. Sie möchte ein differenziertes Verständnis der Herausforderungen für Kinder in solchen Situationen schaffen und die Bedeutung des professionellen Handelns der beteiligten Akteure hervorheben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Loyalitätskonflikt, Clearingarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Bindung, Familie, Gewalt, professionelles Handeln, Experteninterview, Inhaltsanalyse, Kindeswohl.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts prägnant beschreibt. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über die Struktur und den Inhalt der gesamten Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, Sozialpädagogen, Psychologen, sowie Wissenschaftler und Studierende im Bereich der Sozialen Arbeit und verwandter Disziplinen, die sich mit den Themen Loyalitätskonflikte, Clearingarbeit und dem professionellen Umgang mit Kindern in schwierigen familiären Situationen auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Julia Rauschenbach (Auteur), 2017, Loyalitätskonflikte bei Kindern. Ein Problem in der Clearingarbeit und der pädagogische Umgang damit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380891