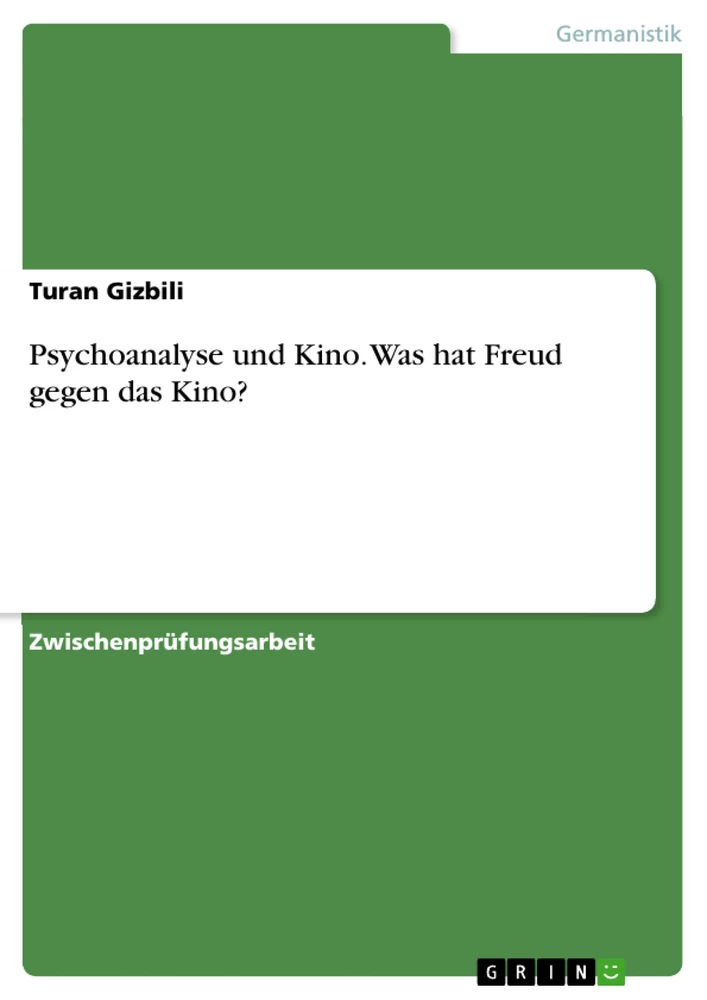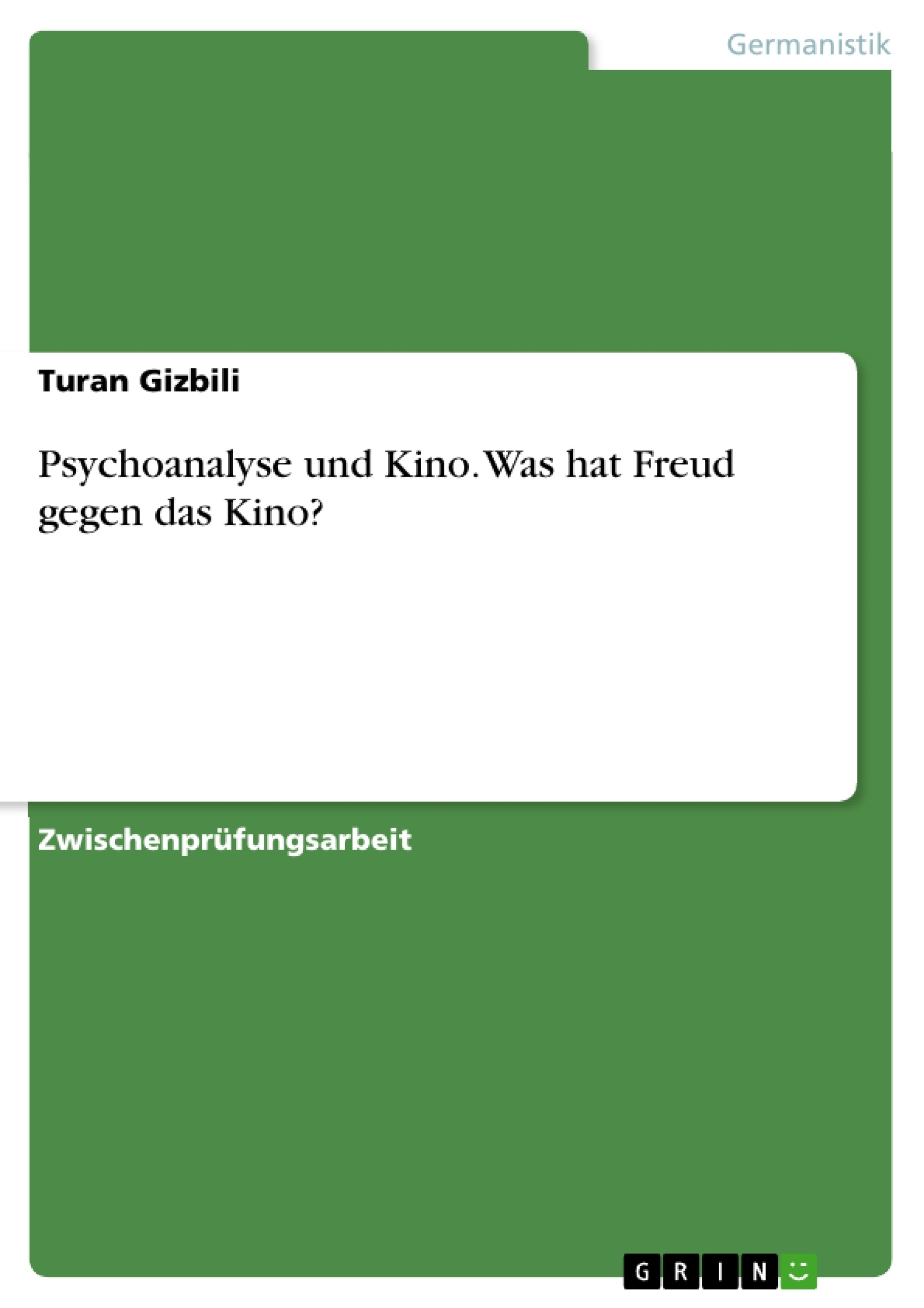Das Jahr 1895 kann als das Geburtsjahr zweier mächtiger Diskurse des 20. Jahrhunderts angesehen werden. Am 28. Dezember dieses Jahres fand in den Kellergewölben des Pariser Grand Café auf dem Boulevard des Capucines etwas statt, was es bis daher noch nicht gegeben hatte: die erste öffentliche Filmvorführung der Welt. Es wurden die Filme ,Le dejeuneé de bebé`, ,La sortie des usines`, ,L′arroseur arrose` und ,L′arrive d′un train en garre`gezeigt. Der letzte Film versetzte die Zuschauer in Schrecken, die ,,Lokomotive... rast aus der Tiefe der Leinwand direkt auf die Kamera zu und dicht vorbei. ... Ein neuer und vorerst befremdlicher Blick auf eine inszenierte Welt war entstanden, der ruhige Blick auf eine Welt der Bewegungen."1
Im selben Jahr kommt der ,Entwurf einer Psychologie` von Sigmund Freud heraus, seine erste grundlegende Schrift über das Ich. Unter anderem wird hier die These formuliert, daß die ,,reale Außenwelt...als Ananke (griech.), als ,Not des Lebens`, als Bedrängnis..."2 in den Menschen eintritt. ,,Realität stellt für die Psyche offensichtlich immer ein Moment von Anstrengung und peinsamer Herausforderung dar."3 Christiane von Wahlert sieht hier, daß Freuds These einen Erklärungsansatz für die Faszination der Menschen für das Kino liefern kann, da sich Ihrer Meinung nach im Kino ohne eigenes Zutun viel erleben läßt, ,, ohne von der realen Not des Lebens belästigt und eingeholt zu werden." 4
Vor allem Freuds Traumdeutung liefert für einige Filmemacher erst eine Art von intellektueller Berechtigung, eine geistige Vorwegnahme und Grundlage für die Produktion von Filmen:
,, Warum sollte man nicht Filme machen können, die nicht nur wie ein Traum sind und auch nicht nur eine Träumerei, sondern ein wirklicher Traum, wie wir ihn in tiefsten Schlafzuständen produzieren, mit allen den ihm zugehörigen Mechanismen, wie Verdichtung, Deplazierung, Überdeterminierung, wie sie uns die Psychoanalyse zu erkennen gelernt hat, mit aller scheinbaren Unlogik, die aber, wie man heute weiß, einer rigorosen symbolischen Verflechtung entspricht? Jetzt kann das Kino in wahrhaft surrealistischen Produktionen die tiefsten Mechanismen unseres Sinnenlebens zum Ausdruck bringen, wie dies kein anderes Medium besser als bewegtes Bild darstellen könnte. Dafür allerdings wird ein vertieftes Wissen vom affektiven Wert der Bilder und von den unbewußt ablaufenden Prozessen eine unerläßliche wissenschaftliche Voraussetzung für den Regisseur sein."6
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Psychoanalyse und Kino
- Das Verhältnis zueinander, gibt es Berührungspunkte, wenn Ja, welcher Art sind sie?
- ,,Wie lassen sich Intelligenzbestien, Bücherwürmer und Laborratten verfilmen?“ Darstellungsformen von Psycho-Analytikern und Psychoanalyse im Film.
- Theoretische Überlegungen zum Verhältnis Film/Psychoanalyse.
- Gemeinsamkeiten?
- Teil II: Was hat Freud gegen das Kino?
- Die Filmangelegenheit.
- Freuds theoretische Argumente gegen Visualisierung'.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Film, insbesondere Freuds Kritik am Kino. Sie analysiert die wechselseitige Beziehung zwischen beiden Disziplinen, beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie die Darstellung von Psychoanalytikern und Psychoanalyse im Film.
- Die Entstehung von Psychoanalyse und Film im Jahr 1895.
- Das Interesse des Kinos an der Psychoanalyse, insbesondere an Freuds Traumdeutung.
- Die Verwendung psychoanalytischer Konzepte in der Filmgestaltung.
- Freuds Kritik am Kino und seine Argumente gegen Visualisierung.
- Die Rolle des Films als Medium zur Darstellung des Unbewussten.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Kino. Er diskutiert, ob und inwiefern Berührungspunkte zwischen beiden Disziplinen bestehen, wie diese dargestellt werden und welche theoretischen Überlegungen dazu beitragen. Dabei werden verschiedene Beispiele aus der Filmgeschichte und die Gedanken von einflussreichen Persönlichkeiten wie Virginia Woolf und René Allendy herangezogen.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit Freuds Kritik am Kino, beleuchtet die „Filmangelegenheit“ und seine Argumente gegen die Visualisierung.
Schlüsselwörter
Psychoanalyse, Film, Freud, Traumdeutung, Visualisierung, Unbewusstes, Filmgeschichte, surrealistischer Film, Traumarchitektur, Filmtheorie, Psychoanalytiker im Film.
Häufig gestellte Fragen
Welche historische Verbindung gibt es zwischen Psychoanalyse und Film?
Beide Disziplinen entstanden 1895: Die erste Filmvorführung fand in Paris statt, und Sigmund Freud veröffentlichte seinen "Entwurf einer Psychologie".
Warum interessierten sich Filmemacher für Freuds Traumdeutung?
Die Traumdeutung lieferte eine intellektuelle Basis, um Mechanismen wie Verdichtung und Verschiebung filmisch als "bewegte Träume" darzustellen.
Welche Kritik übte Sigmund Freud am Kino?
Freud stand der Visualisierung psychoanalytischer Konzepte skeptisch gegenüber und sah im Kino eine Belästigung durch die "reale Not des Lebens".
Wie werden Psychoanalytiker im Film dargestellt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Darstellungsformen, von "Bücherwürmern" bis hin zu komplexen Charakterisierungen von Analytikern im Kino.
Was versteht man unter der "Traumarchitektur" im Film?
Es handelt sich um die Nutzung filmischer Mittel, um die unlogische, aber symbolisch verflochtene Struktur des Unbewussten abzubilden.
- Citar trabajo
- M.A. Turan Gizbili (Autor), 2001, Psychoanalyse und Kino. Was hat Freud gegen das Kino?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380