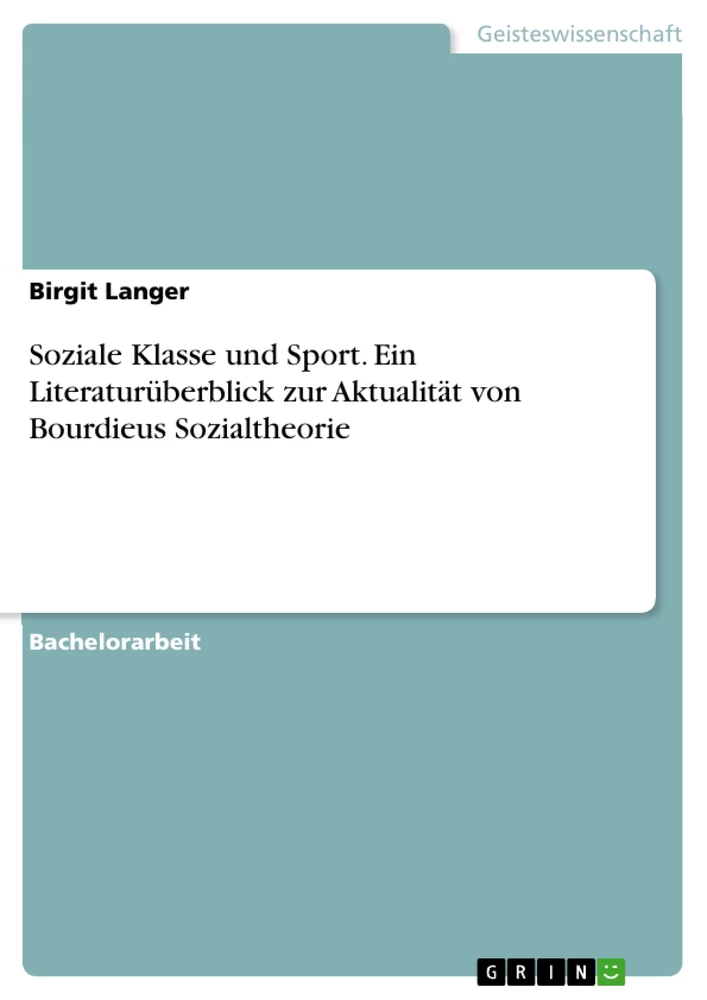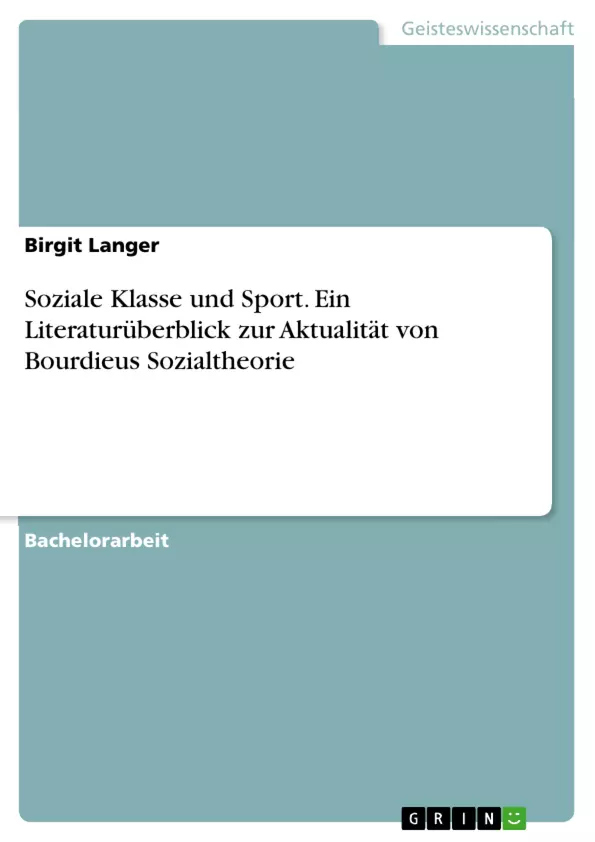Diese Arbeit soll folgende Forschungsfrage beantworten: Wie sieht der aktuelle Forschungsstand zur Anwendung der Theorie der sozialen Klasse nach Pierre Bourdieu auf den Bereich Sport aus? Damit soll festgestellt werden, wie sich die unterschiedliche Verteilung des ökonomischen und kulturellen Kapitals, sowie der Sporthabitus auf die Sportpartizipation auswirken.
Durch die Literaturrecherche soll ein Überblick über den Ist-Stand der Forschung abgebildet werden, ob und in welcher Weise sich soziale Klassen nach Bourdieu auf das Sportverhalten auswirken. Damit soll mehr Klarheit über soziodynamische Phänomene geschaffen werden, wie soziale Ungleichheiten hinsichtlich Sportpartizipation entstehen und sich ausdrücken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bourdieus Theorie der Sozialen Klassen
- 2.1. Kapital
- 2.1.1. Ökonomisches Kapital
- 2.1.2. Kulturelles Kapital
- 2.1.3. Soziales Kapital
- 2.1.4. Symbolisches Kapital
- 2.2. Felder
- 2.3. Habitus und Einverleibung
- 2.4. Lebensstil und Geschmack
- 2.5. Der soziale Raum
- 2.5.1. Kapitalvolumen
- 2.5.2. Kapitalstruktur
- 2.5.3. Verlagerungen im sozialen Raum
- 2.5.4. Distinktiver Raum der Lebensstile
- 2.6. Sport und soziale Klassen nach Bourdieu
- 3. Vorgehensweise / Methodik
- 3.1. Beschreibung der Methode Literaturrecherche
- 3.2. Literaturrecherche zur Aktualität von Bourdieus Klassentheorie im Feld Sport
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Qualitative Studien
- 4.2. Quantitative Studien
- 5. Diskussion
- 6. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz von Pierre Bourdieus Sozialtheorie im Kontext von Sport und sozialer Klasse. Sie analysiert die aktuellen Forschungsergebnisse und diskutiert, wie Bourdieus Konzepte wie Kapital, Habitus und sozialer Raum das Sportverhalten und die soziale Ungleichheit im Sport erklären können.
- Der Einfluss von sozialer Klasse auf Sportpartizipation
- Die Rolle von Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales) im Sportkontext
- Der Habitus und seine Bedeutung für die Wahl und Ausübung von Sportarten
- Die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Sport
- Die Aktualität von Bourdieus Theorie für die Analyse von Sportphänomenen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Relevanz von Bourdieus Theorie für die Untersuchung von Sport und sozialer Klasse heraus. Kapitel 2 erläutert die zentralen Konzepte von Bourdieus Sozialtheorie, einschließlich Kapital, Felder, Habitus, Lebensstil und sozialer Raum. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Literaturrecherche, die für diese Arbeit durchgeführt wurde. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse, aufgeteilt in qualitative und quantitative Studien.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Bourdieu, soziale Klasse, Sport, Kapital, Habitus, sozialer Raum, Lebensstil, Sportpartizipation, soziale Ungleichheit, Reproduktion, Distinktion.
- Quote paper
- Birgit Langer (Author), 2017, Soziale Klasse und Sport. Ein Literaturüberblick zur Aktualität von Bourdieus Sozialtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381052