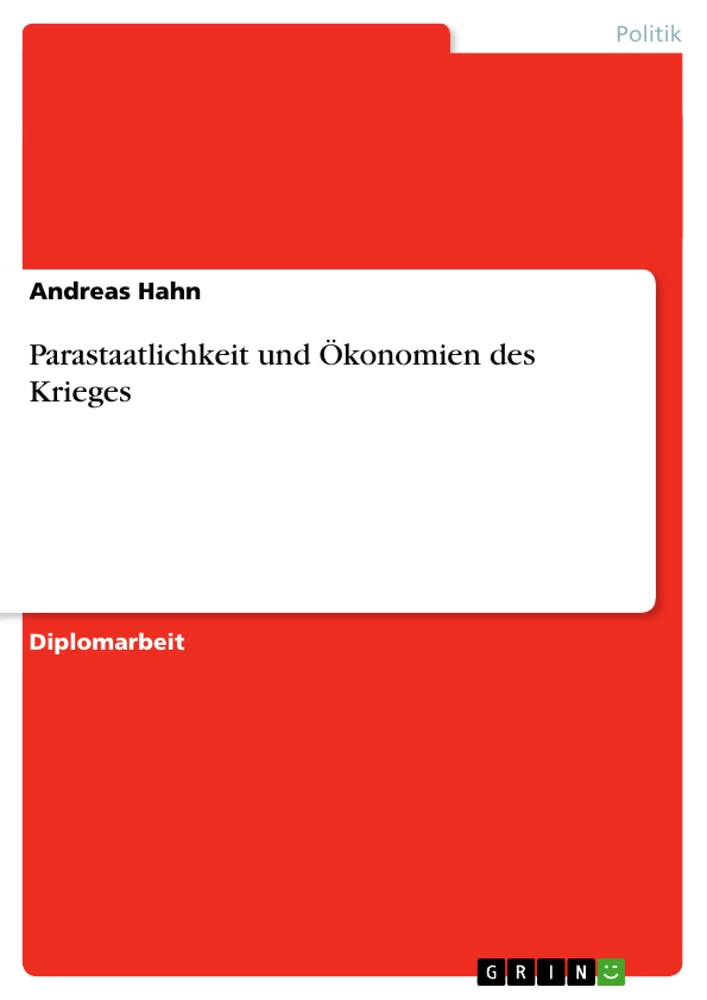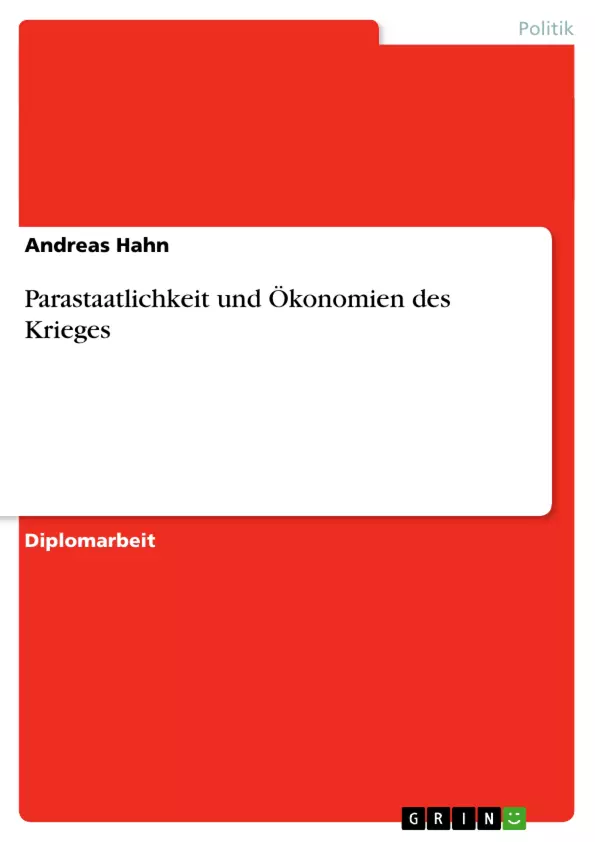Funktionierende soziale Ordnungen finden sich – so die Lesart – hauptsächlich in den Industriestaaten der westlichen Welt. Liberale „strong states“ erscheinen nach dem Niedergang des Sozialismus zwar nicht als einzige Ordnungsform, jedoch als effektivste – im wirtschaftlichen und politischen Sinne.
Dem gegenüber stehen Staaten, die durch Parastaatlichkeit und erodierte Gewaltmonopole gekennzeichnet sind. Es handelt sich dabei meist um „unfertige“ oder „schwache“ Ordnungen, die lediglich über partielle Staatlichkeit verfügen.
Anhand der „alternativen“ Ordnungsformen in Angola und Kolumbien soll nachgewiesen werden,
dass deren prekäre Situation keineswegs Ausdruck einer irrationalen Barbarei ist,
die man dem besonderen „vormodernen“ Charakter von Staatlichkeit der einzelnen Akteure zur Last legen kann. Vielmehr koexistieren in beiden Fällen alternative, traditionale oder regionalistische Ordnungsformen zusammen mit dem, was man als „kriegsökonomische Reproduktion“ bezeichnet: nur durch die Einbindung in weltweit vernetzte, schattenökonomische Netzwerke gelang es
den jeweiligen Kriegsakteuren in Kolumbien und Angola, sich zu finanzieren und dem Krieg den
Charakter eines „low-intensity-conflicts“ zu geben. Dies alles wiederum ist Ausdruck einer zutiefst
rationalen Profitmaximierungslogik wesentlicher Akteure. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist
die Schwäche des Staates, die der Stärke parastaatlicher Akteure korrespondiert und deren Reproduktion vereinfacht. Deren ursprüngliche Ziele wurden im Zeitverlauf durch andere Motivationsfaktoren zunehmend überlagert: Kriege werden weniger um Ideologien oder aufgrund sozialer Deprivation, sondern zunehmend um Öl, Diamanten und Drogen ausgefochten. Diese Entwicklung führte im Falle der angolanischen UNITA zu einer Hybridisierung der inneren Ordnung, die schliesslich in deren Zerfall mündete. Im Falle der kolumbianischen Bürgerkriegsakteure jedoch führte diese Hybridisierung eher in die andere Richtung – zu einer hohen Lukrativität des Drogenhandels.
Diese problematische Konstellation lässt sich indes im Rahmen der Entwicklungspolitik nur auflösen, wenn man Ursachen genügend differenziert und Konsequenzen auslotet. Der Plan Colombia kann dabei als Beispiel einer einseitig interessegeleiteten, militaristisch ausgerichteten Politik dienen, die in Verkennung der tatsächlichen Konfliktursachen gerade zur Intensivierung des Konfliktes beiträgt anstatt diesen zu mindern.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- KONZEPTE UND BEGRIFFE ZUM VERSTÄNDNIS VON STAATLICHKEIT IN KONFLIKTIVEN ORDNUNGEN
- ZWEI ORDNUNGSBEGRIFFE
- Der allgemeine Ordnungsbegriff
- Der empirische Ordnungsbegriff
- PREKÄRE STAATLICHKEIT
- Der „starke Staat“
- Quasistaaten zwischen empirischer und juristischer Staatlichkeit
- ANALYSE UND INTERPRETATION QUASI-STAATLICHER ORDNUNGEN
- Das Konzept von Joel Migdal
- Zur Internen Struktur von Quasistaaten
- Informalität und Patrimonialismus als Organisationsprinzipien quasistaatlicher Ordnung
- Vom Neopatrimonialismus zum Post-Adjustment-State
- Prozesse der Exklusion/Kooptation
- Ethnische und klassenspezifische Separierung
- Korruption
- Informalität und Patrimonialismus als Organisationsprinzipien quasistaatlicher Ordnung
- KRIEGSÖKONOMIEN ALS WIRTSCHAFTLICHE ORGANISATIONSFORM
- Krieg, Rente und Reproduktion
- Von „winning-hearts-and minds“ zur „shadow economy“
- „Schattenökonomien“ und externe Alimentation
- Veränderte Akteursbeziehungen
- Zusammenfassung
- Krieg, Rente und Reproduktion
- ZWISCHENFAZIT
- PARASTAATLICHKEIT UND POLITISCHE ÖKONOMIEN DES KRIEGES IN ANGOLA UND KOLUMBIEN
- ZUR HISTORISCHEN KONFLIKTGENESE
- Angolas Weg zur Parastaatlichkeit
- Kolumbien - Geschichte einer Dreiecksbeziehung
- „OFFIZIELL UND JURISTISCH“ VS. „INOFFZIELL UND EMPIRISCH“ – STAATSFUNKTIONEN UND QUASISTAATLICHKEIT IM VERGLEICH
- Partielle Territorialität – Angola
- Partielle Territorialität – Kolumbien
- Soziale Beziehungen – Angola
- Soziale Beziehungen – Kolumbien
- Ressourcenmobilisierung und Ressourcenverwendung - Angola
- Ressourcenmobilisierung und Ressourcenverwendung - Kolumbien
- Zwischenfazit
- INTERNE STRUKTUR UND ORDNUNG DER PARASTAATLICHEN AKTEURE
- Die Innere Ordnung der UNITA bis 1990/1991
- Die Rolle traditionaler Akteure
- Die Führungsriege und das Militär
- Exklusion, ethnische Separierung und Korruption
- Zum Vergleich: Gegenwärtige Interne Ordnung und Legitimität bei FARC und AUC
- Die Abwesenheit traditionaler Akteure
- Mafiotisches Beziehungsmanagement und selektives „Gemeinwohl“
- UNITA und FARC/AUC – Divergierende Entwicklungen in den Neunziger Jahren
- Interner Zerfall der UNITA
- Die Innere Ordnung der UNITA bis 1990/1991
- ÖKONOMIEN DES KRIEGES IN ANGOLA UND KOLUMBIEN
- Angola: Vom Stellvertreterkrieg zum „resource war“
- Externe Patronage und politische Renten
- Oil and Diamonds: Grundlagen und Funktionsweise einer Kriegsökonomie
- Art der Ressourcen/Primärgüter und deren geographische Verteilung
- Der Aufbau informeller Vertriebsstrukturen
- Ein Kontext der Regulationslosigkeit
- Zwischenfazit
- Angola: Vom Stellvertreterkrieg zum „resource war“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Parastaatlichkeit in konfliktiven Ordnungen. Sie untersucht, wie sich alternative, oft traditionelle oder regionalistische Ordnungsformen mit „kriegsökonomischen Reproduktionen“ vermischen und welche Folgen dies für die Entwicklung von Staaten hat. Die Arbeit analysiert zwei Fallbeispiele, Angola und Kolumbien, um zu zeigen, dass die konflikthafte Situation in diesen Ländern nicht Ausdruck irrationaler Barbarei, sondern eine Folge von tiefgreifenden, rationalen Entscheidungen ist.
- Parastaatliche Strukturen in Angola und Kolumbien
- Kriegsökonomische Reproduktionen
- Die Rolle traditioneller und regionalistischer Ordnungsformen
- Die Folgen von Parastaatlichkeit für die Entwicklung von Staaten
- Die Analyse von Plan Colombia als Beispiel für gescheiterte Entwicklungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Konzepte und Begriffe, die zum Verständnis von Staatlichkeit in konfliktiven Ordnungen notwendig sind. Hier werden verschiedene Ordnungsbegriffe, wie der allgemeine und der empirische Ordnungsbegriff, sowie das Konzept der „prekären Staatlichkeit“ beleuchtet. Im Fokus steht insbesondere das Konzept des „starken Staates“ und die Analyse von „Quasistaaten“.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den konkreten Fallstudien Angola und Kolumbien. Es wird die historische Entstehung der Konflikte in beiden Ländern beleuchtet und ein Vergleich zwischen den „offiziellen und juristischen“ sowie den „inoffiziellen und empirischen“ Staatsfunktionen durchgeführt.
Im dritten Kapitel wird die interne Struktur und Organisation der parastaatlichen Akteure in Angola und Kolumbien untersucht. Dazu werden die Entwicklungen innerhalb der UNITA in Angola und die aktuellen Strukturen der FARC und AUC in Kolumbien analysiert. Die Unterschiede in der Entwicklung beider Länder werden hervorgehoben.
Das vierte Kapitel analysiert die „Ökonomien des Krieges“ in Angola und Kolumbien. Hier wird die Entwicklung des Krieges in Angola von einem Stellvertreterkrieg zu einem „resource war“ betrachtet, und die Funktionsweise der Kriegsökonomie in beiden Ländern wird untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Parastaatlichkeit, Kriegsökonomien, Staatlichkeit, Konflikte, Entwicklung, Angola, Kolumbien, Plan Colombia, traditionelle Strukturen, regionalistische Ordnungsformen, „resource wars“, „shadow economies“, Informalität und Patrimonialismus.
- ZUR HISTORISCHEN KONFLIKTGENESE
- ZWEI ORDNUNGSBEGRIFFE
- Arbeit zitieren
- Andreas Hahn (Autor:in), 2004, Parastaatlichkeit und Ökonomien des Krieges, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38116