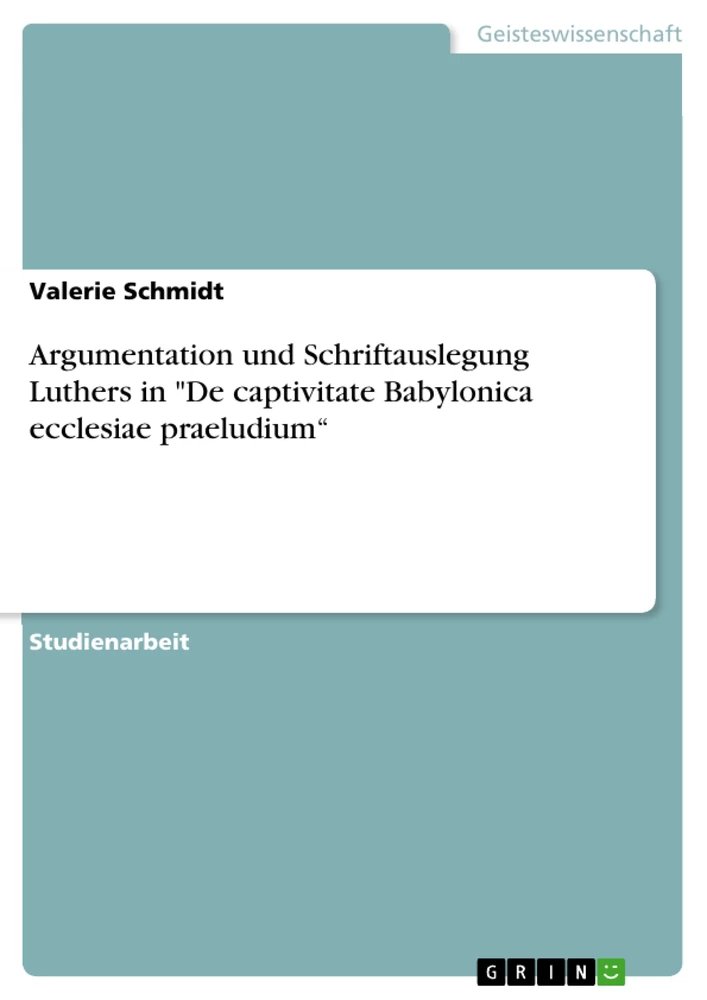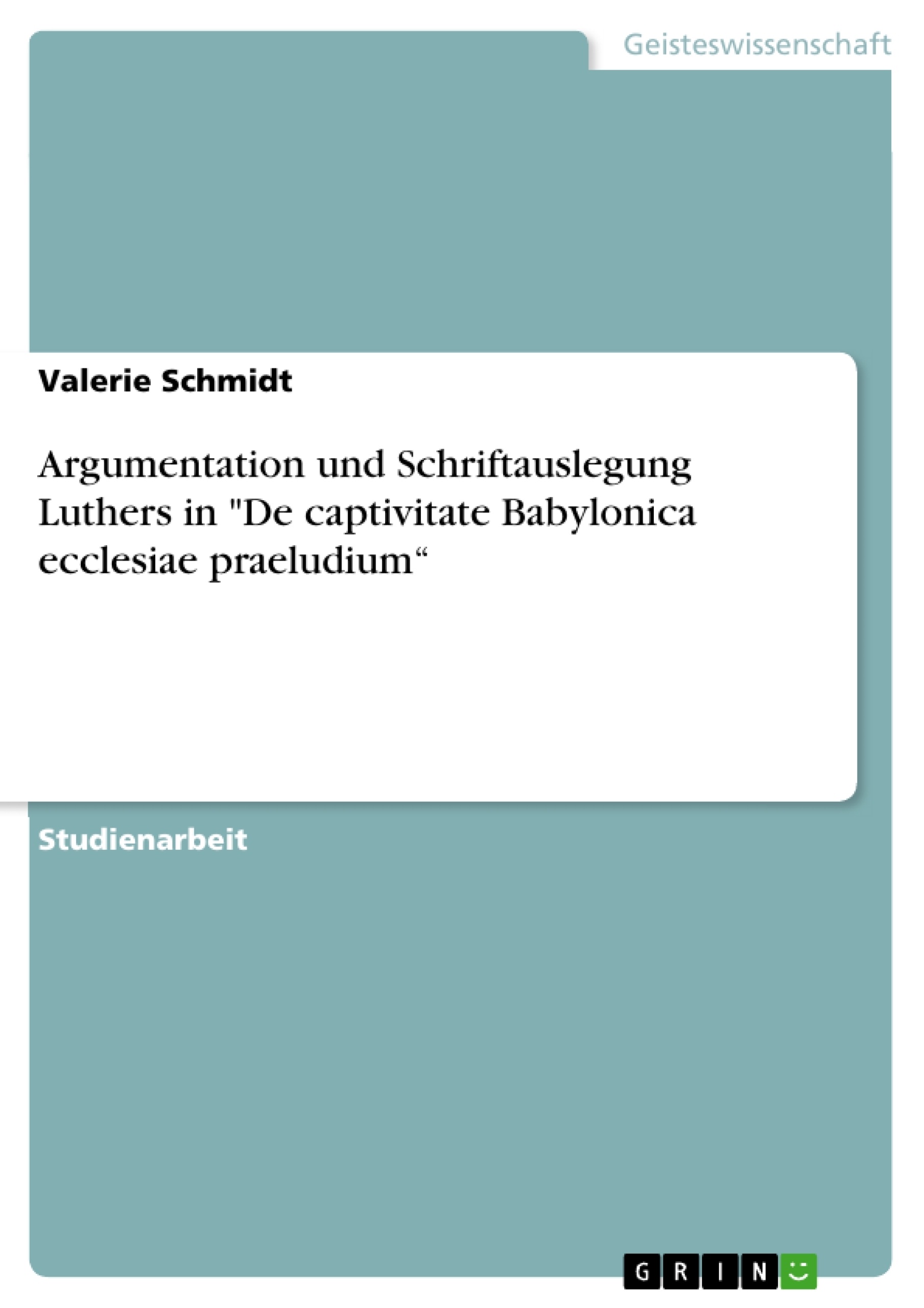Diese Arbeit handelt von Luthers Schrift „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium (Vorspiel von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche)“, die eine Kritik an der Sakramentenlehre der Papstkirche und sein reformatorischer Gegenentwurf darstellt.
Als sogenannte Hauptschriften von 1520 werden bezeichnet: „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“, die im August erschien, „De captivitate“ (Oktober) sowie „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (November), wobei letztere als populärste und wirkmächtigste gilt. „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ wurde für die lateinische Fachwelt verfasst. „Der beißend-ironische Titel ist als Anspielung auf den von Luther erwarteten Widerruf zu verstehen und bedeutet inhaltlich eine Konfrontation mit den Altgläubigen und ihrem mittelalterlichen Sakramentsverständnis.“ In seiner Schrift bezeichnet Luther das Sakramentsverständnis der Papstkirche als babylonische Gefangenschaft. Er bestreitet die Siebenzahl der traditionellen kirchlichen Sakramente, welche sind Taufe, Abendmahl, Buße, Firmung, Ehe, Priesterweihe und letzte Ölung. Durch die Auslegung der Heiligen Schrift versucht Luther zu beweisen, dass nur Taufe, Abendmahl und Buße biblisch begründbar sind. Gegen Ende seines Aufsatzes erwägt er, „ob die Buße tatsächlich zu den Sakramenten gehört, da ihr, anders als bei Taufe und Abendmahl, der Zeichencharakter fehlt.“ Laut Reinhard Schwarz liest sich Luthers Neubegründung der Sakramente in „De captivitate“ so, dass nur Taufe und Abendmahl als Sakramente gelten.
Als „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ im Oktober 1520 erschien, war Luthers Konflikt mit der Papstkirche bereits in vollem Gange. Für seine 95 Thesen über die Kraft der Ablässe aus dem Jahr 1517 hatte sie ihm den Prozess gemacht. Weil er den Widerruf verweigerte, wurde am 15. Juni 1520 die Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“ angefertigt, die 41 Sätze Luthers verwarf und seine Schriften zu verbrennen befahl. Luther reagierte darauf mit einer Gegenaktion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Luthers Neues Sakramentsverständnis
- Die Auslegung von Johannes 6
- Die Zwei Gestalten des Abendmahls
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die reformatorische Schrift „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ von Martin Luther. Sie analysiert Luthers Kritik an der Sakramentslehre der Papstkirche und sein neues Sakramentsverständnis. Die Analyse fokussiert sich auf Luthers Auslegung von Bibelstellen im Kontext der Abendmahlsliturgie.
- Luthers Kritik an der Sakramentslehre der Papstkirche
- Die Bibel als Grundlage für Luthers neues Sakramentsverständnis
- Die Bedeutung der beiden Gestalten des Abendmahls
- Luthers Auslegung von Johannes 6
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Werk „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ und seinen historischen Kontext vor. Sie beschreibt Luthers Motivation und Zielsetzung mit der Schrift.
Hauptteil
Luthers Neues Sakramentsverständnis
Dieser Abschnitt erläutert Luthers Neubegründung des Sakramentsverständnisses, das auf einer intensiven Auseinandersetzung mit der Bibel basiert.
Die Auslegung von Johannes 6
Der Fokus liegt auf Luthers Interpretation von Johannes 6 und wie er die dort dargelegten Aussagen auf das Abendmahl bezieht.
Die Zwei Gestalten des Abendmahls
Dieser Teil behandelt Luthers Kritik an der mittelalterlichen Praxis, die Gläubigen beim Abendmahl nur noch das Brot, aber nicht den Wein zu reichen. Luthers Auslegung der entsprechenden Bibelstellen wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Reformation, Sakrament, Abendmahl, Johannes 6, Bibel, Papstkirche, Luther, De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, Theologie, Liturgie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Luthers Schrift "De captivitate Babylonica"?
Die Schrift ist eine fundamentale Kritik an der Sakramentenlehre der römisch-katholischen Kirche und stellt Luthers reformatorischen Gegenentwurf dar.
Welche Sakramente erkennt Luther als biblisch begründet an?
Luther beweist durch die Auslegung der Heiligen Schrift, dass primär die Taufe und das Abendmahl (und anfangs noch die Buße) als Sakramente gelten können.
Warum bezeichnet Luther die Sakramentenlehre als "babylonische Gefangenschaft"?
Er sieht das Sakramentsverständnis der Papstkirche als eine Entstellung des Evangeliums an, durch die die Gläubigen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.
Was kritisierte Luther speziell am Abendmahl?
Er kritisierte unter anderem den Entzug des Kelches für die Laien und forderte die Spendung des Abendmahls in beiden Gestalten (Brot und Wein).
Welche Rolle spielt die Bibel in Luthers Argumentation?
Die Heilige Schrift ist für Luther die alleinige Autorität, mit der er die traditionellen kirchlichen Lehren prüft und neu begründet.
- Arbeit zitieren
- Valerie Schmidt (Autor:in), 2012, Argumentation und Schriftauslegung Luthers in "De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381294