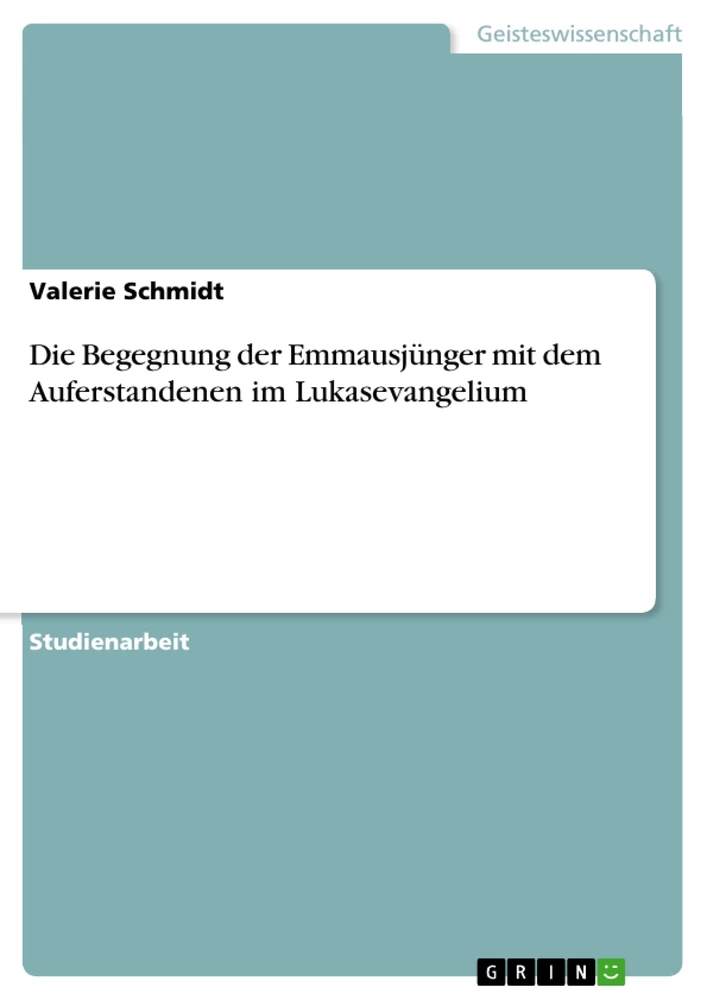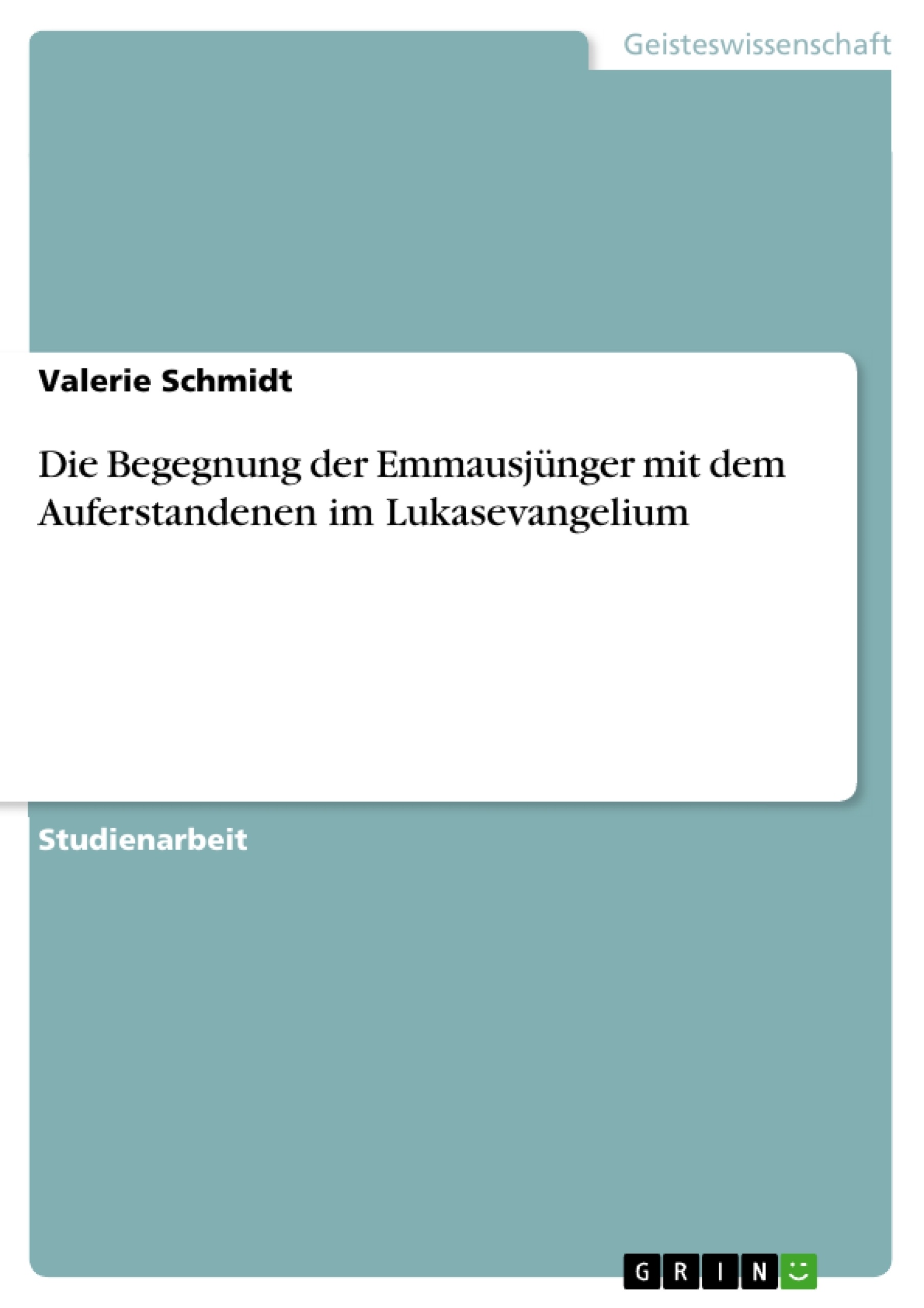Drei Tage nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, laufen zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Während sie über Jesu Verurteilung, Tod und leeres Grab reden, schließt sich ihnen der auferstandene Jesus an. Der Text beschreibt, indem er von einer Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet, einen geheimnisvollen und wunderbaren Moment. Die Spannung dieses Moments vermittelt er eindrücklich dadurch, dass die beiden Wanderer mit dem Auferstandenen über Jesus reden, aber Jesus nicht in ihm erkennen können. Selbst als er ihnen die Schrift auslegt, erkennen sie ihn nicht. Jesus offenbart sich schließlich durch die Zeichenhandlung des Brotbrechens.
Als Teil der Osterereignisse gehört die Erzählung von den Emmausjüngern gemeinsam mit der Passion zum Schluss des Lukasevangeliums. Der Schluss ist zugleich Höhepunkt und Ziel der Makroerzählung. Alle Kapitel zuvor sind auf dieses Ziel ausgerichtet und bereiten den Höhepunkt in seiner ganzen Dimension vor.
Als Bericht von der ersten Erscheinung des Auferstandenen erzählt die Episode von den Emmausjüngern von einem Wunder, das zunächst selbst die Jünger nicht begreifen können. Entsprechend seiner formalen Verortung im Schluss des Evangeliums ist die Bedeutung dieses Wunders größer als alle im Hauptteil beschriebenen Wunder. Die Begegnung mit dem Auferstandenen beweist Jesu Verkündigung, die in den 20 Kapiteln zuvor beschrieben wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Erster Leseeindruck
- Synchrone Zugangsweise
- Abgrenzung des Texts
- Kontextanalyse
- Gliederung
- Aussageintention
- Diachrone Beobachtungen
- Ältester Textzeuge
- Zeit der Abfassung
- Entstehungsgeschichte
- Verfasser
- Drei Forschungsthesen zum Sachverhalt
- Rudolf Bultmann - Auferstehungsgeschichte mit ältestem Gehalt
- Piet Schoonenberg - Ausdruck eines neuen Auferstehungsglaubens
- J.-N. Aletti – Emmausepisode als Zusammenfassung des Evangeliums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Emmaus-Erzählung im Lukasevangelium. Ziel ist es, die Erzählung sowohl synchron (im Kontext des Lukasevangeliums) als auch diachron (in Bezug auf ihre Entstehung und Rezeption) zu analysieren und ihre Aussageintention zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Forschungsperspektiven berücksichtigt.
- Die narrative Struktur der Emmaus-Erzählung
- Der theologische Gehalt der Emmaus-Erzählung im Kontext des Lukasevangeliums
- Die Bedeutung der Emmaus-Erzählung für das Verständnis der Auferstehung Jesu
- Die historische Einordnung der Emmaus-Erzählung
- Die Relevanz verschiedener Forschungsansätze zur Interpretation der Emmaus-Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Erster Leseeindruck: Die Erzählung beschreibt die Begegnung zweier Jünger mit dem auferstandenen Jesus auf dem Weg nach Emmaus. Der geheimnisvolle und wunderbare Charakter der Begegnung wird durch die Unfähigkeit der Jünger, Jesus zunächst zu erkennen, trotz seines Auslegens der Schrift, eindrücklich vermittelt. Die Offenbarung Jesu geschieht erst durch das Zeichen des Brotbrechens, ein Moment von tiefgreifender Bedeutung und überraschender Wendung.
Synchrone Zugangsweise: Dieser Abschnitt analysiert die Emmaus-Erzählung im Kontext des Lukasevangeliums. Die Abgrenzung des Textes von anderen Abschnitten des Lukasevangeliums wird genau untersucht, insbesondere die Verbindung zur vorherigen Auferstehungsgeschichte und der anschließenden Erscheinung vor den Jüngern in Jerusalem. Die Kontextanalyse beleuchtet Lukas' Ziel, eine "wohlgeordnete Gestalt" der Heilsgeschichte zu schaffen, in der die Emmaus-Erzählung als integraler Bestandteil des erzählerischen Höhepunktes – der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu – fungiert. Die Gliederung des Kapitels nach Bovon wird präsentiert, um die narrative Struktur der Emmaus-Erzählung zu verdeutlichen: Einleitung, Umrahmung des Hauptteils (Dialog zwischen Jesus und Jüngern), und Schluss, jeweils mit einer detaillierten Analyse der jeweiligen Abschnitte.
Diachrone Beobachtungen: Dieser Teil befasst sich mit der Entstehung und Überlieferung der Emmaus-Erzählung. Er untersucht den ältesten erhaltenen Textzeugen und die Zeit der Abfassung des Lukasevangeliums, wobei der Bezug zu anderen Evangelien, insbesondere Markus, und die Zeugnisse von Justin dem Märtyrer herangezogen werden. Lukas' eigene Aussagen im Proömium über die sorgfältige Erkundung der Überlieferung werden berücksichtigt. Die Entstehungsgeschichte des Textes wird so umfassend wie möglich beleuchtet, ohne dabei spekulativ zu werden.
Schlüsselwörter
Lukasevangelium, Emmaus-Erzählung, Auferstehung Jesu, Bibelinterpretation, Narratologie, Kontextanalyse, Diachronie, Synchronie, Forschungsgeschichte, Theologische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen zur Emmaus-Erzählung im Lukasevangelium
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Emmaus-Erzählung im Lukasevangelium sowohl synchron (im Kontext des Lukasevangeliums) als auch diachron (in Bezug auf ihre Entstehung und Rezeption). Ziel ist es, die Aussageintention der Erzählung zu beleuchten und verschiedene Forschungsperspektiven zu berücksichtigen.
Welche Aspekte werden in der synchronen Analyse betrachtet?
Die synchrone Analyse umfasst die Abgrenzung des Textes von anderen Abschnitten des Lukasevangeliums, die Kontextanalyse (insbesondere die Verbindung zur vorherigen Auferstehungsgeschichte und der anschließenden Erscheinung in Jerusalem), die Gliederung der Erzählung nach Bovon (Einleitung, Hauptteil, Schluss) und die Untersuchung von Lukas' Ziel, eine "wohlgeordnete Gestalt" der Heilsgeschichte zu schaffen.
Was beinhaltet die diachrone Analyse der Emmaus-Erzählung?
Die diachrone Analyse untersucht den ältesten erhaltenen Textzeugen, die Zeit der Abfassung des Lukasevangeliums, den Bezug zu anderen Evangelien (besonders Markus), Zeugnisse von Justin dem Märtyrer und Lukas' eigene Aussagen im Proömium über seine sorgfältige Erkundung der Überlieferung. Ziel ist eine umfassende Beleuchtung der Entstehungsgeschichte, ohne Spekulationen.
Welche Forschungsperspektiven werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf drei zentrale Forschungsthesen: Rudolf Bultmann (Auferstehungsgeschichte mit ältestem Gehalt), Piet Schoonenberg (Ausdruck eines neuen Auferstehungsglaubens) und J.-N. Aletti (Emmausepisode als Zusammenfassung des Evangeliums).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen ersten Leseeindruck, eine synchrone und eine diachrone Zugangsweise sowie die Darstellung von drei Forschungsthesen zum Sachverhalt. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lukasevangelium, Emmaus-Erzählung, Auferstehung Jesu, Bibelinterpretation, Narratologie, Kontextanalyse, Diachronie, Synchronie, Forschungsgeschichte, Theologische Interpretation.
Was ist der zentrale Fokus des ersten Leseeindrucks?
Der erste Leseeindruck beschreibt die Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus und hebt den geheimnisvollen Charakter der Begegnung und die Bedeutung des Brotbrechens hervor.
Welche theologischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den theologischen Gehalt der Emmaus-Erzählung im Kontext des Lukasevangeliums und ihre Bedeutung für das Verständnis der Auferstehung Jesu.
Welche narrativen Aspekte werden untersucht?
Die narrative Struktur der Emmaus-Erzählung und die Analyse der einzelnen Abschnitte (Einleitung, Hauptteil, Schluss) nach Bovon stehen im Mittelpunkt der narratologischen Betrachtung.
Welche historische Einordnung der Emmaus-Erzählung findet statt?
Die historische Einordnung betrachtet den ältesten Textzeugen, die Abfassungszeit und die Entstehungsgeschichte im Kontext der damaligen Überlieferung und der Aussagen anderer Evangelien.
- Quote paper
- Valerie Schmidt (Author), 2014, Die Begegnung der Emmausjünger mit dem Auferstandenen im Lukasevangelium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381296