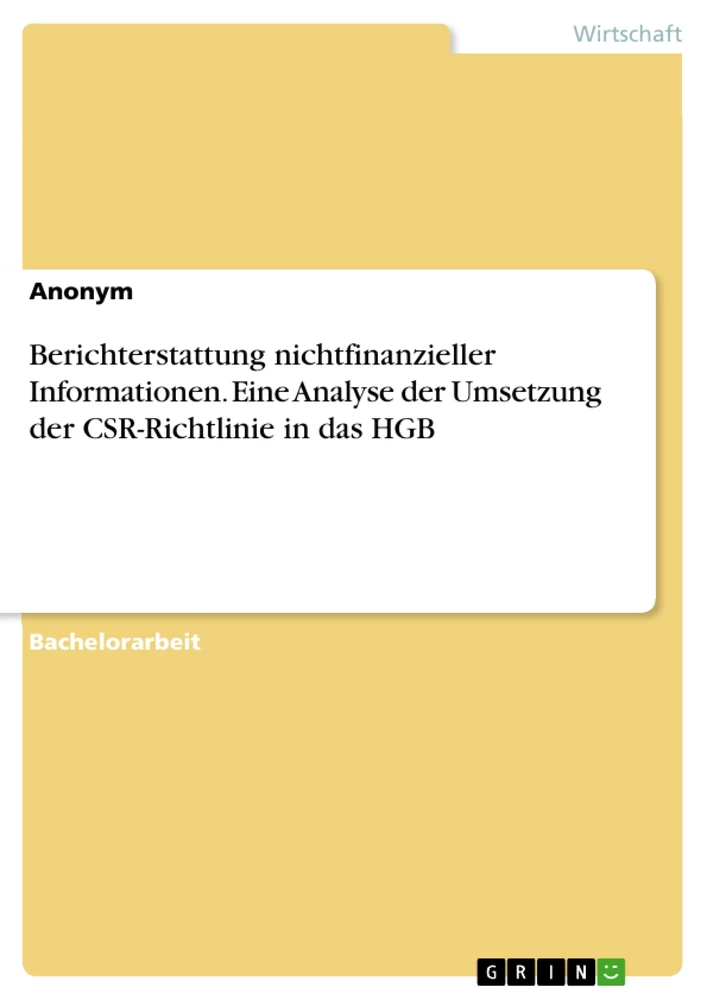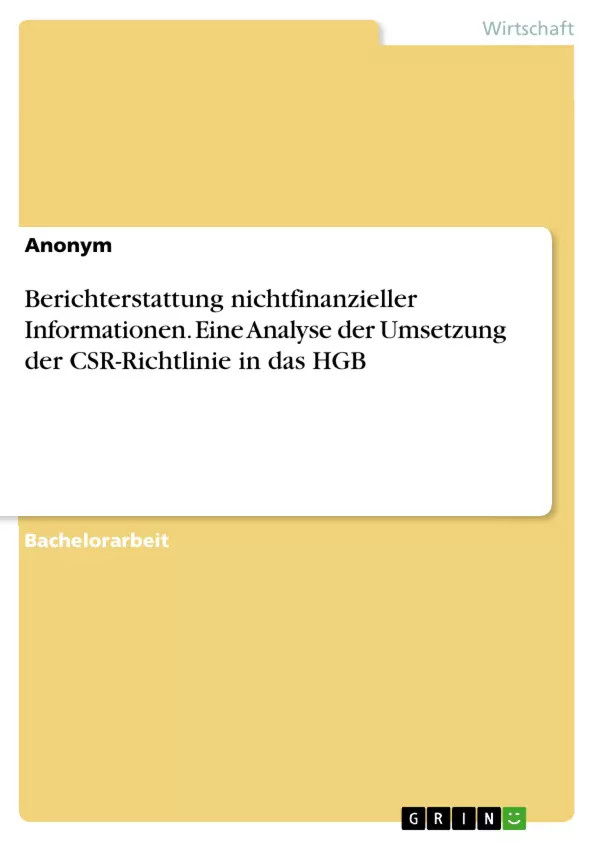Die Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung der von der EU veröffentlichten CSR-Richtlinie 2014/95/EU in das deutsche HGB und analysiert den Regierungsentwurf "CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz" des Gesetzgebers. Für eine kritische Beurteilung einer Umsetzung wurden Stellungnahmen verschiedener Institutionen diesbezüglich herangezogen. Ferner soll anhand von aktuellen Beispielen aufgezeigt werden, wie eine mögliche Anwendung in der Berichterstattung aussehen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung und Motivation
- 2 CSR Berichterstattungspflicht
- 2.1 Entwicklung der regulierten CSR-Berichterstattung
- 2.2 CSR-Richtlinie 2014/95/EU und ihre Zielsetzung
- 2.3 Die wichtigsten Änderungen durch die CSR-Richtlinie
- 2.4 Freiwillige anerkannte Rahmenwerke
- 2.4.1 Global Reporting Initiative
- 2.4.2 Deutscher Nachhaltigkeitskodex
- 3 Umsetzung der CSR-Richtlinie in Deutschland
- 3.1 Gesetzgebungsverfahren
- 3.2 Bestehende Vorschriften in Deutschland zur Berichterstattung
- 3.3 Analyse des Gesetzesvorschlages der Bundesregierung
- 3.3.1 Kreis der betroffenen Unternehmen
- 3.3.2 Inhalt der nichtfinanziellen Erklärung
- 3.3.3 Ort der nichtfinanziellen Erklärung
- 3.3.4 Prüfung der nichtfinanziellen Erklärung
- 4 Exemplarische Anwendung des Regierungsentwurfes
- 4.1 Anwendungsempfehlung der neuen Vorschriften in der Praxis
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Berichterstattungspflicht von Unternehmen hinsichtlich nichtfinanzieller Informationen, die durch die CSR-Richtlinie 2014/95/EU eingeführt wurde. Ziel ist es, die Entwicklung der regulierten CSR-Berichterstattung zu analysieren, die wichtigsten Änderungen der Richtlinie zu beleuchten und die Umsetzung in Deutschland zu untersuchen.
- Entwicklung der regulierten CSR-Berichterstattung
- CSR-Richtlinie 2014/95/EU und ihre Zielsetzung
- Umsetzung der CSR-Richtlinie in Deutschland
- Analyse des Gesetzesvorschlages der Bundesregierung
- Exemplarische Anwendung des Regierungsentwurfes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Motivation für die Arbeit dar, die durch die steigende Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR) und die wachsende Bedeutung von nichtfinanziellen Informationen für Unternehmen und Stakeholder begründet wird. Kapitel 2 befasst sich mit der CSR-Berichterstattungspflicht, beleuchtet die Entwicklung der regulierten CSR-Berichterstattung und erklärt die CSR-Richtlinie 2014/95/EU sowie ihre Zielsetzung. Kapitel 3 analysiert die Umsetzung der CSR-Richtlinie in Deutschland, beleuchtet die bestehenden Vorschriften zur Berichterstattung und untersucht den Gesetzesvorschlag der Bundesregierung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der CSR-Berichterstattung, insbesondere der CSR-Richtlinie 2014/95/EU, den nichtfinanziellen Informationen, der Umsetzung in Deutschland und den Auswirkungen auf Unternehmen. Weitere relevante Begriffe sind Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung, Stakeholder, Stakeholderengagement, Transparenz und Regulierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die CSR-Richtlinie 2014/95/EU?
Dies ist eine EU-Richtlinie, die große Unternehmen dazu verpflichtet, über nichtfinanzielle Aspekte wie Umweltbelange, Arbeitnehmerfragen, Sozialbelange und Korruptionsbekämpfung zu berichten.
Welche Unternehmen sind von der Berichtspflicht im HGB betroffen?
Betroffen sind in der Regel große, kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen mit mehr als 500 Mitarbeitern.
Was muss eine „nichtfinanzielle Erklärung“ enthalten?
Sie muss Angaben zu den oben genannten Belangen enthalten, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen seiner Tätigkeit erforderlich sind.
Welche freiwilligen Rahmenwerke können genutzt werden?
Unternehmen können sich bei der Berichterstattung an anerkannten Standards wie der Global Reporting Initiative (GRI) oder dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) orientieren.
Wird die nichtfinanzielle Erklärung geprüft?
Der Aufsichtsrat ist zur inhaltlichen Prüfung verpflichtet. Der Abschlussprüfer prüft in der Regel nur, ob die Erklärung vorgelegt wurde, es sei denn, es wurde eine freiwillige inhaltliche Prüfung beauftragt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Berichterstattung nichtfinanzieller Informationen. Eine Analyse der Umsetzung der CSR-Richtlinie in das HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381432