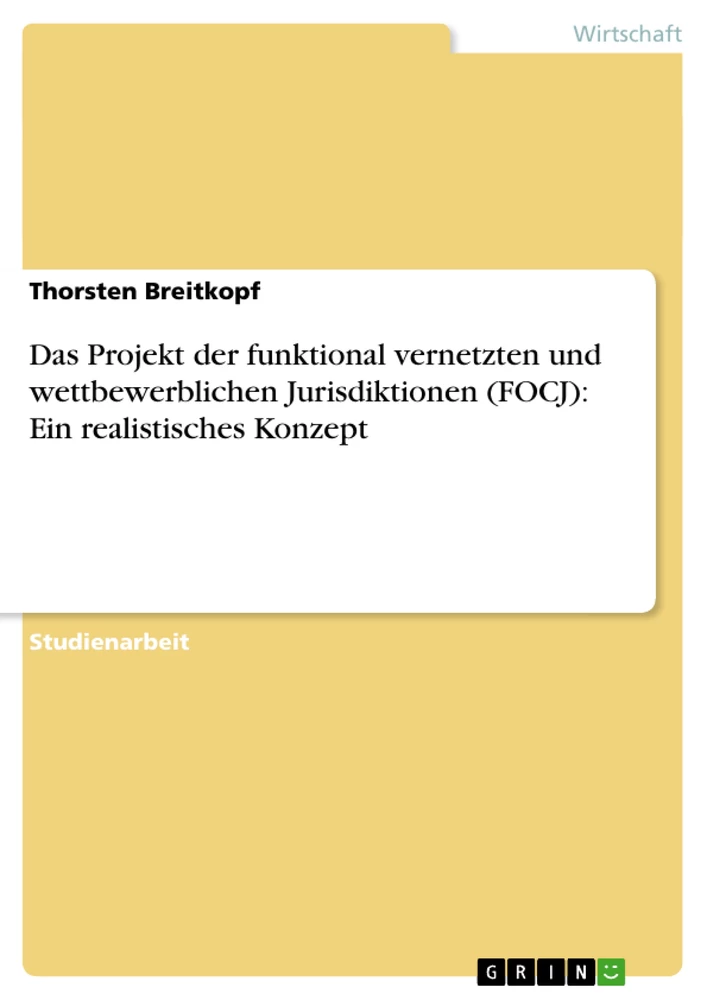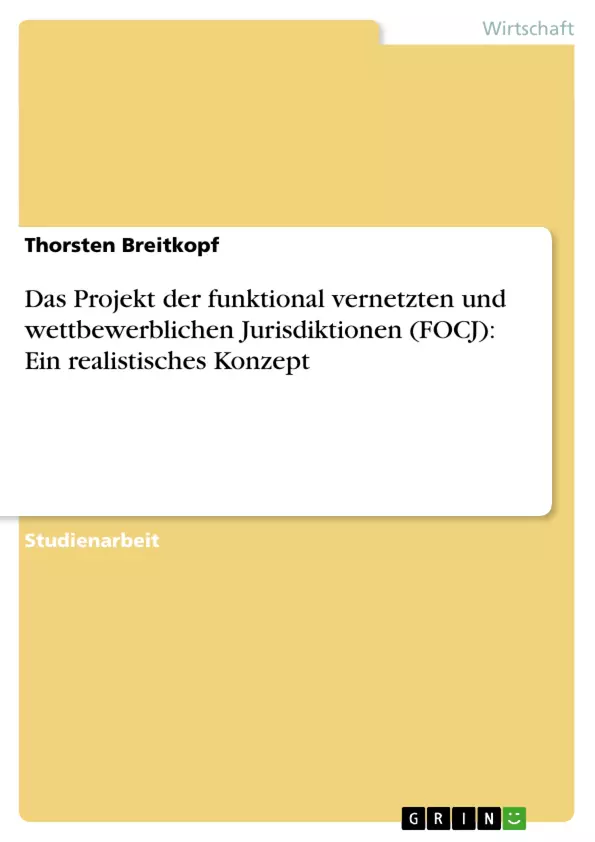Einführung
Functional Overlapping Competing Jurisdictions (FOCJ) ist ein vom Schweizer Wissenschaftler Bruno S. Frey kreierter Begriff. Frey ist Universitätsprofessor für Ökonomie an der Universität Zürich (CH).
Die EU, insbesondere Staaten wie Deutschland oder die Schweiz, weist einen formal föderalistischen Aufbau auf. Frey geht mit seiner speziellen Föderalismus-Theorie entschieden weiter als alle bestehenden staatlichen föderalen Gebilde. Statt einer vertikalen und vor allem territorialen Aufteilung der einzelnen öffentlichen Körperschaften schlägt Frey eine Aufteilung in Körperschaften mit verschiedenen spezialisierten Funktionalitäten vor. Ein sogenannter FOCUS (per Definition der Singular für FOCJ) ist nur für eine öffentliche Aufgabe zuständig, hierauf aber stark spezialisiert. Ferner kann er diese Aufgabe „überlappend“, also Kantons- oder Ländergrenzen übergreifend anbieten, und vor allem auch die gleichen Territorien abdecken wie andere FOCJ, eventuell auch solche mit gleichen Funktionalitäten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Problemstellung und Gang der Untersuchung
- 2. Die Idee der funktionalen, überlappenden, wettbewerblichen Jurisdiktionen (FOCJ)
- 2.1 Was sind FOCJ?
- 2.2 FOCJ sind funktional
- 2.3 FOCJ sind überlappend
- 2.4 FOCJ sind wettbewerblich
- 2.5 FOCJ - Körperschaften mit Steuerhoheit und Zwangsgewalt
- 3. Ist der Ansatz der FOCJ ein realistisches Konzept?
- 3.1 Hohe Transaktionskosten bei Ein- und Austritt
- 3.2 Akzeptanz von FOCJ in gewachsenen und nationalstaatlich geprägten Strukturen
- 3.3 Mangelnde Koordinationsmechanismen zwischen den FOCJ
- 3.4 Das Problem der Judikative bei FOCJ
- 3.5 FOCJ und der Föderalismus der Europäischen Union in ihrer heutigen Erscheinung
- 4. Fazit: FOCJ – Utopie oder Chance?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Realisierbarkeit des Konzepts der funktionalen, überlappenden und wettbewerblichen Jurisdiktionen (FOCJ) als alternatives föderalistisches Modell. Die Arbeit analysiert, ob FOCJ ein praktikables Konzept für bestehende staatliche Strukturen darstellen oder eher einer Utopie gleichen. Die Übertragbarkeit auf bestehende Systeme wie die Europäische Union wird kritisch hinterfragt.
- Der Vergleich von FOCJ mit bestehenden föderalen Systemen.
- Die Analyse der ökonomischen Effizienz von FOCJ.
- Die Herausforderungen bei der Implementierung von FOCJ in Bezug auf Transaktionskosten und Akzeptanz.
- Die Rolle der Koordinationsmechanismen und der Judikative im FOCJ-Modell.
- Die Anwendbarkeit des FOCJ-Konzepts auf die Europäische Union.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Konzept der Functional Overlapping Competing Jurisdictions (FOCJ) ein, entwickelt von Bruno S. Frey. Sie stellt den Unterschied zwischen dem traditionellen föderalen Aufbau und dem FOCJ-Modell heraus, welches eine funktionale statt territorialer Aufteilung öffentlicher Aufgaben vorsieht. Die Problemstellung der Arbeit wird definiert: die Untersuchung der Realisierbarkeit von FOCJ in bestehenden politischen Systemen. Der Gang der Untersuchung wird skizziert, wobei die Kapitelüberschriften die Struktur der Analyse vorwegnehmen.
2. Die Idee der funktionalen, überlappenden, wettbewerblichen Jurisdiktionen (FOCJ): Dieses Kapitel erläutert das Kernkonzept der FOCJ. Es werden die zentralen Merkmale – Funktionalität, Überlappung und Wettbewerb – detailliert beschrieben. Die FOCJ werden als öffentliche Körperschaften mit Steuerhoheit und Zwangsgewalt charakterisiert, die Bürgern die freie Wahl zwischen verschiedenen Anbietern öffentlicher Dienstleistungen ermöglichen. Im Gegensatz zu traditionellen Gebietskörperschaften fokussieren FOCJ auf spezifische Aufgaben und streben durch Wettbewerb eine effizientere und bürgernähere Dienstleistungserbringung an.
3. Ist der Ansatz der FOCJ ein realistisches Konzept?: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen und kritischen Punkte des FOCJ-Konzepts. Es werden potenzielle Probleme wie hohe Transaktionskosten beim Ein- und Austritt von FOCJ, die Akzeptanz in etablierten politischen Systemen, mangelnde Koordinationsmechanismen zwischen verschiedenen FOCJ, und die Rolle der Judikative diskutiert. Der Bezug zum föderalen System der Europäischen Union wird hergestellt, um die praktische Umsetzbarkeit des Modells zu beleuchten.
Schlüsselwörter
FOCJ, funktionaler Föderalismus, Wettbewerb, Überlappung, Jurisdiktionen, Dezentralisierung, öffentliche Dienstleistungen, Steuerhoheit, Zwangsgewalt, Transaktionskosten, Europäische Union, föderale Strukturen, ökonomische Effizienz.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Funktionale, Überlappende, Wettbewerbsfähige Jurisdiktionen (FOCJ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Realisierbarkeit des Konzepts der funktionalen, überlappenden und wettbewerblichen Jurisdiktionen (FOCJ) als alternatives föderalistisches Modell. Sie analysiert, ob FOCJ ein praktikables Konzept für bestehende staatliche Strukturen darstellen oder eher einer Utopie gleichen. Die Übertragbarkeit auf bestehende Systeme wie die Europäische Union wird kritisch hinterfragt.
Was sind funktionale, überlappende, wettbewerbsfähige Jurisdiktionen (FOCJ)?
FOCJ sind öffentliche Körperschaften mit Steuerhoheit und Zwangsgewalt. Im Gegensatz zu traditionellen Gebietskörperschaften fokussieren sie auf spezifische Aufgaben und streben durch Wettbewerb eine effizientere und bürgernähere Dienstleistungserbringung an. Ihre zentralen Merkmale sind Funktionalität, Überlappung und Wettbewerb. Bürger haben die freie Wahl zwischen verschiedenen Anbietern öffentlicher Dienstleistungen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich von FOCJ mit bestehenden föderalen Systemen; Analyse der ökonomischen Effizienz von FOCJ; Herausforderungen bei der Implementierung von FOCJ (Transaktionskosten und Akzeptanz); Rolle der Koordinationsmechanismen und der Judikative im FOCJ-Modell; Anwendbarkeit des FOCJ-Konzepts auf die Europäische Union.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit FOCJ diskutiert?
Die Arbeit diskutiert potenzielle Probleme wie hohe Transaktionskosten beim Ein- und Austritt von FOCJ, die Akzeptanz in etablierten politischen Systemen, mangelnde Koordinationsmechanismen zwischen verschiedenen FOCJ und die Rolle der Judikative. Die praktische Umsetzbarkeit des Modells wird anhand des föderalen Systems der Europäischen Union beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht, ob das FOCJ-Konzept eine realistische Alternative zu bestehenden föderalen Modellen darstellt oder eher eine Utopie bleibt. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detaillierte Einblicke in die Argumentation und Analyse der einzelnen Aspekte des FOCJ-Konzepts. Das Fazit bewertet die Chancen und Risiken des Modells.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Seminararbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: FOCJ, funktionaler Föderalismus, Wettbewerb, Überlappung, Jurisdiktionen, Dezentralisierung, öffentliche Dienstleistungen, Steuerhoheit, Zwangsgewalt, Transaktionskosten, Europäische Union, föderale Strukturen, ökonomische Effizienz.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung (Einführung und Problemstellung), Die Idee der FOCJ (Erläuterung des Kernkonzepts), Ist der Ansatz der FOCJ ein realistisches Konzept? (Analyse der Herausforderungen), und Fazit: FOCJ – Utopie oder Chance? (Zusammenfassung und Bewertung).
- Citation du texte
- Thorsten Breitkopf (Auteur), 2004, Das Projekt der funktional vernetzten und wettbewerblichen Jurisdiktionen (FOCJ): Ein realistisches Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38176