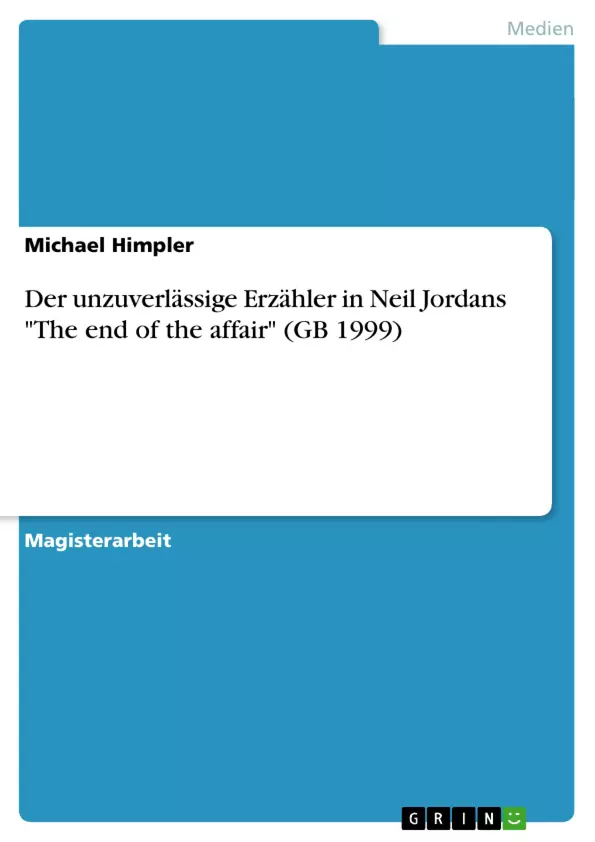Seit mehr als 40 Jahren stellt der Begriff des "unreliable narrator" eine wichtige Kategorie in der Erzählanalyse dar. In einschlägigen Lexika der narratologischen Terminologie, in propädeutischen Handbüchern und in zahlreichen erzähltheoretischen Studien finden sich Definitionen des Begriffs ‚unreliable narration‘, doch mangelt es abgesehen von vielen Aufsätzen zu einzelnen Autoren und Romanen an fundierten Studien zur Theorie, Praxis und Geschichte des ‚unglaubwürdigen Erzählens‘.
Die unzuverlässige Erzählinstanz führt in die Irre und fordert den Rezipienten zu einem Spiel auf: Zum Spiel mit der Täuschung und mit der Hinterfragung der eigenen Wahrnehmung. Dieser nimmt die Herausforderung bereitwillig an. Für die Literatur funktioniert dies ebenso wie für die Leinwand. Daher erfreuen sich die Kinofilme und nicht zuletzt auch die TV-Produktionen großer Beliebtheit, die unzuverlässiges Bildmaterial einsetzen.
Die Fragen, die das Gebiet des unzuverlässigen Erzählens aufwirft, sind sowohl in der Film- als auch in der Literaturwissenschaft trotz mannigfaltiger Essays und Publikationen zum Thema noch nicht klar beantwortet worden. So gibt nach wie vor noch keine detaillierten und systematischen Aussagen darüber, warum ein Rezipient die Erzählinstanzen gewisser Texte als unzuverlässig einstuft.
Daher befasst sich diese Magisterarbeit mit der systematischen Zusammenstellung des aktuellen theoretischen Diskussionsstandes und seiner Anwendbarkeit auf den Film:
• Was bedeutet ‚unzuverlässiges Erzählen‘?
• Welche Kriterien liegen dem zugrunde?
• Auf welcher Grundlage wird ein Unverlässlichkeits¬urteil gefällt?
• Welche medienspezifischen Charakteristika lassen sich kategorisieren?
• Inwiefern unterscheiden sich die einzelnen theoretischen Ansätze?
Die Arbeit ist in einen theoretischen Vorbau und eine detaillierte Filmanalyse gegliedert. Ausgehend vom methodologischen Ansatz Gérard Genettes, stelle ich den Stand der Literaturtheorie zum unzuverlässigen Erzählen unter Rückbezug auf Wayne Booth sowie Seymour Chatman und deren Kritiker wie Nünning et al. dar. Anschließend folgt ein Vergleich zur Anwendbarkeit auf den Film (unter besonderer Berücksichtigung des "Voice-Over"), der durch einen Exkurs zur neoformalistischen Filmanalyse ergänzt wird.
Schließlich exemplifiziere ich die herausgearbeiteten Resultate anhand einer Detailanalyse des Spielfilms THE END OF THE AFFAIR (GB 1999, Neil Jordan).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Terminus des „unzuverlässigen Erzählers“
- 2.1. Grundbegriffe der Narrationstheorie
- 2.2. Der,,unreliable narrator“ in der Literaturwissenschaft
- 2.3. Die Verbindung zum Film ......
- 3. Filmisches Erzählen: Der unzuverlässige Erzähler im Film
- 3.1. Exkurs: Neoformalistische Filmanalyse .....
- 3.2. Pro und kontra filmischer Erzähler: Voice-Over als Fingierung personalen Erzählens
- 3.3. Unzuverlässigkeit im Film.....
- 3.4. Vorläufiges Fazit
- 4. Analyse: THE END OF THE AFFAIR
- 4.1. Einleitung..\li>
- 4.2. Inhaltliche Täuschungen..\li>
- 4.2.1. Das Voice-Over
- 4.2.2. Doppelstrukturen...
- 4.2.3. Multiperspektivität.
- 4.2.4. Spiegelsymbolik......
- 4.2.5. Täuschende Protagonisten
- 4.3. Formale Täuschungen...
- 4.3.1. Zeitkonstruktionen
- 4.3.2. Die Filmmusik.
- 4.4. Zusammenfassende Analyse: „To be is to be perceived“.
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit dem Phänomen des „unzuverlässigen Erzählers“ im Film, wobei sie insbesondere dessen Anwendung in Neil Jordans THE END OF THE AFFAIR (GB 1999) untersucht. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den theoretischen Diskussionsstand zum unzuverlässigen Erzählen zusammenzustellen und dessen Anwendbarkeit auf den Film zu beleuchten. Dabei werden die wichtigsten Kriterien, die zur Einordnung einer Erzählinstanz als unzuverlässig führen, sowie die medienspezifischen Charakteristika des unzuverlässigen Erzählens im Film untersucht.
- Der „unzuverlässige Erzähler“ als theoretisches Konzept in der Literatur- und Filmwissenschaft
- Die Kriterien für die Einordnung einer Erzählinstanz als unzuverlässig
- Die Rolle des Voice-Over im Film und dessen Bedeutung für die Konstruktion von Unzuverlässigkeit
- Die medienspezifischen Charakteristika des unzuverlässigen Erzählens im Film
- Die Anwendung des „unzuverlässigen Erzählers“ in THE END OF THE AFFAIR (GB 1999, Neil Jordan)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Begriff des „unzuverlässigen Erzählers“ und seinem Stellenwert in der Erzählanalyse. Sie stellt die wichtigsten Definitionen und Kriterien für die Einordnung einer Erzählinstanz als unzuverlässig vor. Anschließend erfolgt ein Exkurs in die neoformalistische Filmanalyse, um die spezifischen Merkmale des filmischen Erzählens und die Rolle des Rezipienten in diesem Prozess zu beleuchten.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse des unzuverlässigen Erzählens im Film, wobei der Schwerpunkt auf dem Voice-Over als Mittel zur Konstruktion von Unzuverlässigkeit liegt. Es werden die Unterschiede zwischen homodiegetischen und heterodiegetischen Erzählpositionen sowie die Möglichkeiten der multiperspektivischen Anordnung von Erzählerpositionen untersucht.
Das vierte Kapitel analysiert schließlich THE END OF THE AFFAIR (GB 1999) unter dem Aspekt des unzuverlässigen Erzählens. Es werden die in der Filmanalyse gewonnenen Erkenntnisse auf den Film angewendet, um die einzelnen Elemente des Films, wie das Voice-Over, die Doppelstrukturen, die Multiperspektivität und die Spiegelsymbolik, in ihrer Funktion als Mittel zur Konstruktion von Unzuverlässigkeit zu untersuchen.
Die Arbeit endet mit einem Ausblick, der weiterführende Fragen zur Theorie und Praxis des unzuverlässigen Erzählens im Film aufwirft.
Schlüsselwörter
Unzuverlässiger Erzähler, Erzähltheorie, Filmtheorie, Voice-Over, Multiperspektivität, Filmanalyse, THE END OF THE AFFAIR (GB 1999), Neil Jordan, homodiegetischer Erzähler, heterodiegetischer Erzähler, Täuschung, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein unzuverlässiger Erzähler?
Ein "unreliable narrator" ist eine Erzählinstanz, die den Rezipienten durch Täuschung oder Fehlinterpretation der Ereignisse in die Irre führt.
Welcher Film wird in dieser Analyse untersucht?
Die Arbeit analysiert den Spielfilm "THE END OF THE AFFAIR" (1999) von Regisseur Neil Jordan.
Welche Rolle spielt das Voice-Over für die Unzuverlässigkeit im Film?
Das Voice-Over dient als Mittel zur Fingierung eines personalen Erzählens und kann genutzt werden, um subjektive Wahrheiten als Fakten darzustellen.
Welche formalen Täuschungen werden im Film analysiert?
Untersucht werden Zeitkonstruktionen, Multiperspektivität, Spiegelsymbolik und der gezielte Einsatz von Filmmusik.
Auf welchen Theoretikern basiert die Arbeit?
Die Analyse stützt sich auf Gérard Genette, Wayne Booth und Seymour Chatman sowie auf Ansätze der neoformalistischen Filmanalyse.
- Citation du texte
- Michael Himpler (Auteur), 2004, Der unzuverlässige Erzähler in Neil Jordans "The end of the affair" (GB 1999), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38254