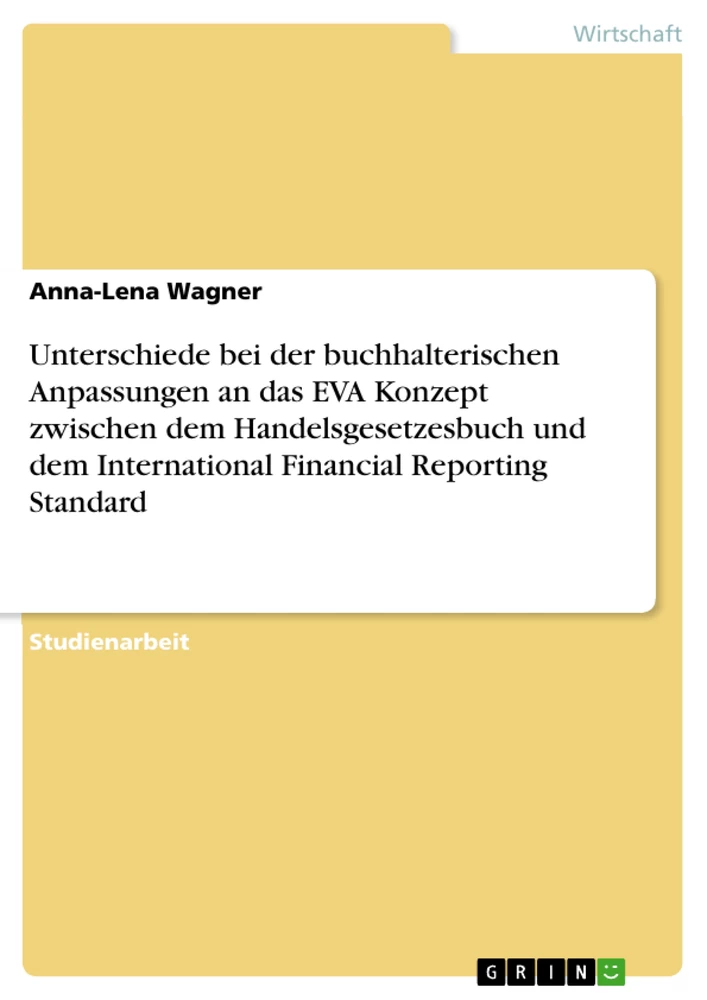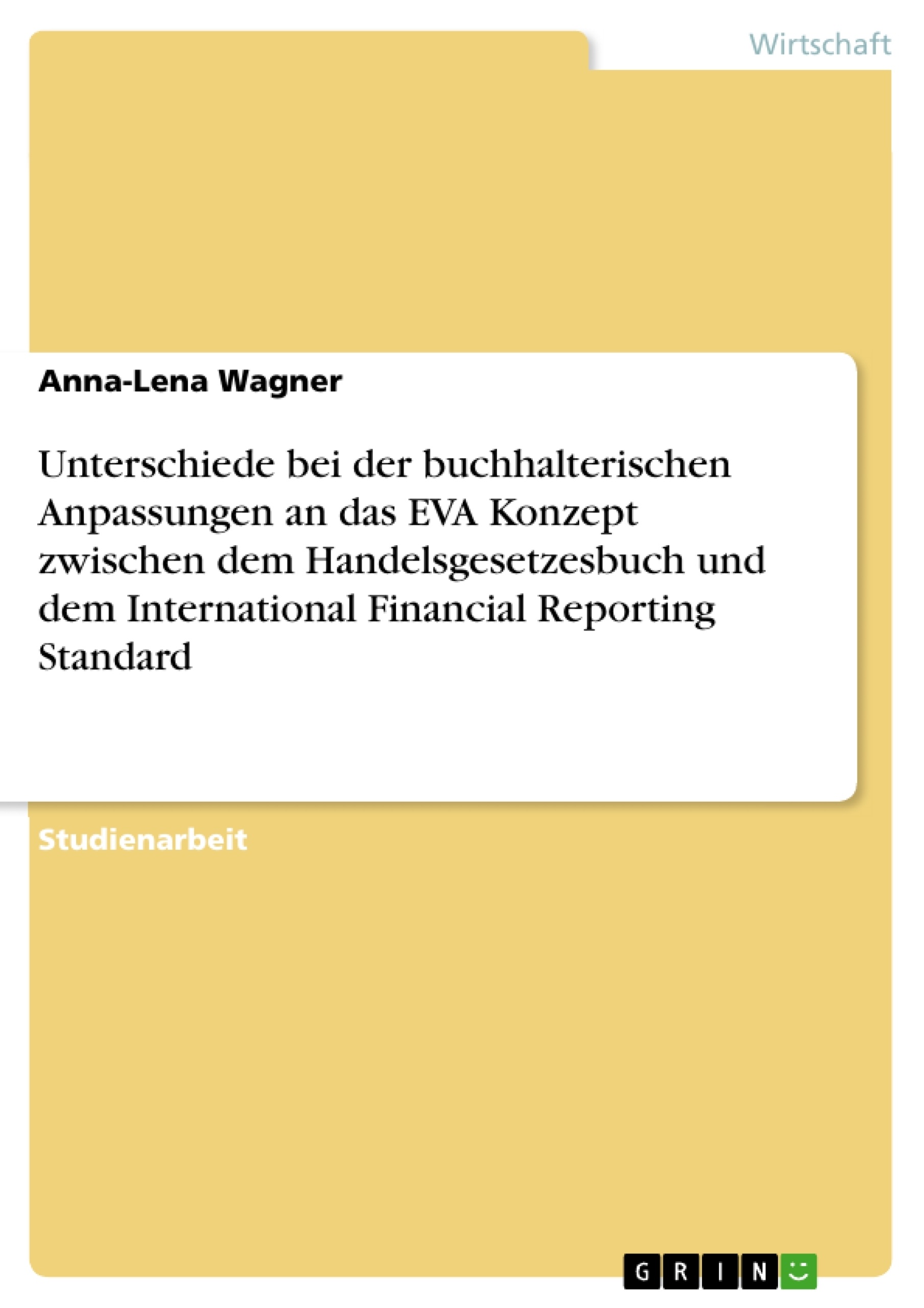Wertorientierte Ansätze und wertsteigende Unternehmensbewertung erlangen immer mehr Bedeutung. Wertorientierte Kennzahlen können die Grundlage für wesentliche Entscheidungen innerhalb des Unternehmens darstellen. Neben ihrer Funktion als Steuerungs- und Bewertungsinstrument, werden ebenfalls die Zinsansprüche der Eigenkapitalgeber berücksichtigt. Umsatzwachstum, hohe Marktanteile und Technologieführerschaft sind nur wenige von vielen Bestreben heutiger Unternehmen. Diese Zielsetzungen spiegeln allerdings nicht wider, ob das Unternehmen für die Aktionäre wertsteigernd oder wertmindernd ist.
Aufgrund der Globalisierung von Wettbewerb und Kapitalmärkten sollte sich die Unternehmensbewertung vermehrt auf ihre Investoren ausrichten. Diese Orientierung nennt man den Shareholder Value (SHV) Ansatz. Dabei steht eher die Marktwertmaximierung der Aktien als die Maximierung der Gewinne im Fokus der Betrachtung. Die Wichtigkeit der Shareholder-Value-Orientierung wird dabei nicht nur für große Kapitalgesellschaften betont. Insbesondere nicht-börsennotierte Unternehmen sollten auch die eigenen Shareholder vermehrt im Blickwinkel behalten.
Dies folgt der Tatsache, dass private Unternehmen vermehrt Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung haben. Die Unternehmen, die ihr Führungs- und Kontrollsystem auf nachhaltige Wertsteigerung und effiziente Kapitalnutzung ausrichten, werden zukünftig erfolgreicher bei der Beschaffung von Kapital sein. Zur Berechnung von repräsentativen Unternehmenswerten existieren heute bereits mehrere wertorientierte Ansätze.
Das hauptsächliche Problem der Jahresabschlüsse stellt im Wesentlichen die beschränkte Aussagekraft dar. Diese entsteht durch die Nutzung verschiedener Bilanzierungswahlrechte und Bewertungsmethoden. Außerdem wird der Jahresabschluss, abhängig vom jeweiligen Land, nach verschieden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Darunter fallen beispielsweise die IFRS (International Financial Reporting Standard) und HGB (Handelsgesetzesbuch) Rechnungslegungsvorschriften. Zwischen diesen Rechnungslegungsvorschriften bestehen allerdings erhebliche Differenzen, die zu verzerrten Ergebnissen führen können. Durch die Wahl verschiedener Rechnungslegungsstandards sind folglich unterschiedliche Anpassungen des Jahresabschlusses an die wertorientierten Kennzahlen erforderlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Grundlagen des Economic Value Added
- Wesen des Economic Value Added
- Berechnung des Economic Value Added
- Die Unterschiede der buchhalterischen Anpassungen im EVA- Konzept zwischen HGB und IFRS
- Operating Conversions
- Unterschiede zwischen HGB und IFRS bei den Operating Conversions
- Funding Conversions
- Unterschiede zwischen HGB und IFRS bei den Funding Conversions
- Shareholder Conversions
- Unterschiede zwischen HGB und IFRS bei den Shareholder Conversions
- Tax Conversions
- Unterschiede zwischen HGB und IFRS bei den Tax Conversions
- Zusammenfassung
- Kritische Reflexion der eigenen Ergebnisse
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der wertorientierten Kennzahl „Economic Value Added“ (EVA) und untersucht die Unterschiede in der Anpassung des EVA-Konzepts an Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS. Dabei soll die Bedeutung der wertorientierten Unternehmensbewertung und die Problematik der beschränkten Aussagekraft von Jahresabschlüssen aufgrund von Bilanzierungswahlrechten und Bewertungsmethoden beleuchtet werden.
- Wertorientierter Ansatz zur Unternehmensbewertung
- Das Konzept des Economic Value Added (EVA)
- Unterschiede in der Anpassung des EVA-Konzepts zwischen HGB und IFRS
- Analyse von Operating, Funding, Shareholder und Tax Conversions
- Kritische Reflexion der Ergebnisse und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der beschränkten Aussagekraft von Jahresabschlüssen aufgrund unterschiedlicher Rechnungslegungsstandards dar und führt in die Bedeutung der wertorientierten Unternehmensbewertung ein. Sie erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit, die sich mit dem Economic Value Added (EVA) und den Anpassungen des EVA-Konzepts an HGB und IFRS auseinandersetzt.
- Grundlagen des Economic Value Added: Dieses Kapitel definiert das Wesen des EVA und erklärt die Berechnung der Kennzahl.
- Die Unterschiede der buchhalterischen Anpassungen im EVA-Konzept zwischen HGB und IFRS: Das dritte Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Anpassungen, die im EVA-Konzept bei Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS erforderlich sind. Es analysiert verschiedene Kategorien von Anpassungen, die sogenannten „Conversions“ (Konversionen), und beleuchtet die Unterschiede zwischen den beiden Rechnungslegungsstandards in Bezug auf Operating Conversions, Funding Conversions, Shareholder Conversions und Tax Conversions.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themenbereiche wie wertorientierte Unternehmensbewertung, Economic Value Added (EVA), Rechnungslegung nach HGB und IFRS, buchhalterische Anpassungen, Operating Conversions, Funding Conversions, Shareholder Conversions, Tax Conversions, Shareholder Value (SHV), Bilanzierungswahlrechte, Bewertungsmethoden, Jahresabschluss, Kapitalbeschaffung und Unternehmenssteuerung.
- Quote paper
- Anna-Lena Wagner (Author), 2017, Unterschiede bei der buchhalterischen Anpassungen an das EVA Konzept zwischen dem Handelsgesetzesbuch und dem International Financial Reporting Standard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382688