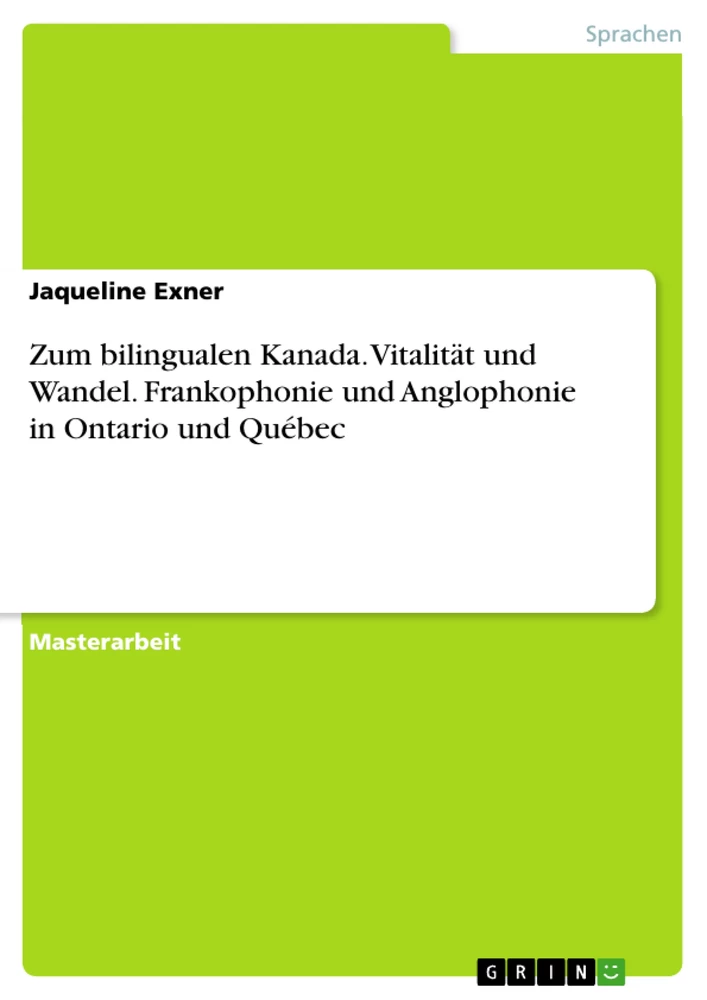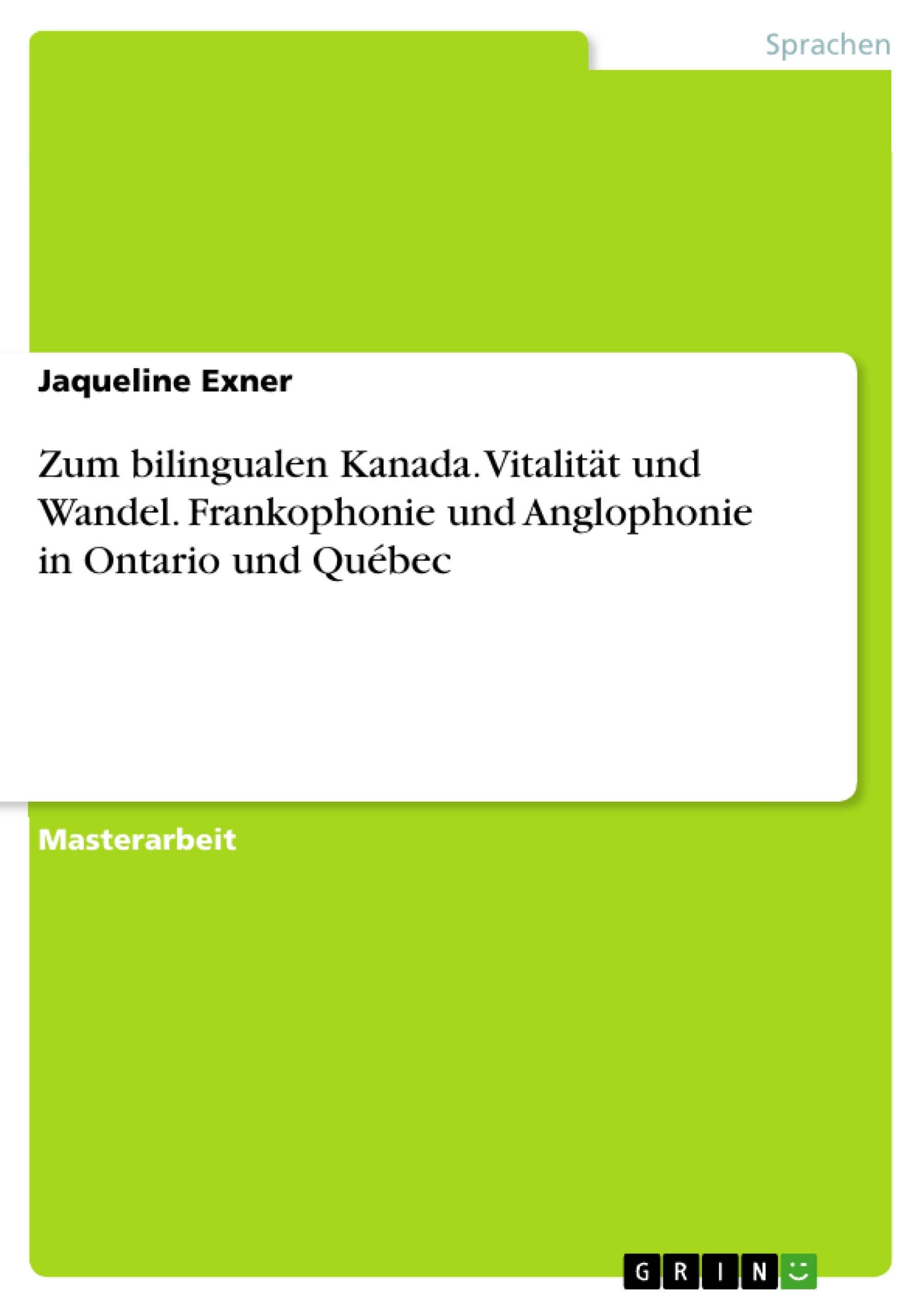In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Phänomen der Vitalität in Verbindung mit kontaktinduziertem Sprachwandel. Diese linguistische Relation soll am Beispiel Kanadas genauer untersucht werden. Im Speziellen werden die Provinzen Ontario und Québec betrachtet, indem der frankophone Status in Ontario sowie der anglophone Status in Québec, nicht nur im Sinne des Ansehens, sondern auch die Implementierung der Sprache in der jeweiligen Provinz betreffend, erörtert und schließlich mögliche Sprachwandelphänomene diskutiert und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sprachsituation
- 2.1 Bilingualismus
- 2.2 Diglossie
- 2.3 Vitalität
- 3 Historisches Portrait Kanadas
- 3.1 Geschichte: Zur Entdeckung und Besiedlung Kanadas bis 1763
- 3.2 Sprachpolitik
- 3.3 Religion, Erziehung und Bildung
- 3.4 Demolinguistische Entwicklung
- 4 Sprachgebrauch
- 4.1 Ontario und seine frankophone Gesellschaft
- 4.2 Québec und seine anglophone Gesellschaft
- 4.3 Quantitativer Vergleich der Provinzen
- 5 Eigenschaften und Besonderheiten der Sprache
- 5.1 Das "Ontarian" english
- 5.2 Das Français québécois
- 6 Kontaktinduzierter Sprachwandel
- 6.1 Einfluss Ontarios auf seine frankophone Gesellschaft
- 6.1.1 Morphosyntax
- 6.1.2 Lexikon
- 6.2 Einfluss Québecs auf seine anglophone Gesellschaft
- 6.2.1 Morphosyntax
- 6.2.2 Lexikon
- 6.1 Einfluss Ontarios auf seine frankophone Gesellschaft
- 7 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit dem bilingualen Kanada und untersucht die Vitalität und den Wandel der frankophonen und anglophonen Sprachgemeinschaften in Ontario und Québec. Die Arbeit analysiert die historischen und aktuellen Sprachsituationen, die Sprachpolitik, den Sprachgebrauch sowie die sprachlichen Besonderheiten in den beiden Provinzen.
- Bilingualismus und Diglossie in Kanada
- Historische Entwicklung und Sprachpolitik in Ontario und Québec
- Sprachgebrauch und -vitalität der frankophonen und anglophonen Gemeinschaften
- Eigenschaften und Besonderheiten des "Ontarian" english und des Français québécois
- Kontaktinduzierter Sprachwandel in den beiden Provinzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung – Einführung in das Thema und die Forschungsfrage.
- Kapitel 2: Sprachsituation – Beschreibung des Bilingualismus, der Diglossie und der Vitalität in Kanada.
- Kapitel 3: Historisches Portrait Kanadas – Überblick über die Geschichte, Sprachpolitik, Religion und Demolinguistische Entwicklung des Landes.
- Kapitel 4: Sprachgebrauch – Analyse des Sprachgebrauchs in Ontario und Québec, einschließlich eines quantitativen Vergleichs der beiden Provinzen.
- Kapitel 5: Eigenschaften und Besonderheiten der Sprache – Untersuchung des "Ontarian" english und des Français québécois.
- Kapitel 6: Kontaktinduzierter Sprachwandel – Analyse der Einflüsse der beiden Sprachgemeinschaften aufeinander.
- Kapitel 7: Diskussion – Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Bilingualismus, Diglossie, Sprachvitalität, Kanada, Ontario, Québec, Frankophonie, Anglophonie, "Ontarian" english, Français québécois, Kontaktinduzierter Sprachwandel, Sprachpolitik, Demolinguistik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "Vitalität" einer Sprache?
Sprachvitalität bezeichnet die Überlebensfähigkeit und Stärke einer Sprachgemeinschaft in einem multilingualen Kontext, beeinflusst durch Demographie, Status und institutionelle Unterstützung.
Wie unterscheidet sich die Sprachsituation in Ontario und Québec?
In Ontario ist Englisch dominant, während die frankophone Minderheit um ihre Vitalität kämpft. In Québec ist Französisch die Hauptsprache, und die anglophone Minderheit unterliegt spezifischen sprachpolitischen Einflüssen.
Was ist "kontaktinduzierter Sprachwandel"?
Es handelt sich um Veränderungen in einer Sprache (z. B. im Lexikon oder der Grammatik), die durch den engen Kontakt mit einer anderen Sprache entstehen, wie etwa Anglizismen im Französischen Ontarios.
Was sind die Merkmale des "Français québécois"?
Das Québec-Französisch weist Besonderheiten in der Aussprache, im Wortschatz (Archaismen und Neologismen) und in der Syntax auf, die es vom europäischen Französisch unterscheiden.
Welche Rolle spielt die kanadische Sprachpolitik?
Die Arbeit beleuchtet Gesetze zum Bilingualismus und wie Provinzen durch Erziehung, Bildung und Gesetzgebung versuchen, die jeweilige Minderheiten- oder Mehrheitssprache zu schützen.
- Citar trabajo
- Jaqueline Exner (Autor), 2017, Zum bilingualen Kanada. Vitalität und Wandel. Frankophonie und Anglophonie in Ontario und Québec, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382991