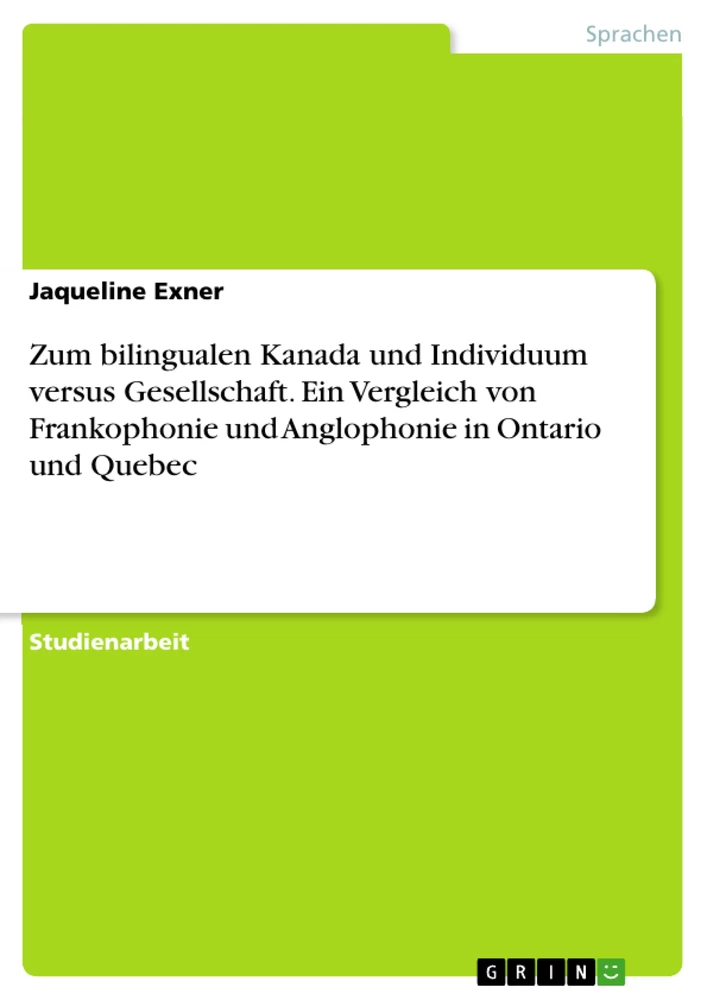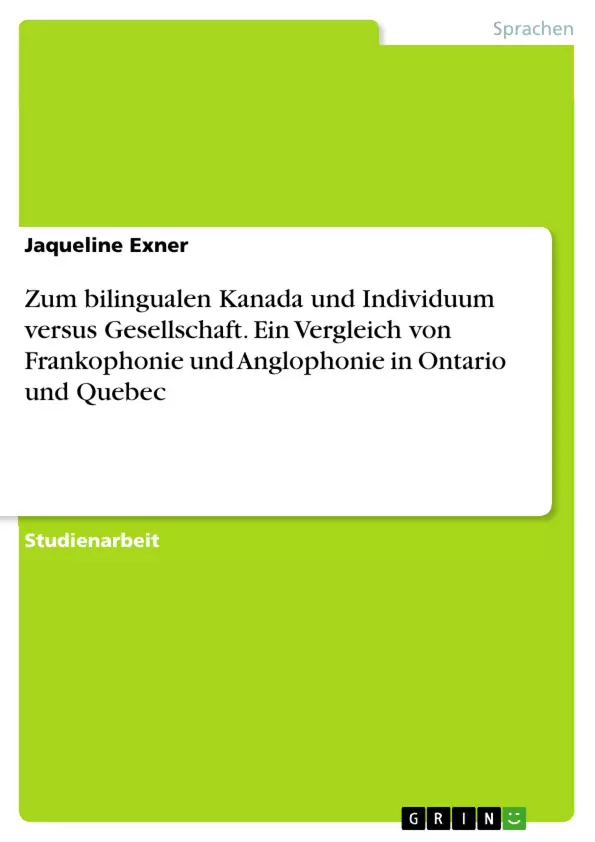In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Phänomen einer Diglossie in Verbindung mit parallel auftretendem Bilingualismus. Diese linguistischen Charakterzüge sollen am Beispiel Kanadas genauer untersucht werden. Im Speziellen werden die Provinzen Ontario und Quebec betrachtet, indem der frankophone Status in Ontario sowie der anglophone Status in Quebec erörtert werden. Im Mittelpunkt stehen einerseits wichtige Kennzahlen, wie Sprecherzahlen oder Geburtenraten sowie die Familiensprache, sprich die verwendete Sprache zu Hause. Andererseits wird mithilfe von traditionellen Medien versucht, die funktionalen Differenzierungen der Sprachen beider Provinzen und die damit verbundene Beziehung von Diglossie und Bilingualismus ausfindig zu machen. Die Konzentration liegt hier auf Medien, wie Zeitung, Radio und Fernsehen.
Zunächst muss der Begriff Diglossie umfassend behandelt werden. Hierfür wird die Theorie von Charles A. Ferguson herangezogen, der erstmals den Begriff Diglossie 1959 zu definieren versuchte. Die Definition von Bilingualismus ist kein gesonderter Punkt dieser Arbeit. Fortan wird der Terminus basierend auf dem primären Datenlieferanten Statistics Canada verwendet.
Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, wie diese beiden Phänomene zueinander im Verhältnis stehen. Treten beide Merkmale einer Gesellschaft stets zusammen auf? Setzt gar das eine das andere voraus? Dies soll mithilfe von Joshua A. Fishman untersucht werden. Der dritte Abschnitt dieser Arbeit befasst sich unmittelbar mit der Sprachsituation in Kanada. Aus soziohistorischer Sicht wird hier ein Einblick in die Ausbreitung, Entwicklung und Integrierung des Englischen und Französischen gegeben. Als nächstes folgt die Untersuchung der frankophonen „Compagnie“ in Ontario sowie der anglophonen “Community” in Quebec. Für diese Gegenüberstellung werden Daten und Fakten aus dem Census behandelt sowie analysiert und daneben konventionelle Nachrichten- beziehungsweise Informationsträger herangezogen. Darüber hinaus wird dem Aspekt der Familiensprache eine wesentliche Gewichtung, zum Zwecke des kontrastiven Vergleichs, zugestanden.
Schließlich gibt es eine Eingliederung der Fallbeispiele in die Theorie, welche zugleich die vorherigen Analysen beider Provinzen zusammenfassend und kontrastiv darstellt, um final eine mögliche Diglossiesituation in den Provinzen aufdecken und ein Fazit formulieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Diglossie
- 2.1 Fergusons Ansatz 1959;[2006]
- 2.2 Fishmans Ansatz 1967; [2006]
- 3. Sprachsituation in Kanada
- 3.1 Ontario und seine frankophone Gesellschaft
- 3.2 Quebec und seine anglophone Gesellschaft
- 4. Diskussion
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Diglossie im Kontext des bilingualen Kanadas, mit besonderem Fokus auf die Provinzen Ontario und Quebec. Sie analysiert den frankophonen Status in Ontario und den anglophonen Status in Quebec, indem sie wichtige Kennzahlen wie Sprecherzahlen, Geburtenraten und Familiensprachen untersucht. Die Arbeit beleuchtet auch die funktionalen Differenzierungen der Sprachen beider Provinzen und ihre Beziehung zu Diglossie und Bilingualismus anhand von traditionellen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen.
- Die Definition und Charakteristika von Diglossie nach Ferguson und Fishman
- Die sprachliche Situation in Kanada und die historische Entwicklung von Englisch und Französisch
- Der kontrastive Vergleich der frankophonen Gesellschaft in Ontario und der anglophonen Gesellschaft in Quebec
- Die Rolle von Familiensprache und Medien im Kontext der Diglossie
- Die Analyse von Daten und Fakten aus dem Census sowie traditionellen Nachrichten- und Informationsträgern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Zielsetzung der Arbeit sowie die zu untersuchenden Bereiche vor. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Diglossie anhand der Theorie von Charles A. Ferguson definiert, wobei die Unterscheidung zwischen High-Variety (H) und Low-Variety (L) erläutert wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Sprachsituation in Kanada und gibt einen soziohistorischen Einblick in die Ausbreitung und Entwicklung von Englisch und Französisch. Es analysiert anschließend die frankophone Gesellschaft in Ontario und die anglophone Gesellschaft in Quebec, indem es Daten und Fakten aus dem Census sowie traditionelle Medien betrachtet. Abschließend werden die Fallbeispiele in die Theorie eingegliedert und eine mögliche Diglossiesituation in den Provinzen analysiert.
Schlüsselwörter
Diglossie, Bilingualismus, Kanada, Ontario, Quebec, Frankophonie, Anglophonie, Familiensprache, Medien, Census, Sprachsituation, Sprachentwicklung, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Diglossie und Bilingualismus?
Bilingualismus bezieht sich auf die individuelle Fähigkeit, zwei Sprachen zu sprechen. Diglossie beschreibt eine gesellschaftliche Situation, in der zwei Sprachen (oder Varietäten) unterschiedliche soziale Funktionen (High und Low) erfüllen.
Wie wird die Sprachsituation in Quebec analysiert?
Die Arbeit untersucht den Status der anglophonen Minderheit in der mehrheitlich frankophonen Provinz Quebec anhand von Sprecherzahlen, Familiensprache und Mediennutzung.
Welche Rolle spielt Ontario im Vergleich zu Quebec?
In Ontario wird die Situation der frankophonen Minderheit betrachtet, um einen kontrastiven Vergleich zur anglophonen Gemeinschaft in Quebec zu ziehen.
Was besagen die Theorien von Ferguson und Fishman zur Diglossie?
Charles Ferguson definierte Diglossie 1959 als funktionale Trennung von H- und L-Varietäten. Joshua Fishman erweiterte das Konzept 1967 auf Situationen mit zwei unterschiedlichen Sprachen.
Welche Datenquellen werden für die Analyse genutzt?
Die Arbeit stützt sich primär auf Daten von Statistics Canada (Census) sowie auf die Analyse traditioneller Medien wie Zeitungen, Radio und Fernsehen.
Was wird unter dem Begriff „Familiensprache“ verstanden?
Die Familiensprache ist die Sprache, die primär zu Hause verwendet wird. Sie dient in der Arbeit als wichtiger Indikator für den Erhalt von Minderheitensprachen in bilingualen Gesellschaften.
- Arbeit zitieren
- Jaqueline Exner (Autor:in), 2015, Zum bilingualen Kanada und Individuum versus Gesellschaft. Ein Vergleich von Frankophonie und Anglophonie in Ontario und Quebec, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383064