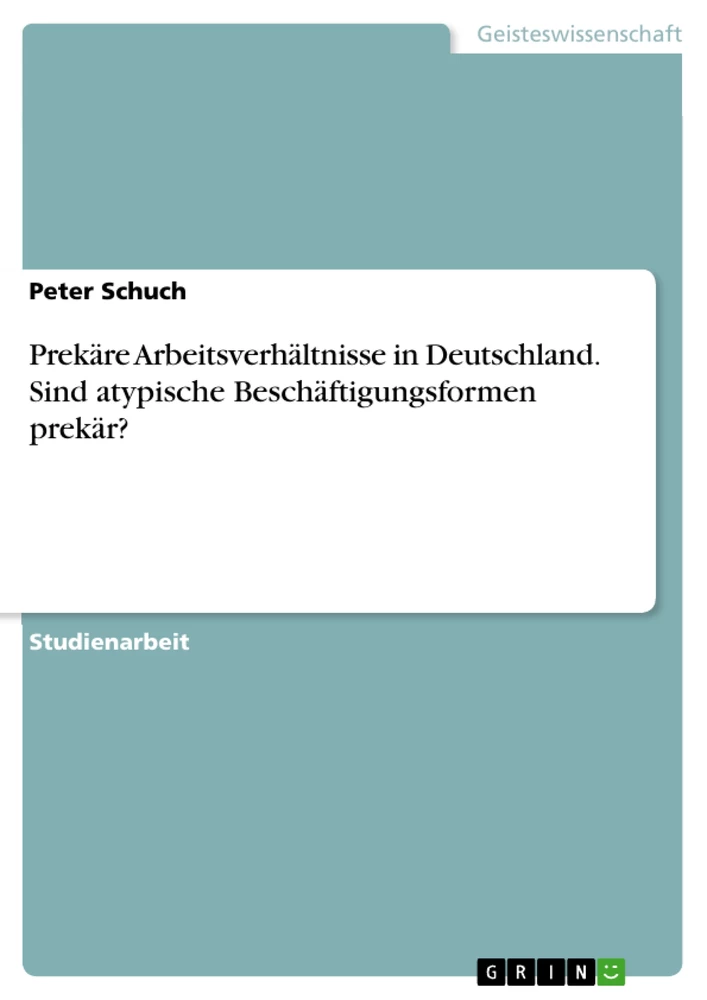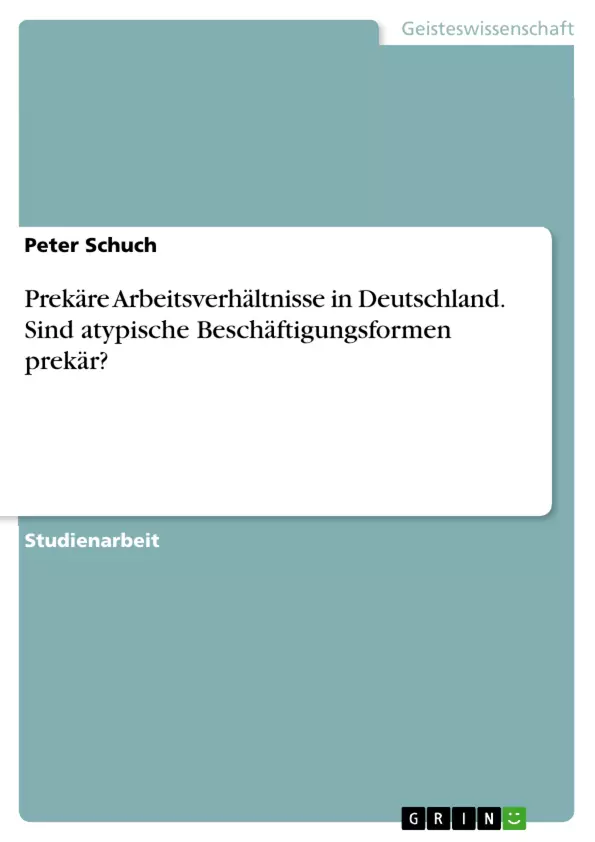In politischen Diskussionen zum Thema Arbeitsmarkt und sozialer Ungleichheit fällt immer wieder der Begriff „Prekarität“. Weit verbreitet besteht dabei der Irrglaube, es würde sich lediglich um unsichere oder schlecht bezahlte Arbeitsplätze handeln. Tatsächlich ist das Themenfeld jedoch in viel größeren Dimensionen angesiedelt, die letztendlich in verschiedenen politischen, aber auch wissenschaftlichen Diskursen münden. Einflussfaktoren für diese Dimensionen sind Globalisierungsprozesse, aber auch die Internationalisierung der Märkte, welche maßgeblich dazu beitragen, den Konkurrenzdruck in der Wirtschaft und somit in den Unternehmen zu erhöhen. Dieser Druck führt zu einem vergrößerten Wettbewerb, bei dem atypische Beschäftigungen in Unternehmen eine immer größere Rolle spielen, um Lohnkosten zu sparen und Auftragsspitzen zu bewältigen.
Um Anfangs ein Verständnis über das weite Themenfeld der Prekarität zu erlangen, ist es zunächst nötig, den Begriff zu erläutern und dazu verschiedene wissenschaftliche Ansätze darzustellen. Durch diese Standortbestimmung der Prekarität ist es dann möglich herauszufinden, welche Formen von prekären Arbeitsverhältnissen bestehen. Zusätzlich werden dabei Probleme, Ursachen und Folgewirkungen erläutert. Diese stehen in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, so dass einerseits theoretisch, aber auch empirisch gearbeitet wird, um nachweisbare Belege in Form von Daten zu verwenden. Nach der Einordnung der Begrifflichkeiten und der ersten kritischen Betrachtung, wird die Frage gestellt, anhand welcher Faktoren Prekarität messbar gemacht werden kann.
Erst nach der Einordnung der Begrifflichkeiten zum Thema Prekarität, der Erläuterung der Formen von atypischer Beschäftigung und dem messbar machen von prekären Indikatoren, wird auf die letztliche Frage der Hausarbeit „Sind atypische Beschäftigungen prekär?“ eingegangen und schlussendlich beantwortet. Abschließend wird ein Fazit aus den Erkenntnissen gezogen und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben, der sich an politischen und strukturellen Entwicklungen orientiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Standortbestimmung der Begriffe Prekäre Beschäftigung, Prekariat und Prekarisierung
- III. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sowie Folgewirkung und Probleme
- a. Teilzeitbeschäftigung
- b. Geringfügige Beschäftigung/ Mini- und Midi-Jobs
- c. Befristete Beschäftigung
- d. Leiharbeit
- e. Soloselbstständigkeit
- f. Werkvertragsbeschäftigung
- IV. Sind atypische Beschäftigungen prekär?
- V. Fazit/Schluss
- VI. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Prekarität im Kontext atypischer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Ziel ist es, die verschiedenen Definitionen von Prekarität zu beleuchten, unterschiedliche Formen atypischer Beschäftigung zu analysieren und die Frage zu beantworten, ob atypische Beschäftigung per se als prekär einzustufen ist. Die Arbeit stützt sich dabei auf verschiedene soziologische und politikwissenschaftliche Ansätze.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Prekarität"
- Analyse verschiedener Formen atypischer Beschäftigung in Deutschland
- Zusammenhang zwischen atypischer Beschäftigung und Prekarität
- Soziologische und politikwissenschaftliche Perspektiven auf Prekarisierung
- Folgen atypischer Beschäftigung für Arbeitnehmer
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das komplexe Thema der Prekarität im deutschen Arbeitsmarkt ein. Sie erläutert die weitreichenden Dimensionen des Themas, die von politischen und wissenschaftlichen Diskursen geprägt sind, und hebt die Rolle der Globalisierung und des erhöhten Wettbewerbs hervor, die zu einem verstärkten Einsatz atypischer Beschäftigungsverhältnisse führen. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik, die zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage verwendet werden.
II. Standortbestimmung der Begriffe Prekäre Beschäftigung, Prekariat und Prekarisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der begrifflichen Klärung von Prekarität und Prekarisierung. Es zeigt die vielschichtigen und sich teilweise widersprechenden Perspektiven verschiedener Disziplinen wie Soziologie und Politikwissenschaft auf. Das Kapitel diskutiert unterschiedliche Ansätze zur Definition von Prekariat und Prekarisierung und beleuchtet die Schwierigkeiten einer eindeutigen und allgemein akzeptierten Begriffsbestimmung. Es werden verschiedene Wissenschaftler und ihre Ansätze vorgestellt, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Besonderes Augenmerk wird auf die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2006 gelegt, die das Prekariat als neue soziale Gruppe etablierte.
III. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sowie Folgewirkung und Probleme: Dieses Kapitel beschreibt und erläutert verschiedene Formen atypischer Beschäftigungsverhältnisse, indem es sie vom Normalarbeitsverhältnis abgrenzt. Es werden Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Soloselbstständigkeit und Werkvertragsbeschäftigung im Detail behandelt, wobei ihre jeweiligen Charakteristika und Abweichungen vom Normalarbeitsverhältnis hervorgehoben werden. Die Kapitel analysiert die Auswirkungen dieser Beschäftigungsformen auf die Arbeitnehmer und zeigt die daraus resultierenden Probleme auf.
Schlüsselwörter
Prekarität, Prekarisierung, Prekariat, atypische Beschäftigung, Deutschland, Arbeitsmarkt, Normalarbeitsverhältnis, Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Soloselbstständigkeit, Werkvertragsbeschäftigung, Soziologie, Politikwissenschaft, Globalisierung, Wettbewerb, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Prekarität und atypische Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Prekarität im Kontext atypischer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Sie analysiert verschiedene Definitionen von Prekarität, verschiedene Formen atypischer Beschäftigung und die Frage, ob atypische Beschäftigung per se als prekär einzustufen ist. Die Arbeit stützt sich auf soziologische und politikwissenschaftliche Ansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung des Begriffs "Prekarität", Analyse verschiedener Formen atypischer Beschäftigung (Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Soloselbstständigkeit, Werkvertragsbeschäftigung), den Zusammenhang zwischen atypischer Beschäftigung und Prekarität, soziologische und politikwissenschaftliche Perspektiven auf Prekarisierung und die Folgen atypischer Beschäftigung für Arbeitnehmer.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einleitung: Einführung in das Thema Prekarität und die Methodik der Arbeit. II. Standortbestimmung der Begriffe: Klärung der Begriffe Prekäre Beschäftigung, Prekariat und Prekarisierung unter Berücksichtigung verschiedener wissenschaftlicher Perspektiven. III. Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Beschreibung und Analyse verschiedener Formen atypischer Beschäftigung und deren Auswirkungen auf Arbeitnehmer. IV. Sind atypische Beschäftigungen prekär?: Beantwortung der zentralen Forschungsfrage. V. Fazit/Schluss: Zusammenfassung der Ergebnisse. VI. Literatur- und Quellenverzeichnis: Auflistung der verwendeten Literatur und Quellen.
Welche konkreten Arten atypischer Beschäftigung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende Arten atypischer Beschäftigung: Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung (Mini- und Midi-Jobs), befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Soloselbstständigkeit und Werkvertragsbeschäftigung.
Welche wissenschaftlichen Perspektiven werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt soziologische und politikwissenschaftliche Perspektiven auf Prekarität und Prekarisierung. Sie bezieht sich auf verschiedene Wissenschaftler und ihre Ansätze zur Definition und Erklärung dieser Begriffe.
Welche zentrale Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob atypische Beschäftigung per se als prekär einzustufen ist.
Welche Bedeutung hat die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2006?
Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2006 wird als ein wichtiger Beitrag zur Etablierung des Prekariats als neue soziale Gruppe diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Prekarität, Prekarisierung, Prekariat, atypische Beschäftigung, Deutschland, Arbeitsmarkt, Normalarbeitsverhältnis, Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Soloselbstständigkeit, Werkvertragsbeschäftigung, Soziologie, Politikwissenschaft, Globalisierung, Wettbewerb, soziale Ungleichheit.
- Arbeit zitieren
- Peter Schuch (Autor:in), 2017, Prekäre Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Sind atypische Beschäftigungsformen prekär?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383122