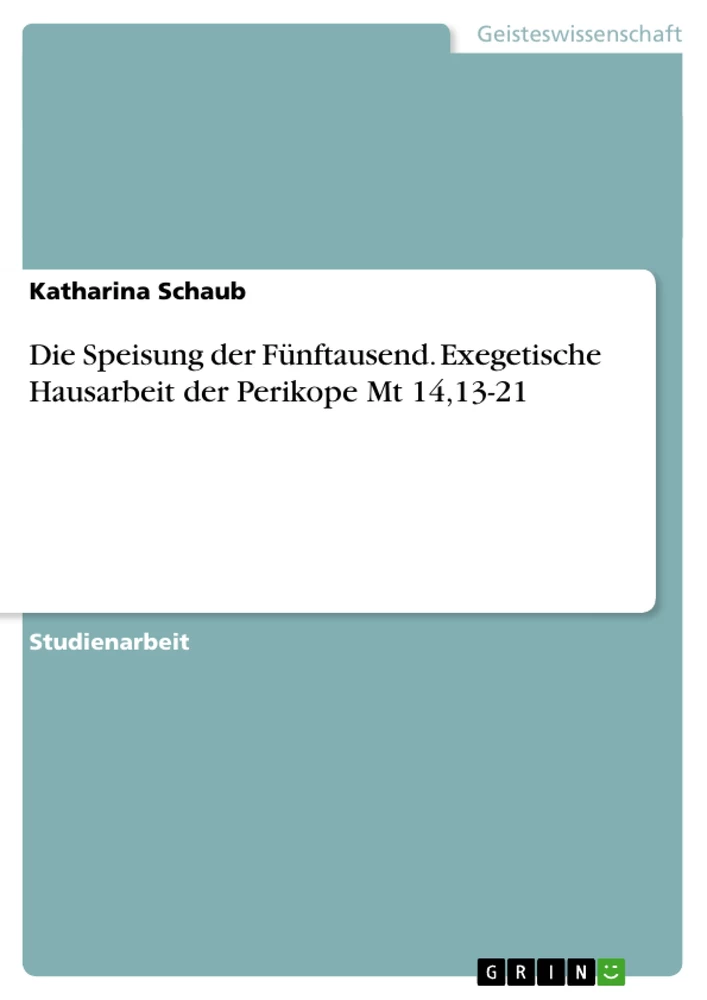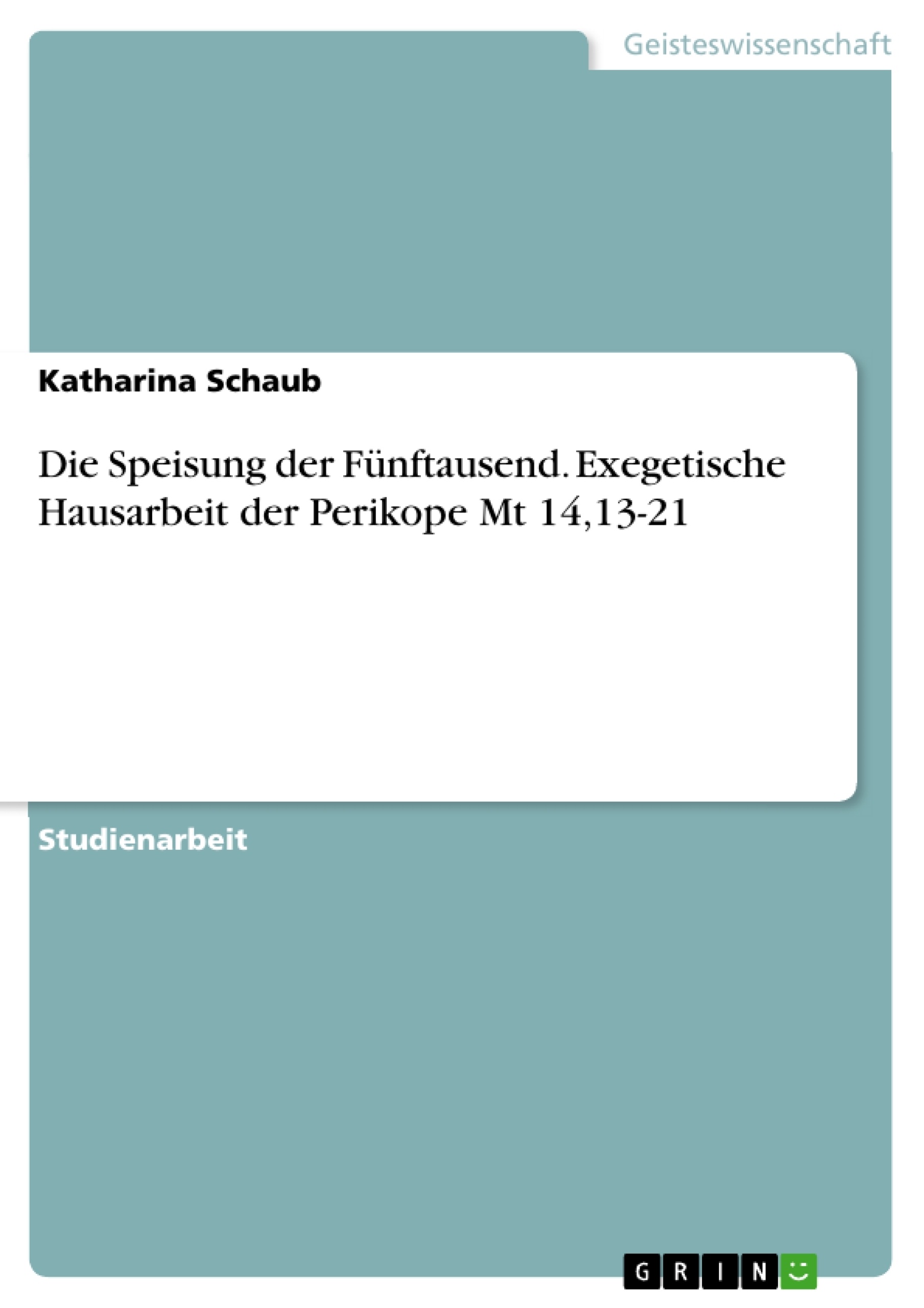Für meine exegetische Hausarbeit habe ich mir die Speisung der Fünftausend im Matthäusevangelium ausgesucht. Die Geschichte gehört zu den Wundererzählungen des Neuen Testamentes. Schon immer fand ich die Wundergeschichten spannend und fragte mich früher im Kindergottesdienst und Schule oft, ob diese wirklich passiert sind. Ich überlegte, was mit diesen wohl gezeigt oder bewirkt werden soll. Später wusste ich, dass diese Geschichten symbolisch zu verstehen sind. Beim ersten Lesen viel mir sofort auf, dass zu den fünftausend Männern bei Matthäus noch Frauen und Kinder kommen. Ich überlegte, ob Matthäus dies mit Absicht hinzugefügt, und ob er vielleicht sogar eine „frauenfeindliche“ Meinung hat, d.h. ob die Frauen bei ihm nicht so viel zählen wie die Männer. Auch wunderte mich die Zahl der Brote und Fische. Hat es eine bestimmte Bedeutung, dass von fünf Broten und zwei Fischen die Rede ist? Und warum greift Matthäus die Fische später nicht mehr auf? Nach der Speisung werden die Brotstücke von den Jüngern eingesammelt. Es bleiben zwölf Körbe übrig. Hat auch diese Zahl eine bestimmte Bedeutung in der Geschichte? Weiter fragte ich mich, warum Matthäus vor der Speisung noch den Aspekt des Heilens aufgreift. Hat dieser eine bestimmte Auswirkung auf den weiteren Verlauf oder ist diese kurze Erzählung der Heilungen nur eingeschoben, um die Wundertaten Jesu zu unterstreichen? In meiner Exegese werde ich das Buch Methodenlehre im Neuen Testament von W. Egger verwenden und mich an seinen Methodenschritten orientieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der Text
- 2.1 Vergleich von Übersetzungen
- 2.2 Begründung der Übersetzungswahl
- 2.3 Textgeschichtliche Problematik
- 3. Abgrenzung des Textes als Perikope
- 4. Die Analyse der Perikope
- 4.1 Syntaktisch-narrative Analyse des Textes
- 4.1.1 Analyse der Handlungssequenzen
- 4.1.2 Analyse der Handlungsträger
- 4.1.2.1 Gliederanalyse nach aktivem Subjekt & Situationssubjekt
- 4.1.2.2 Das Aktantenmodell nach Greimas
- 4.1.2.3 Modell der Interaktion
- 4.1.2.4 Analyse der Gesamtstruktur nach V. Propp
- 4.2 Semantische Analyse des Textes
- 4.2.1 Textsemantik
- 4.2.1.1 Erstellung eines semantischen Inventars
- 4.2.1.1.1 Bedeutungsverwandte Wörter/Lexeme
- 4.2.1.1.2 Semantische Oppositionen
- 4.2.1.1.3 Semiotische Vierecke
- 4.2.1.2 Begriffserklärung
- 4.2.1.1 Erstellung eines semantischen Inventars
- 4.2.1 Textsemantik
- 4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4.1 Syntaktisch-narrative Analyse des Textes
- 5. Analyse der Funktionen der Perikope im unmittelbaren Kontext
- 6. Analyse der Funktionen der Perikope im Makrotext
- 6.1 Das Matthäusevangelium
- 7. Intertextualität
- 7.1 Neues Testament
- 7.1.1 Vergleich mit Joh 6, 1-14
- 7.1.2 Vergleich mit Mt 15, 32-38
- 7.1.3 Ähnlichkeiten mit Mt 26, 26
- 7.2 Altes Testament und antikes Judentum
- 7.3 Sozio-ökonomische, kultur-anthropologische Einbettung
- 7.1 Neues Testament
- 8. Der Text unter diachroner Betrachtung (Der synoptische Vergleich)
- 8.1 Redaktionskritik
- 8.1.1 Das Modell der Textentstehung
- 8.1.2 Zusammenhang der synoptischen Texte
- 8.1.3 Redaktionskritische Analyse
- 8.2 Wirkungskritik
- 8.1 Redaktionskritik
- 9. Textpragmatische Erwägungen
- 9.1 Intention des Autors
- 9.2 Position des Autors
- 9.3 LeserInnenlenkung
- 9.4 Kirchengeschichtliche Wirkungen der Perikope
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist eine kritische Exegese der Perikope Mt 14,13-21, der Speisung der Fünftausend. Die Arbeit untersucht den Text unter verschiedenen methodischen Ansätzen, um seine Bedeutung und Funktion im Kontext des Matthäusevangeliums zu verstehen.
- Analyse der narrativen Struktur und der Handlungsträger
- Semantische Untersuchung der Schlüsselbegriffe und ihrer Beziehungen
- Intertextuelle Bezüge zu anderen Stellen im Neuen Testament und im Alten Testament
- Einbettung des Textes in den sozio-ökonomischen und kultur-anthropologischen Kontext
- Redaktionskritische und wirkungskritische Betrachtung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit untersucht die Perikope Mt 14,13-21, die Speisung der Fünftausend, ausgehend von der Fragestellung nach der symbolischen Bedeutung des Wunders und der Rolle von Frauen im Bericht. Es werden verschiedene Forschungsfragen formuliert, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die methodische Vorgehensweise orientiert sich an W. Egger, Methodenlehre im Neuen Testament.
2. Der Text: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Übersetzungen der Perikope und begründet die Wahl der verwendeten Übersetzung. Es werden textgeschichtliche Probleme angesprochen, die den Umgang mit dem Text beeinflussen. Dies legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Analyse.
3. Abgrenzung des Textes als Perikope: Hier wird die gewählte Perikope abgegrenzt und ihre narrative Einheit im Kontext des Matthäus Evangeliums erläutert, was für die weitere Analyse wesentlich ist. Der Fokus liegt auf der Bestimmung der erzählerischen Grenzen und deren Bedeutung für das Verständnis des Textes.
4. Die Analyse der Perikope: In diesem Kapitel wird eine detaillierte syntaktisch-narrative und semantische Analyse der Perikope durchgeführt. Es werden verschiedene methodische Ansätze wie die Handlungssequenzanalyse, das Aktantenmodell nach Greimas und die Analyse nach V. Propp angewendet, um die Struktur und die Bedeutung des Textes zu erschließen. Die semantische Analyse beinhaltet die Erstellung eines semantischen Inventars, die Untersuchung bedeutungsverwandter Wörter und semantischer Oppositionen sowie die Konstruktion semiotischer Vierecke. Die Ergebnisse dieser Analysen werden zusammengefasst.
5. Analyse der Funktionen der Perikope im unmittelbaren Kontext: Dieses Kapitel untersucht die Funktion der Perikope innerhalb ihres unmittelbaren Kontextes im Matthäusevangelium. Die Analyse beleuchtet den Zusammenhang mit den umgebenden Versen und Kapiteln und wie die Perikope zur Gesamtgeschichte beiträgt. Die Bedeutung und Rolle des Wunderberichtes im Erzählfluss werden hier erörtert.
6. Analyse der Funktionen der Perikope im Makrotext: Dieses Kapitel widmet sich der Funktion der Perikope im gesamten Matthäusevangelium. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Textes innerhalb der Gesamtkomposition des Evangeliums und seiner Beziehung zu anderen wichtigen Themen und Motiven. Es wird untersucht, wie die Speisung der Fünftausend zum Verständnis des Matthäusevangeliums beiträgt und wie sie in das Gesamtbild eingepasst werden kann.
7. Intertextualität: Hier wird die Perikope mit parallelen Texten aus dem Johannesevangelium und anderen Stellen im Matthäusevangelium verglichen. Auch intertextuelle Bezüge zum Alten Testament und zum antiken Judentum werden untersucht. Die Bedeutung von Ähnlichkeiten und Unterschieden im Kontext der Überlieferung wird erörtert.
8. Der Text unter diachroner Betrachtung (Der synoptische Vergleich): Dieses Kapitel widmet sich der synoptischen Perspektive, untersucht die Entstehung des Textes und die verschiedenen Überlieferungsstränge. Redaktionskritische und wirkungskritische Ansätze werden angewendet, um den Text in seiner historischen Entwicklung zu verstehen.
9. Textpragmatische Erwägungen: Dieses Kapitel analysiert die Intention des Autors, seine Position und die Leserlenkung im Text. Die kirchengeschichtliche Wirkung der Perikope wird ebenfalls beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Kommunikation zwischen Autor und Leser und den daraus resultierenden Implikationen.
Schlüsselwörter
Matthäusevangelium, Speisung der Fünftausend, Wundererzählung, syntaktisch-narrative Analyse, semantische Analyse, Intertextualität, Redaktionskritik, Wirkungskritik, Textpragmatik, Semiotik, Aktantenmodell, narratologische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Exegese von Mt 14,13-21 (Speisung der Fünftausend)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit ist eine kritische Exegese der Perikope Matthäus 14,13-21, die die Speisung der Fünftausend beschreibt. Sie untersucht den Text mit verschiedenen Methoden, um dessen Bedeutung und Funktion im Kontext des Matthäusevangeliums zu verstehen.
Welche Methoden werden in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Vielzahl von Methoden, darunter syntaktisch-narrative Analyse (einschließlich Handlungssequenzanalyse, Aktantenmodell nach Greimas, Propp'sches Modell), semantische Analyse (semantisches Inventar, Bedeutungsverwandte Wörter/Lexeme, semantische Oppositionen, semiotische Vierecke), Intertextualitätsanalyse, Redaktionskritik, Wirkungskritik und textpragmatische Analyse (Intention des Autors, Leserlenkung, kirchengeschichtliche Wirkung).
Welche Aspekte des Textes werden untersucht?
Die Analyse umfasst die narrative Struktur und die Handlungsträger, die Semantik der Schlüsselbegriffe und ihrer Beziehungen, intertextuelle Bezüge zum Neuen und Alten Testament, die sozio-ökonomische und kultur-anthropologische Einbettung, die Entstehung des Textes und seine Wirkung im Laufe der Geschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einführung, Textanalyse (mit verschiedenen Übersetzungen und textgeschichtlicher Problematik), Abgrenzung der Perikope, detaillierte syntaktisch-narrative und semantische Analyse, Analyse der Funktion im unmittelbaren und Makrotext (Matthäusevangelium), Intertextualitätsanalyse (Vergleich mit anderen Evangelien und alttestamentlichen Texten), diachrone Betrachtung (synoptischer Vergleich, Redaktions- und Wirkungskritik), textpragmatische Erwägungen und schließlich ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Matthäusevangelium, Speisung der Fünftausend, Wundererzählung, syntaktisch-narrative Analyse, semantische Analyse, Intertextualität, Redaktionskritik, Wirkungskritik, Textpragmatik, Semiotik, Aktantenmodell, narratologische Analyse.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die symbolische Bedeutung des Wunders und die Rolle von Frauen im Bericht. Sie fragt nach der narrativen Struktur, der Semantik der Schlüsselbegriffe, den intertextuellen Bezügen, der sozio-ökonomischen und kultur-anthropologischen Einbettung, der Entstehung und Wirkung des Textes.
Welche Übersetzungen des Textes werden berücksichtigt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Übersetzungen der Perikope Mt 14,13-21 und begründet die Wahl der verwendeten Übersetzung im Detail. Textgeschichtliche Probleme, die den Umgang mit dem Text beeinflussen, werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird die Intertextualität behandelt?
Die Intertextualität wird untersucht durch den Vergleich mit parallelen Texten im Johannesevangelium und anderen Stellen im Matthäusevangelium sowie durch die Betrachtung intertextueller Bezüge zum Alten Testament und zum antiken Judentum. Ähnlichkeiten und Unterschiede werden im Kontext der Überlieferung erörtert.
Welche Rolle spielt die Redaktionskritik?
Die Redaktionskritik wird angewendet, um die Entstehung des Textes und die verschiedenen Überlieferungsstränge zu untersuchen. Zusammenhang der synoptischen Texte und redaktionskritische Analysen helfen, den Text in seiner historischen Entwicklung zu verstehen.
Wie werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst?
Die Ergebnisse der verschiedenen Analysen werden in Kapitel 4 zusammengefasst und anschließend in den weiteren Kapiteln im Kontext des unmittelbaren und Makrotextes sowie unter Berücksichtigung von Intertextualität, diachroner Betrachtung und textpragmatischen Erwägungen eingeordnet und diskutiert.
- Citation du texte
- Katharina Schaub (Auteur), 2004, Die Speisung der Fünftausend. Exegetische Hausarbeit der Perikope Mt 14,13-21, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38319