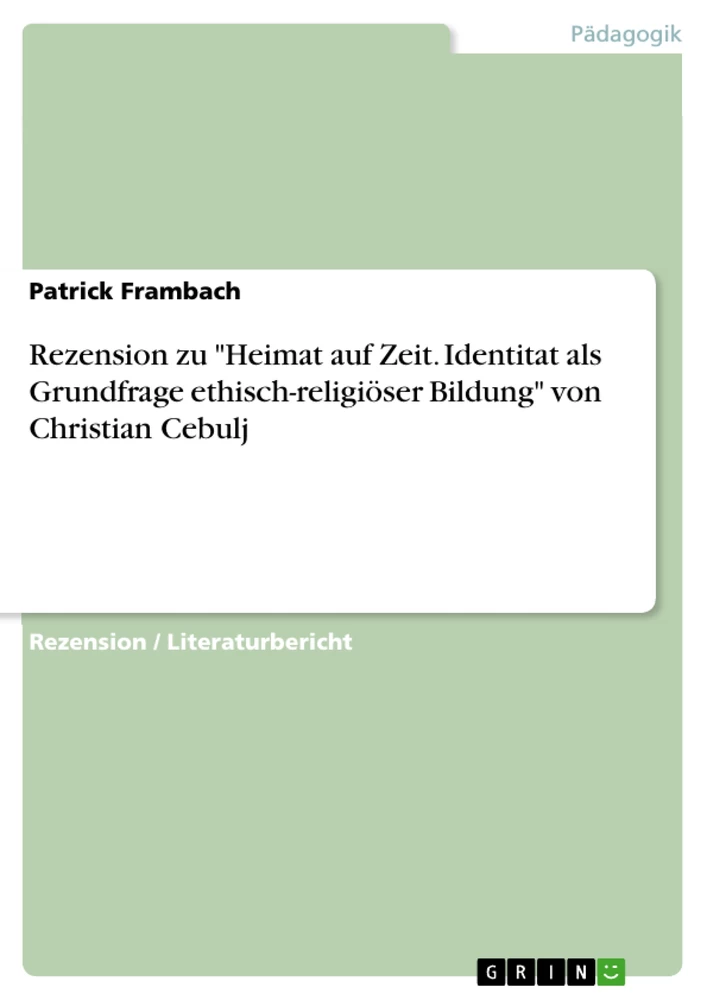In dieser Rezension wird auf drei der insgesamt sechs Aufsätze aus Cebuljs und Flurys Sammelband "Heimat auf Zeit - Identität als Grundfrage ethisch-religiöser Bildung" näher eingegangen werden. Es soll besonders um diese gehen, die den Identitätsbegriff prägnant behandeln.
Das Werk nähert sich dem Thema in multiperspektiver Sicht. Dabei behandelt der erste Aufsatz soziologische Aspekte und geht dabei auf die Frage ,,Wer bin ich in einer sozialen Welt, deren Grundriss sich unter Bedingungen der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung verändert?“ ein. Es handelt sich vor allem um die Problematik, die eigene Identität zu finden und zu festigen in einer Welt, in der die Möglichkeiten das eigene Leben zu leben und zu gestalten, mannigfaltig geworden sind. Es gehe darum, Wege zu finden, individuell Möglichkeiten zu finden, das eigene Leben zu ordnen und als verlässlich und berechenbar zu erachten, wenngleich die Welt, in der wir leben, von einer permanenten Veränderung gekennzeichnet sei. Gleichzeitig gilt es aber auch, ,,Identitätszwänge“ loszulassen und den eigenen, individuellen Weg zu finden, der jedoch das gewachsene Risiko des Scheiterns beinhaltet.
Christian Cebulj, Johannes Flury (Hg.)
Heimat auf Zeit – Identität als Grundfrage ethisch-religiöser Bildung
Die Herausgeber: Christian Cebulj, Dr. theol., Jahrgang 1964, ist Professor für Religionspädagogik und Katechetik an der Theologischen Hochschule Chur und Dozent für ,,Religionskunde und Ethik“ an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Johannes Flury, Dr. theol., Jahrgang 1949, ist Rektor der Pädagogischen Hochschule Graubünden und Präsident der Konferenz der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz (cohep).
Das Buch ist 2012 im Theologischen Verlag Zürich (TVZ) als sechstes Band in der Schriftenreihe Forum Pastoral des Pastoralinstituts der Theologischen Hochschule Chur erschienen, die sich mit Themen befasst, die die Schnittstelle von Theologie und pastoraler Praxis beleuchten.
Das Werk umfasst 159 Seiten und gliedert sich in sieben Aufsätze, die von verschiedenen AutorInnen verfasst wurden:
1. Zur Einleitung: Identität als ,,Heimat auf Zeit“
2. Vom Ringen um Identität in der spätmodernen Gesellschaft (Heiner Keupp)
3. Erikson und die Religion (Christian Cebulj)
4. Selbstkonstruierte Identität – neue Aufgaben der Pädagogik? (Peter Loretz)
5. Identität und christliche Lebenspraxis (Eva-Maria Faber)
6. Konfessionen und Religionen als Heimat – heute noch? (Johannes Flury)
7. Einführung des Faches ,,Ethik und Religionen“ im Kanton Luzern – Ein Werkstattbericht (Dominik Helbling)
Die einzelnen Aufsätze sind jeweils noch in Unterpunkte unterteilt. Dies verschafft dem Lesenden einen guten und angenehmen Überblick. Es verschafft Übersicht und verhindert durch mehrere Untergliederungen und Absätze ein Gefühl der Erschlagenheit, das einen oftmals überkommt, wenn man Bücher aufschlägt, die nur aus Text in der kleinstmöglichen Schriftart bestehen. Vielerlei nutzen die AutorInnen auch Grafiken, um ihre Aussagen zu verdeutlichen. Dies hilft dem Lesenden das Gelesenen besser zu verstehen. Vor allem beim Aufsatz ,,Erikson und die Religion“ erweist sich dies als besonders hilfreich, da der Lesende das Stufenmodell der Identitätsentwicklung von Erikson visuell dargeboten bekommt. Die meisten AutorInnen nutzen ebenso Zitate, sei es zum Einstieg für den Aufsatz oder um erwähntes noch einmal mit Zitaten zu untermauern. Dies erachte ich als besonders sinnvoll und gut, da es dem ganzen mehr Souveränität verleiht und als Einstig in ein Aufsatz-Thema durchaus passend ist. Am Ende eines jeden Aufsatzes findet sich ein Literaturverzeichnis. Auch das ist enorm wichtig, da der Lesende somit die Möglichkeit bekommt, schnell und präzise das, was er gelesen hat noch einmal im Original nachzulesen oder weitere Informationen zu dem Thema zu erhalten.
Generell erachte ich mich als großer Befürworter von Schriftenreihen in Aufsatzform, wie sie dieses Werk darstellt. Während sich in Monografien ein Autor intensiv mit einem Thema befasst, und damit mehr oder weniger bewusst seine subjektive Meinung in sein Werk mit einfließen lässt, entspricht eine Schriftenreihe durch ihre verschiedenen Aufsätze mehr dem pluralistischen Charakter und eröffnet den Lesenden Wege über die egozentrischen Sichtweise hinaus in die Multiperspektivität und pluralistische Vielfalt gesellschaftlichen Lebens.
In der nachfolgenden Rezension möchte ich auf drei der sechs Aufsätze näher eingehen, die den Identitätsbegriff prägnant behandeln.
Das Werk nähert sich dem Thema in multiperspektiver Sicht. Dabei behandelt der erste Aufsatz soziologische Aspekte und geht dabei auf die Frage ,,Wer bin ich in einer sozialen Welt, deren Grundriss sich unter Bedingungen der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung verändert?“ ein. Es handelt sich vor allem um die Problematik, die eigene Identität zu finden und zu festigen in einer Welt, in der die Möglichkeiten das eigene Leben zu leben und zu gestalten, mannigfaltig geworden sind. Es gehe darum, Wege zu finden, individuell Möglichkeiten zu finden, das eigene Leben zu ordnen und als verlässlich und berechenbar zu erachten, wenngleich die Welt, in der wir leben, von einer permanenten Veränderung gekennzeichnet sei. Gleichzeitig gilt es aber auch, ,,Identitätszwänge“ loszulassen und den eigenen, individuellen Weg zu finden, der jedoch das gewachsene Risiko des Scheiterns beinhaltet. Viele psychosoziale Probleme der heutigen Zeit verweisen auf diese Scheiternsmöglichkeiten. Der Autor verweist im nächsten Abschnitt auf Dekonstruktionen klassischer Identitätsvorstellungen, anhand des Schemas der Identitätsentwicklung nach Erikson. Identität stelle dabei einen Begriff dar, der im Alltag angekommen und dessen Nutzen inflationäre Züge angenommen habe. Der Begriff sei längst nicht mehr nur bei Erikson zu finden, doch sollte man auf diesen zurückgreifen, wenn man sich mit dem Identitätsbegriff näher beschäftigen wolle. Identität im psychologischen Sinne stellt die Frage nach den ,,Bedingungen der Möglichkeit für eine lebensgeschichtliche und eine situationsübergreifende Gleichheit in der Wahrnehmung der eigenen Person und für eine innere Einheitlichkeit trotz äußerer Wandlungen“ dar.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Buches „Heimat auf Zeit“?
Das Buch befasst sich mit der Identitätsbildung als zentraler Frage ethisch-religiöser Bildung in einer globalisierten und individualisierten Welt.
Welche Rolle spielt Erik Eriksons Stufenmodell in dem Werk?
Eriksons Modell der psychosozialen Identitätsentwicklung dient als theoretische Basis, um zu verstehen, wie Menschen trotz äußerer Wandlungen eine innere Einheitlichkeit finden.
Was bedeutet der Begriff „Heimat auf Zeit“?
Der Titel suggeriert, dass Identität und Zugehörigkeit in der Moderne nicht mehr statisch sind, sondern immer wieder neu konstruiert und als temporäre Beheimatung erlebt werden.
Wie beeinflusst die Globalisierung die Identitätsfindung?
Die Globalisierung vervielfacht die Lebensentwürfe und Möglichkeiten, erhöht aber gleichzeitig das Risiko des Scheiterns und den Druck, das eigene Leben permanent ordnen zu müssen.
Warum ist das Buch in Aufsatzform verfasst?
Die Aufsatzform ermöglicht eine multiperspektivische Sichtweise verschiedener Autoren aus Soziologie, Pädagogik und Theologie auf das komplexe Thema Identität.
- Citar trabajo
- Patrick Frambach (Autor), 2016, Rezension zu "Heimat auf Zeit. Identitat als Grundfrage ethisch-religiöser Bildung" von Christian Cebulj, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383267