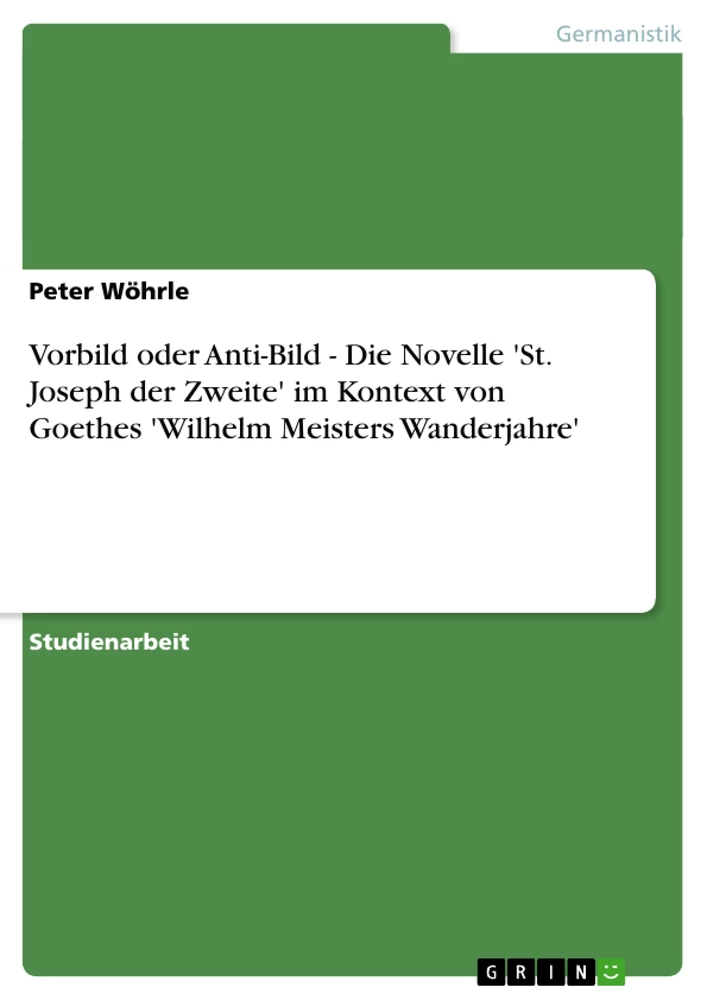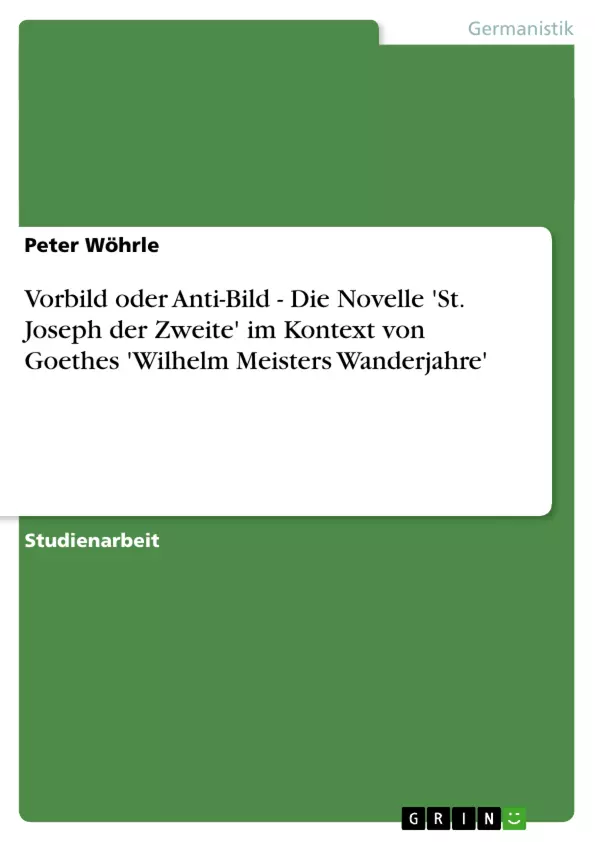[...] „Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden“ ist Goethes Altersroman. Was bewegte ihn dazu, eine Fortsetzung der „Lehrjahre“ zu schreiben und dazu noch in einer Form, die auf zeitgenössische Leser befremdend wirken musste? Auf den ersten Blick erscheint der Roman als inkohärente Zusammenstellung von Novellen, die lose mit der Rahmengeschichte Wilhelm Meisters verknüpft sind. So ungewöhnlich die Struktur des Roman zunächst erscheint, so merkwürdig beginnt der Roman. Nachdem die Lehrjahre mit der Zusammenführung Wilhelms und Natalies endeten, beginnt die Fortsetzung mit ihrer Trennung. Außerdem prallen die Erneuerungsbestrebungen der Turmgesellschaft mit einer Welt zusammen, die noch im Zeichen der alten Feudalordnung steht. Als Schnittstelle zwischen den beiden Romanen hat die Josephsgeschichte eine zentrale Bedeutung. Zudem muss betont werden, dass die Josephsnovelle den am frühesten entstandenen Teil der Wanderjahre darstellt und von Goethe immer schon als Beginn der Wanderjahre gedacht war. Während viele der anderen Novellen bei der Zweitfassung eine andere Position einnehmen als bei der Erstfassung, bleibt die Josephsnovelle an ihrer wichtigen ersten Stelle. Die vorangestellten Zitate aus der Forschungsliteratur zur Josephsgeschichte spiegeln die gegensätzlichen Tendenzen der Interpretation dieser Novelle eindrucksvoll wider. Die Beurteilung der Josephsfigur und seiner Familie oszilliert zwischen positiver Einordnung, die die Vorbildfunktion der Josephsfamilie einschließt, und der Bewertung als Antibild zum Romanganzen. Während die positive Bewertung eher der Einschätzung früherer Interpreten entspricht, stellen die jüngeren dieses Bild in Frage und rücken die ironischen Dimensionen der Josephsnovelle in den Mittelpunkt. Die Bewertung erscheint deshalb so wichtig, weil aufgrund ihrer Stellung als Eingangsnovelle eine Erwartungshaltung geformt wird, die für die Rezeption des Gesamttextes ausschlaggebend sein kann, da Josephs traditionelle Welt im Gegensatz zu der aufbrechenden Welt des Auswandererbundes gelesen werden muss. Mit der Interpretation der Eingangsnovelle wird das Romanganze mitinterpretiert. Insofern ist es notwendig, Joseph und seine Familie genau in Augenschein zu nehmen. Dazu ist zum einen präzise Textarbeit nötig, zum anderen muss die Textgenese mit einbezogen werden, die die intentionalen Aspekte erhellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Eine erste Betrachtung
- Josephs Imitation
- Goethes Quellen für den Bilderzyklus
- Josephs Nachahmung
- Ironie in der Josephsnovelle
- Ironisches Zitat romantischer Motivwahl
- Joseph als Dilettant
- Anmaßung und Spielerei
- Josephs Egozentrik
- St. Joseph der Zweite im Romanzusammenhang
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Goethes Novelle „St. Joseph der Zweite“ im Kontext von „Wilhelm Meisters Wanderjahre“. Sie beleuchtet die Rolle der Novelle als Einleitung des Romans und untersucht die komplexen Bezüge zwischen Josephs Geschichte und der zentralen Thematik von Erneuerung und Tradition im Werk.
- Die Interpretation der Josephsfigur und seiner Familie
- Die Rolle der Novelle als Einstieg in die „Wanderjahre“
- Die Bedeutung von Ironie und Nachahmung in der Josephsnovelle
- Die Beziehung zwischen Josephs Lebensgeschichte und dem Bilderzyklus
- Der Vergleich der Josephsfamilie mit dem Auswandererbund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die gegensätzlichen Interpretationen der Josephsnovelle vor und argumentiert für die Notwendigkeit einer präzisen Textanalyse. Der erste Teil des Hauptteils betrachtet die Josephsfamilie aus textimmanenter Perspektive und hebt die positive Darstellung hervor. Der zweite Teil beleuchtet die Nachahmung des Bilderzyklus und analysiert, wie Goethe durch die Profanisierung von St. Joseph eine „menschliche“ Figur schafft. Der dritte Teil analysiert die ironischen Dimensionen der Novelle und zeigt, wie Josephs Egozentrik sich im Gegensatz zur ersten Betrachtung manifestiert.
Schlüsselwörter
Goethes „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, „St. Joseph der Zweite“, Bilderzyklus, Nachahmung, Ironie, Egozentrik, Vorbild, Antibild, Tradition, Erneuerung, Textimmanenz, Interpretation.
- Quote paper
- Peter Wöhrle (Author), 2002, Vorbild oder Anti-Bild - Die Novelle 'St. Joseph der Zweite' im Kontext von Goethes 'Wilhelm Meisters Wanderjahre', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38331