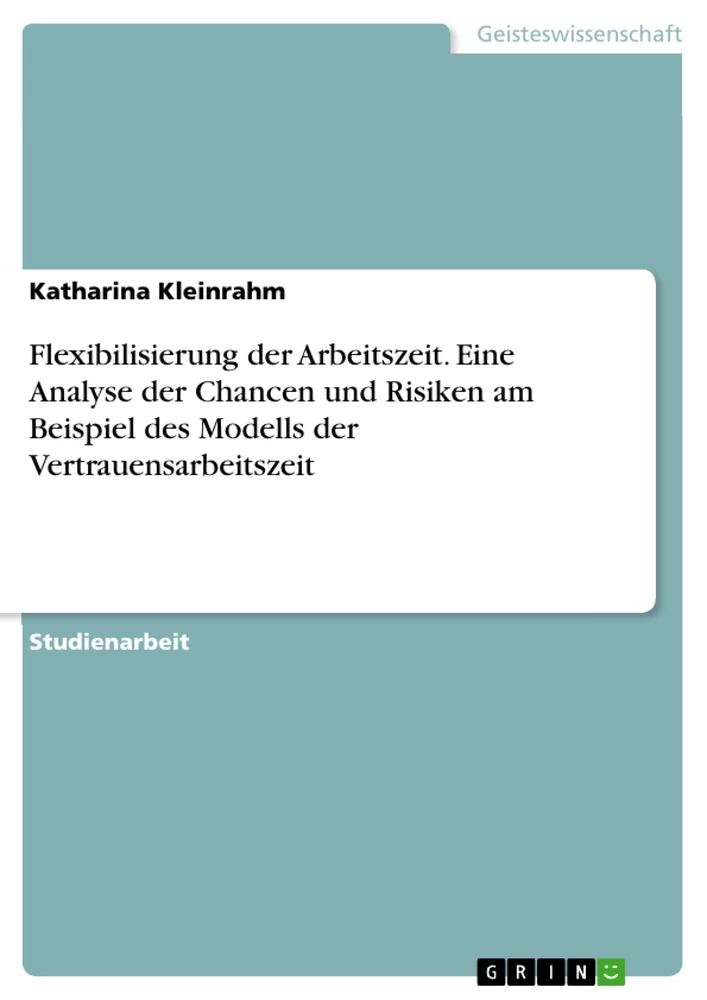Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser allgemeine Grundkenntnisse über das Modell der Vertrauensarbeitszeit zu vermitteln und die Vor- sowie Nachteile aufzuzeigen, sowie wie vorteilhaft eine Implementierung dieses Modells wirklich für beide Seiten ist.
Arbeitszeitmodelle, die starren Vorgaben folgen, gehören der Vergangenheit an. Eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag mit Arbeitszeiten von neun bis siebzehn Uhr ist nicht mehr zeitgemäß. Denn wie auch viele andere Bereiche unterliegt die Arbeitszeit dem Faktor der Flexibilisierung. Als Gründe für ein ansteigendes Maß an Flexibilität sind die Globalisierung der Wirtschaft, der demographische Wandel sowie ein Wandel hinsichtlich der Wertvorstellung von Arbeitnehmern anzuführen. Ein Modell der flexiblen Arbeitszeitgestaltung ist unter anderem das der Vertrauensarbeitszeit.
Genau hier entsteht die Motivation dieser Arbeit, die Flexibilisierung anhand des Modells der Vertrauensarbeitszeit zu erörtern. So wird im Rahmen dieser Arbeit, die Frage beantwortet werden, ob tatsächlich eine Flexibilisierung der Arbeitszeit durch das Modell der Vertrauensarbeitszeit erfolgt, oder hierdurch die Anzahl der Überstunden gefördert anstatt verringert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Entwicklung
- 2.1 Flexible Arbeitszeit allgemein
- 3. Formen flexibler Arbeitszeitmodelle
- 3.1 Definition und Eigenschaften der Vertrauensarbeitszeit
- 4. Analyse der Chancen und Risiken
- 4.1 Chancen für Arbeitgeber
- 4.2 Chancen für Arbeitnehmer
- 4.3 Risiken für Arbeitgeber
- 4.4 Risiken für Arbeitnehmer
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Flexibilisierung der Arbeitszeit am Beispiel des Modells der Vertrauensarbeitszeit. Sie beleuchtet die Chancen und Risiken dieser Arbeitszeitform für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und diskutiert, ob die Vertrauensarbeitszeit tatsächlich zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeit führt oder eher zu einer Zunahme von Überstunden.
- Historische Entwicklung der flexiblen Arbeitszeit
- Definition und Eigenschaften der Vertrauensarbeitszeit
- Chancen der Vertrauensarbeitszeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Risiken der Vertrauensarbeitszeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Bewertung der Auswirkungen der Vertrauensarbeitszeit auf die Arbeitszeitgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit ein und stellt die Vertrauensarbeitszeit als ein relevantes Modell vor. Es wird die Forschungsfrage formuliert, ob die Vertrauensarbeitszeit tatsächlich zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeit führt.
Kapitel 2: Historische Entwicklung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der flexiblen Arbeitszeit im Allgemeinen und zeigt die Gründe für die steigende Bedeutung flexibler Arbeitszeitmodelle auf.
Kapitel 2.1: Flexible Arbeitszeit allgemein
In diesem Kapitel wird die Entwicklung der flexiblen Arbeitszeit im Detail beschrieben. Es werden die Hintergründe für die Verbreitung flexibler Arbeitszeitmodelle, die Rolle der Gewerkschaften und die Veränderungen im Arbeitsverhältnis diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, Chancen und Risiken, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitszeitgestaltung, Überstunden, Globalisierung, demografischer Wandel, Wertvorstellungen, Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitgesetz, Gewerkschaften.
- Citar trabajo
- Katharina Kleinrahm (Autor), 2017, Flexibilisierung der Arbeitszeit. Eine Analyse der Chancen und Risiken am Beispiel des Modells der Vertrauensarbeitszeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383398