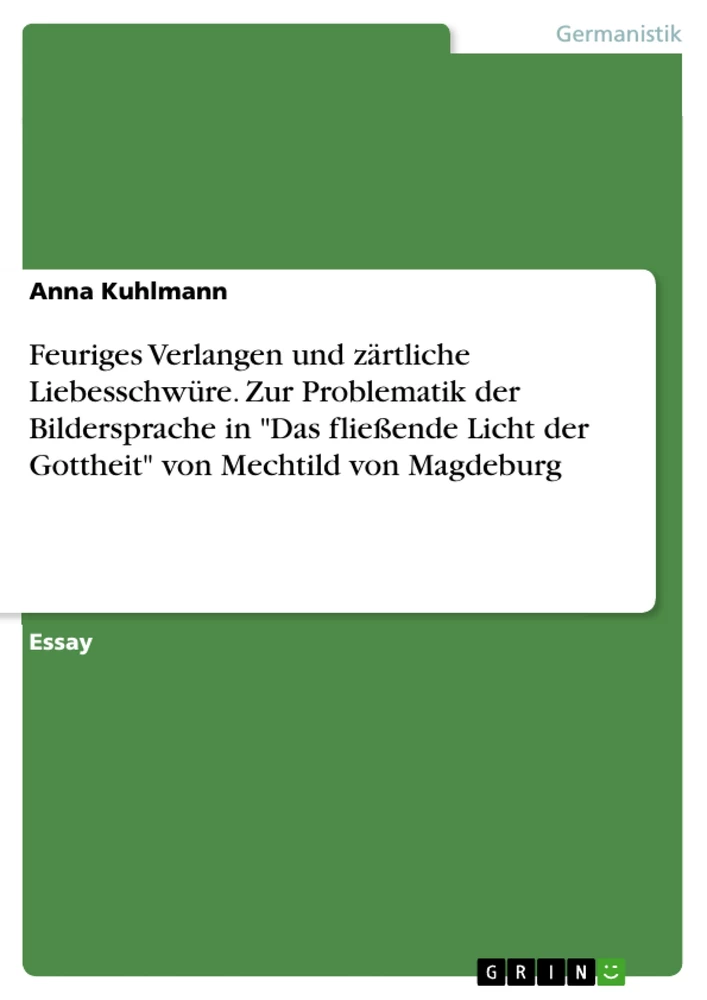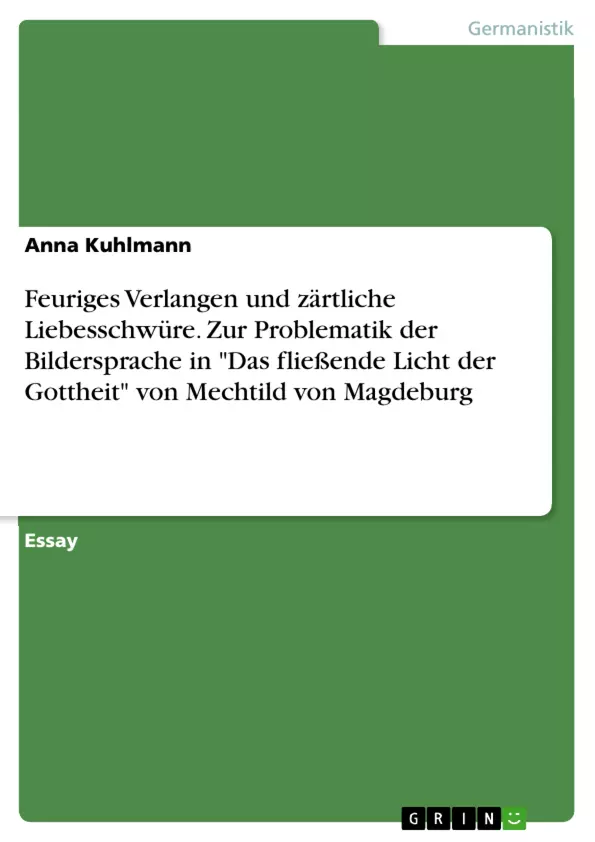In schwärmerischen Tönen beschreibt Mechtild von Magdeburg ihr sehnsüchtiges Verlangen nach ihrem Geliebten, in ihrem Werk "Das fließende Licht der Gottheit". In diesem um etwa 1250 erschienen Buch schildert Mechtild ihre mystischen Erfahrungen, die Vereinigung ihrer Seele mit Gott, als einen höchst erotischen Akt.
Doch handelt es sich hierbei um Worte beeindruckender poetischer Schönheit oder sind es die Äußerungen einer blasphemischen Verrückten? Im Folgenden sollen einerseits die Problematiken der Bildersprache Mechtilds thematisiert, andererseits aber auch ein Versuch unternommen werden, den Wert dieses Werkes zu beurteilen. Um die Einzigartigkeit der Bildersprache Mechtilds verstehen zu können, ist es zunächst notwendig, die historischen Gegebenheiten dieser Zeit nachzuvollziehen.
Das Frühmittelalter stand ganz im Zeichen der eschatologischen Naherwartung Gottes, der Apokalypse. Gläubige Christen erwarteten in naher Zukunft den Anbruch eines neuen Zeitalters, das mit Ängsten vor dem Jüngsten Gericht, einer Verurteilung zu einem Leben im Fegefeuer oder gar der Verdammnis in die Hölle einherging. Es dominierten Vorstellungen von Gott als ein unnahbarer, strafender Herrscher, ein allmächtiger, gefürchteter Gott, die Vorstellung eines "rex tremendus".
Inhaltsverzeichnis
- Feuriges Verlangen und zärtliche Liebesschwüre - Zur Problematik der Bildersprache in Mechtild von Magdeburgs „Das fließende Licht der Gottheit“
- Historische Gegebenheiten und der Wandel des Gottesbildes
- Die unio mystica und ihre kritische Rezeption
- Die Sprachbarriere und die Problematik der Bildersprache
- Die Funktion der Bildersprache und die Revision des Gottesbildes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Bildersprache in Mechtild von Magdeburgs Werk „Das fließende Licht der Gottheit“ und bewertet deren Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Mystik. Es wird analysiert, wie Mechtild ihre mystischen Erfahrungen beschreibt und welche Schwierigkeiten die Rezeption ihres Werkes im Laufe der Jahrhunderte bereitet hat.
- Analyse der erotischen Bildsprache in Mechtilds Werk
- Untersuchung der historischen und kulturellen Kontextualisierung der Mystik im Hochmittelalter
- Bewertung der kritischen Rezeption von Mechtilds Werk im Hinblick auf Häresie und Blasphemie
- Erörterung der „Sprachbarriere“ und der Herausforderungen der Übersetzung und Interpretation mittelalterlicher mystischer Texte
- Analyse der Funktion der Bildersprache in Bezug auf die Revision des traditionellen Gottesbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Feuriges Verlangen und zärtliche Liebesschwüre - Zur Problematik der Bildersprache in Mechtild von Magdeburgs „Das fließende Licht der Gottheit“: Der Essay beginnt mit der Einführung in Mechtilds Werk und stellt die zentrale Frage nach der Deutung ihrer erotischen Bildsprache. Er skizziert die Problematik der Rezeption von Mechtilds Werk und kündigt die Absicht an, die Bildersprache zu analysieren und den Wert des Werkes zu beurteilen.
Historische Gegebenheiten und der Wandel des Gottesbildes: Dieses Kapitel beleuchtet die historische und religiöse Situation im Hochmittelalter. Es beschreibt den Übergang von einer eschatologischen Naherwartung und der Vorstellung Gottes als „rex tremendus“ hin zu einem wachsenden Individualitätsbewusstsein und einer neuen Sensibilität in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Mechtilds Werk wird als Repräsentation dieses Wandels dargestellt, indem sie die Liebe zu Gott neu interpretiert und dem göttlichen Partner dieselbe Inbrünstigkeit zuspricht.
Die unio mystica und ihre kritische Rezeption: Dieses Kapitel analysiert die „unio mystica“, die leidenschaftliche Vereinigung mit Gott, die Mechtild mit erotischem Vokabular beschreibt. Es thematisiert die kritische Rezeption ihres Werkes, insbesondere die Vorwürfe der Häresie und Blasphemie. Es werden die „Originalitätsbarriere“, die „Mentalitätsbarriere“ und die „Sprachbarriere“ als Faktoren für das Missverständnis ihrer Texte erläutert, die sich aus dem Unterschied zwischen der mittelalterlichen und der modernen Weltanschauung ergeben.
Die Sprachbarriere und die Problematik der Bildersprache: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Herausforderungen der Interpretation von Mechtilds Bildsprache. Es thematisiert die Schwierigkeiten, die mystische Erfahrung der Gottesnähe in Worte zu fassen und erläutert, wie Mechtild ihre eigenen Grenzen des Ausdrucks und ihr Nichtwissen durch Paradoxa thematisiert. Die Bedeutung von Bildern wie Feuer, Hitze und Liebe im Kontext der unio mystica wird analysiert, wobei betont wird, dass es sich nicht um eine körperliche, sondern eine spirituelle Vereinigung handelt.
Die Funktion der Bildersprache und die Revision des Gottesbildes: Dieses Kapitel untersucht die Funktion von Mechtilds Bildersprache. Es zeigt, wie sie alltägliche Bilder nutzt, um die mystische Erfahrung zu veranschaulichen und die Grenzen zwischen Gott und Mensch aufzuheben. Mechtilds Darstellung Gottes als leidenschaftlichen Liebespartner wird als eine Revision des traditionellen Gottesbildes interpretiert, die ein neues Gottesempfinden ermöglichen soll. Die These wird vertreten, dass Mechtild zeigen will, dass durch die Menschwerdung Gottes der Mensch Gott geworden ist.
Schlüsselwörter
Mechtild von Magdeburg, Das fließende Licht der Gottheit, Mystik, Hochmittelalter, unio mystica, Bildersprache, erotische Sprache, Gottesbild, Häresie, Sprachbarriere, Gottesnähe, mittelhochdeutsche Literatur, religiöse Erfahrung.
Häufig gestellte Fragen zu Mechtilds von Magdeburgs „Das fließende Licht der Gottheit“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bildsprache in Mechtild von Magdeburgs Werk „Das fließende Licht der Gottheit“ und untersucht deren Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Mystik. Ein besonderer Fokus liegt auf der erotischen Bildsprache und den Herausforderungen ihrer Rezeption im Laufe der Jahrhunderte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Analyse der erotischen Bildsprache, die historische und kulturelle Kontextualisierung der Mystik im Hochmittelalter, die kritische Rezeption von Mechtilds Werk (einschließlich der Vorwürfe von Häresie und Blasphemie), die „Sprachbarriere“ und die Herausforderungen der Übersetzung und Interpretation mittelalterlicher mystischer Texte, sowie die Funktion der Bildersprache in Bezug auf die Revision des traditionellen Gottesbildes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Feuriges Verlangen und zärtliche Liebesschwüre: Einführung in Mechtilds Werk und die Problematik ihrer erotischen Bildsprache. 2. Historische Gegebenheiten und der Wandel des Gottesbildes: Der historische und religiöse Kontext des Hochmittelalters und der Wandel des Gottesbildes. 3. Die unio mystica und ihre kritische Rezeption: Analyse der mystischen Vereinigung mit Gott und die kritische Rezeption von Mechtilds Werk. 4. Die Sprachbarriere und die Problematik der Bildersprache: Herausforderungen der Interpretation von Mechtilds Bildsprache und die Schwierigkeiten, mystische Erfahrung in Worte zu fassen. 5. Die Funktion der Bildersprache und die Revision des Gottesbildes: Die Funktion der Bildersprache zur Veranschaulichung der mystischen Erfahrung und die Revision des traditionellen Gottesbildes.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mechtild von Magdeburg, Das fließende Licht der Gottheit, Mystik, Hochmittelalter, unio mystica, Bildersprache, erotische Sprache, Gottesbild, Häresie, Sprachbarriere, Gottesnähe, mittelhochdeutsche Literatur, religiöse Erfahrung.
Welche Schwierigkeiten bei der Rezeption von Mechtilds Werk werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert verschiedene Rezeptionsschwierigkeiten, darunter die „Originalitätsbarriere“, die „Mentalitätsbarriere“ und die „Sprachbarriere“, die sich aus dem Unterschied zwischen der mittelalterlichen und der modernen Weltanschauung ergeben. Vorwürfe der Häresie und Blasphemie aufgrund der erotischen Bildsprache werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird die „unio mystica“ in der Arbeit behandelt?
Die „unio mystica“, die leidenschaftliche Vereinigung mit Gott, wird als zentrales Thema analysiert. Besonders wird untersucht, wie Mechtild diese Vereinigung mit erotischem Vokabular beschreibt und welche kritischen Reaktionen dies hervorrief.
Welche Funktion hat die Bildersprache in Mechtilds Werk?
Die Bildersprache dient in Mechtilds Werk dazu, die mystische Erfahrung zu veranschaulichen und die Grenzen zwischen Gott und Mensch aufzuheben. Sie verwendet alltägliche Bilder, um die Gottesnähe auszudrücken und das traditionelle Gottesbild zu revidieren, indem sie Gott als leidenschaftlichen Liebespartner darstellt.
- Quote paper
- Anna Kuhlmann (Author), 2010, Feuriges Verlangen und zärtliche Liebesschwüre. Zur Problematik der Bildersprache in "Das fließende Licht der Gottheit" von Mechtild von Magdeburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383626