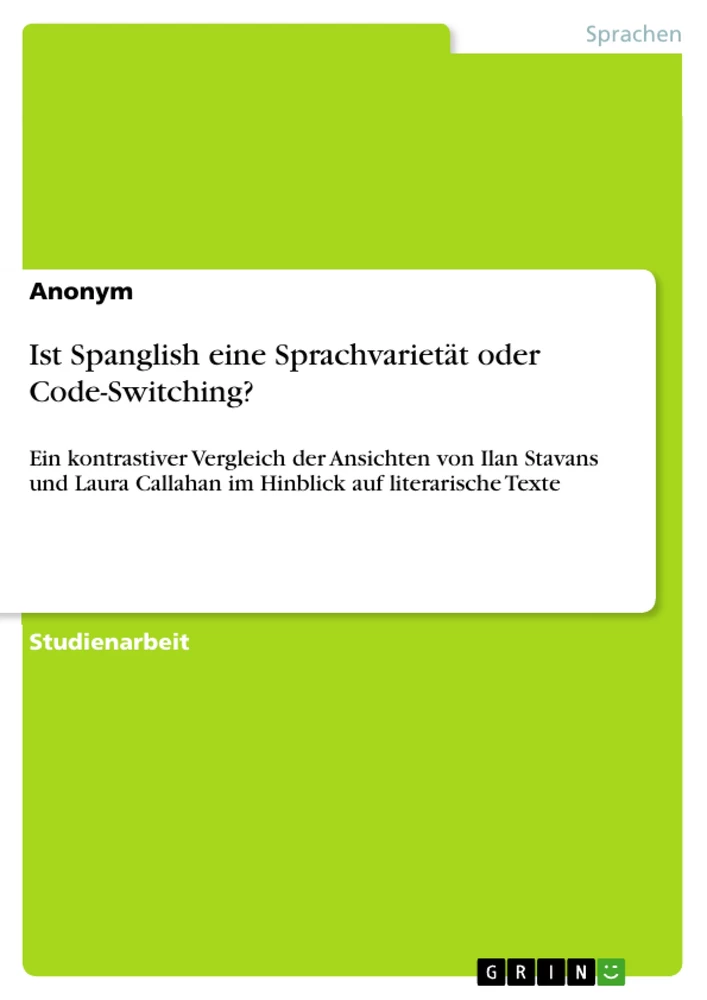Auf Grund der Sprachkontaktsituation zwischen Spanisch und Englisch in den USA hat sich eine völlig neue Sprachform entwickelt: Spanglish. Doch was genau ist Spanglish und kann man diese Sprachmischung als Sprache bezeichnen?
Spanglish wird von verschiedensten Linguisten kontrovers diskutiert. Herauskristallisiert haben sich vor allem zwei gegensätzliche Meinungen: "Spanglish ist eine Sprache" vs. "Spanglish ist Code-Switching". Die von mir untersuchte Hauptfrage ist demnach, ob es sich bei Spanglish um eine Varietät oder um Code-Switching handelt. Weitere abweichende Meinungen werden zwar betrachtet, aber nicht weiter ausgebaut, da sie für die
Hauptfragestellung nicht relevant sind.
Diese Arbeit setzt sich mit diesen beiden oben genannten Meinungen auseinander und versucht, zu einem abschließenden Fazit zu kommen. Untersucht wird hierbei lediglich die Schriftsprache, da (zurzeit nur) wenige mündliche Transkriptionen des Spanglish vorliegen. Untersucht und analysiert werden die Meinung von Stavans, der Spanglish als Sprache betrachtet und Callahan, die Spanglish als Code-Switching ansieht.
Ziel ist es, die beiden Ansichten zu analysieren und mögliche Charakteristika des Spanglish herauszuarbeiten und zu vergleichen. Quellen sind hierfür Stavans Übersetzung des "Don Quijote" ins Spanglish und Callahans Textkorpus zu "Spanish/English codeswitching". Kriterien für einen direkten Vergleich zu finden, ist sehr schwer, da die beiden Ansichten sehr gegensätzlich sind und auf verschiedene Ausgangsideen aufbauen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung zu Spanglish
- 1.1 Überblick: Spanisch und Spanglish in den USA
- 1.2 Sprachvaritäten in Europa
- 1.2.1 Denglish
- 1.2.2 Franglais
- 1.2.3 Alemañol
- 1.2.4 Portuñol
- 1.3 Kritiker und Befürworter des Spanglish
- 1.3.1 Zentella
- 1.3.2 Otheguy
- 1.3.3 Lipski
- 1.3.4 Betti
- 2 Fachworterläuterungen
- 2.1 Diasystem
- 2.2 Bilingualismus
- 2.3 Code-Switching
- 2.4 Pidgin, Kreolsprache
- 3 Ansichten von llan Stavans zu Spanglish
- 3.1 Informationen über Ilan Stavans
- 3.2 seine Definition von Spanglish
- 3.3 Analyse der Übersetzung des „Don Quijote“ mit Auszug
- 3.3.1 Grammatik
- 3.3.2 Lexik
- 3.3.3 Semantik
- 4 Ansichten von Laura Callahan zu Spanglish
- 4.1 Informationen zu Laura Callahan
- 4.2 ihre Definition von Spanglish
- 4.3 Beispiele anhand ihres Korpora
- 4.3.1 satzexterner Wechsel
- 4.3.2 satzinterner Wechsel
- 4.3.3 emblematischer Wechsel
- 4.3.4 wortinterner Wechsel
- 5 Vergleich und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Spanglish als eigenständige Varietät oder als Code-Switching betrachtet werden sollte. Sie untersucht die gegensätzlichen Ansichten von Ilan Stavans und Laura Callahan, die Spanglish als Sprache bzw. als Code-Switching definieren.
- Sprachkontaktphänomen Spanglish
- Definition und Charakteristika des Spanglish
- Analyse von Stavans’ Übersetzung des „Don Quijote“
- Callahans Korpusanalyse von Code-Switching-Beispielen
- Vergleich und Abgrenzung von Varietät und Code-Switching
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über Spanisch und Spanglish in den USA und beleuchtet die historische Entwicklung des Spanischen in Amerika. Es geht auch auf verschiedene Sprachvaritäten in Europa ein, die durch Sprachkontakt entstanden sind, wie z. B. Denglish, Franglais und Alemañol. Zudem werden unterschiedliche Meinungen zu Spanglish von Linguisten wie Zentella, Otheguy, Lipski und Betti vorgestellt.
Kapitel 2 erläutert wichtige Fachbegriffe wie Diasystem, Bilingualismus, Code-Switching und Pidgin/Kreolsprache, die im Kontext der Spanglish-Diskussion relevant sind. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Sichtweise von Ilan Stavans auf Spanglish. Es präsentiert seine Definition von Spanglish und analysiert seine Übersetzung des „Don Quijote“ in Bezug auf Grammatik, Lexik und Semantik.
Kapitel 4 widmet sich Laura Callahans Ansatz zum Spanglish. Es stellt ihre Definition vor und untersucht Beispiele aus ihrem Korpus, die verschiedene Arten von Code-Switching illustrieren. Das abschließende Kapitel 5 vergleicht die beiden Ansichten von Stavans und Callahan und versucht, ein Fazit zu den Charakteristika von Spanglish zu ziehen.
Schlüsselwörter
Spanglish, Varietät, Code-Switching, Bilingualismus, Sprachkontaktphänomen, Spanisch, Englisch, Ilan Stavans, Laura Callahan, „Don Quijote“, Übersetzung, Korpusanalyse, Satzstruktur, Lexik, Semantik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Spanglish?
Spanglish ist eine Sprachmischung aus Spanisch und Englisch, die primär durch den Sprachkontakt in den USA entstanden ist.
Ist Spanglish eine eigene Sprache oder Code-Switching?
Das ist umstritten. Ilan Stavans betrachtet es als eigenständige Varietät (Sprache), während Laura Callahan es als Phänomen des Code-Switching definiert.
Was versteht man unter Code-Switching?
Code-Switching bezeichnet den fließenden Wechsel zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs oder sogar eines Satzes durch bilinguale Sprecher.
Wie hat Ilan Stavans Spanglish literarisch untermauert?
Stavans übersetzte Teile von Cervantes' „Don Quijote“ ins Spanglish, um zu zeigen, dass die Mischform über eine eigene Grammatik und Lexik verfügt.
Welche Arten von Sprachwechsel analysiert Laura Callahan?
Sie unterscheidet unter anderem zwischen satzinternem, satzexternem, emblematischem und wortinternem Wechsel.
Gibt es ähnliche Sprachphänomene in Europa?
Ja, die Arbeit nennt Beispiele wie Denglish (Deutsch/Englisch), Franglais (Französisch/Englisch) oder Portuñol (Portugiesisch/Spanisch).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Ist Spanglish eine Sprachvarietät oder Code-Switching?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383706