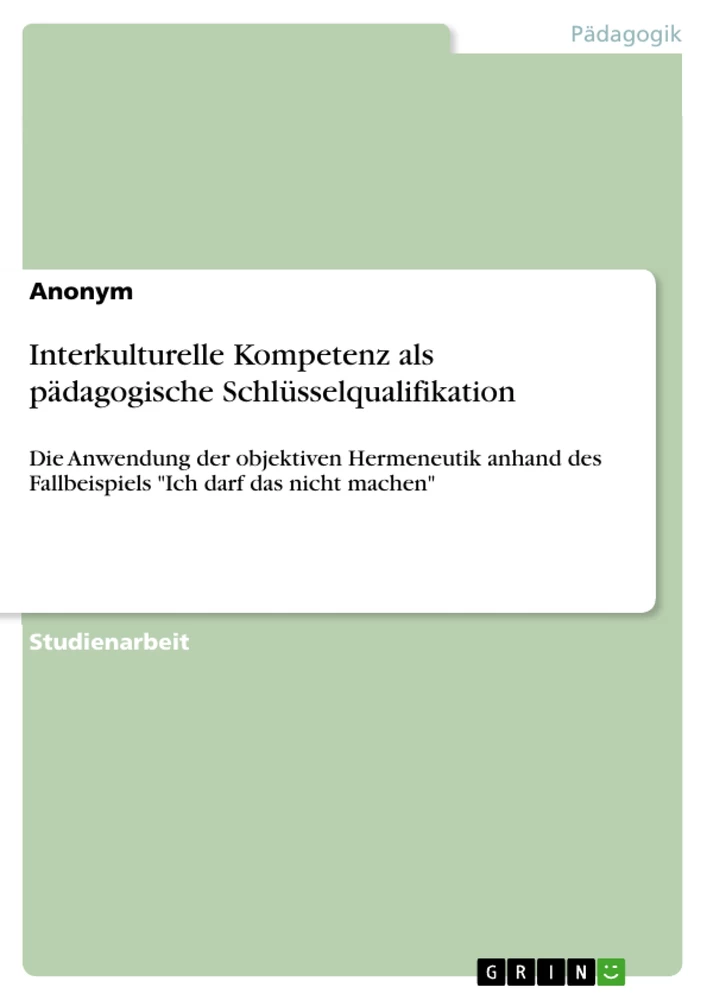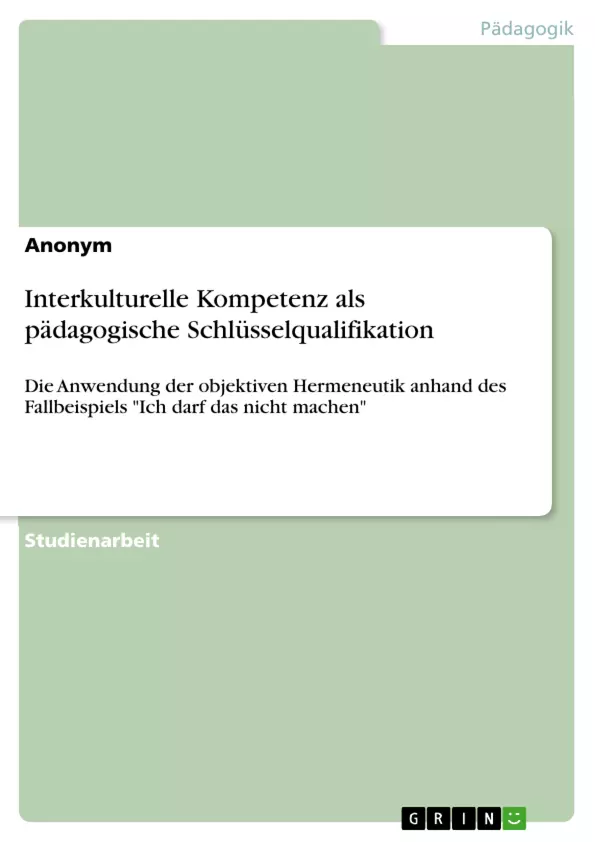Die erfolgreiche Kommunikation in Schulklassen, in denen eine Vielfalt von unterschiedlichen Kulturen und Religionen vertreten ist, bildet für das konstruktive Miteinander eine wichtige Basis, aus der sich die Bedeutung Interkultureller Kompetenz als "Schlüsselqualifikation" im pädagogischen Handeln entwickelt hat. Die Vielfalt der Kulturen ist im Schulalltag der Lehrkraft präsent – und mit ihr ebenso vielfältige Herausforderungen.
Eine Hauptherausforderung besteht darin, interkulturelle Kommunikation störungsfrei zu ermöglichen und dabei gleichzeitig den Paradoxien und Antinomien professionellen Handelns ausgesetzt zu sein. Im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen, geprägt durch starke Migrationsflüsse, stellt die Dialektik der Differenz, auf die in Kapitel 2.3 eingegangen wird, eine im Kontext interkulturellen Unterrichts besonders zu berücksichtigende Antinomie dar.
Daher stellt sich in dieser Arbeit zum Einen die Frage, inwiefern interkulturell kompetentes Handeln in der rekonstruierten Stunde erkennbar ist, zum Anderen, welche Ursachen den Kommunikationsstörungen im rekonstruierten Unterricht zugrunde liegen und inwieweit das dialektische Spannungsverhältnis das Lehrerhandeln im interkulturellen Kontext prägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herausforderungen und Störungsquellen interkultureller Kommunikation und Kompetenz
- Zum Begriff und Konzeption von „Interkultureller Kompetenz“
- Ein heuristisches Modell zur Interpretation interkultureller Kommunikationsstörungen
- Zur Dialektik der Differenz im interkulturellen Umgang
- Objektiv-hermeneutische Fallrekonstruktion:
- Zum Interpretationsverfahren der Objektiven Hermeneutik
- Interpretation einer Unterrichtssequenz
- Diskussion und theoretische Rahmung des Falls
- Ausblick und Konsequenzen für Theorie, Praxis und Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht interkulturelles Handeln im Unterricht anhand einer konkreten Unterrichtssequenz. Sie analysiert die Herausforderungen und Störungsquellen interkultureller Kommunikation und beleuchtet die Bedeutung der Interkulturellen Kompetenz als Schlüsselqualifikation im pädagogischen Kontext. Die Arbeit untersucht, inwiefern interkulturell kompetentes Handeln in der rekonstruierten Unterrichtsstunde erkennbar ist und welche Ursachen den Kommunikationsstörungen zugrunde liegen.
- Interkulturelle Kompetenz im Kontext der Schule
- Herausforderungen interkultureller Kommunikation
- Objektive Hermeneutik als Interpretationsmethode
- Dialektik der Differenz im interkulturellen Kontext
- Lehrerhandeln im interkulturellen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Interkulturelle Kompetenz im Bildungswesen ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Stellenwert interkulturellen Handelns im Unterricht. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Interkulturellen Kompetenz, verschiedene Modelle zur Beschreibung und die Herausforderungen im Umgang mit interkultureller Kommunikation. Kapitel 3 beschreibt das Interpretationsverfahren der Objektiven Hermeneutik und analysiert die rekonstruierte Unterrichtssequenz, um die Störfaktoren im Unterricht zu identifizieren. Kapitel 4 widmet sich der Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Möglichkeiten des Lehrerhandelns.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Kommunikation, Objektive Hermeneutik, Unterrichtssequenz, Kommunikationsstörungen, Dialektik der Differenz, Lehrerhandeln, Schulalltag, Vielfältige Kulturen, Migrationsflüsse, heuristisches Modell.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Interkulturelle Kompetenz als pädagogische Schlüsselqualifikation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383716