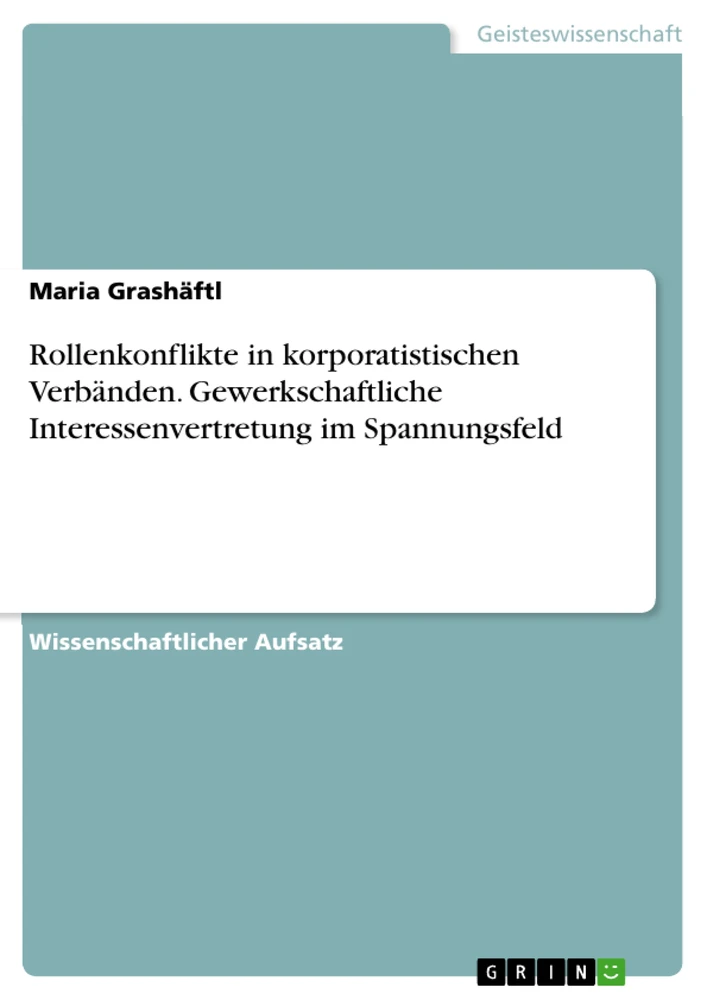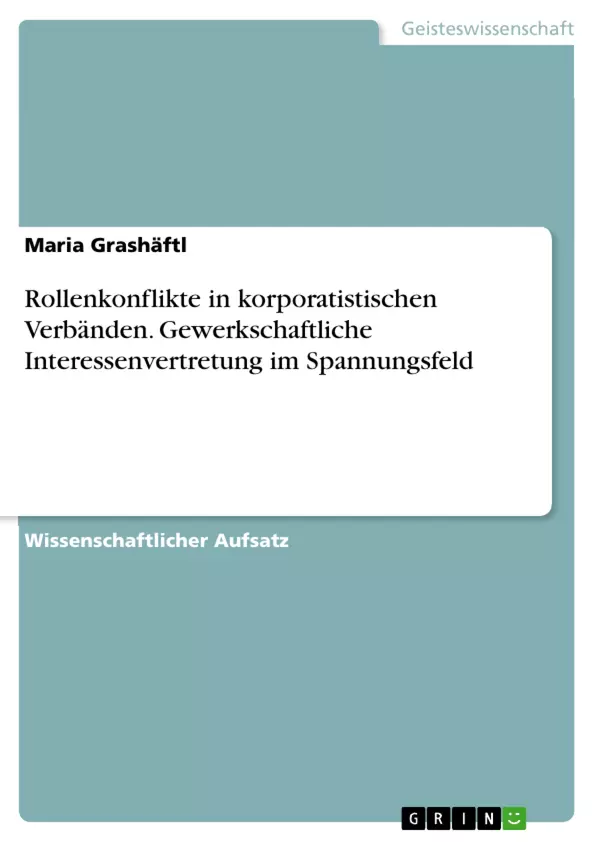Korporatistische Verbände sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der österreichischen politischen Landschaft. Die langfristige gemeinsame Zusammenarbeit, Konzertierung und Interessenakkordierung der großen Dachverbände der ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenorganisationen mit den jeweiligen Regierungen beweisen die Einzigartigkeit und Schlagkräftigkeit der österreichischen Sozialpartnerschaft, welche als beispielhaft für eine gelebte Konkordanzdemokratie gilt. Im Rahmen dieses Papers möchte ich im Besonderen auf die österreichischen ArbeitnehmerInnenverbände eingehen und ihre Rolle im Gefüge der Sozialpartnerschaft analysieren. Durch ihre Funktion und Bedeutung für die Gesellschaft, sowie ihren Einfluss in den wirtschafts- und sozialpolitischen Willens- und Entscheidungsbildungsprozess sowie die Gesetzgebung sind sie oftmals mit Rollenkonflikten konfrontiert und befinden sich daher in einem Spannungsfeld zwischen Mitgliederinteressen und Systemzwängen. Diese Problematik herauszuarbeiten wird Ziel dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rollendefinition
- Die strukturfunktionalistische Rollentheorie
- Die interaktionistische Rollentheorie
- Die Rolle der Gewerkschaft in der österreichischen Sozialpartnerschaft
- Der ÖGB und die Arbeiterkammern
- Der ÖGB und die Paritätische Kommission
- Der ÖGB und die Betriebe
- Rollenkonflikte
- Der Intrarollenkonflikt
- Mitgliedschafts- und Einflusslogik
- Der Interrollenkonflikt
- Parteizwänge
- BetriebsrätInnen zwischen ArbeitnehmerInneninteressen, Gewerkschaftszielen und ArbeitgeberInnenloyalität
- Der Intrarollenkonflikt
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle österreichischer Arbeitnehmerverbände innerhalb der Sozialpartnerschaft und untersucht die damit verbundenen Rollenkonflikte. Sie beleuchtet die Spannungsfelder zwischen den Interessen der Mitglieder und den systemischen Zwängen, denen diese Verbände ausgesetzt sind.
- Rollenverständnis von Gewerkschaften im Kontext der strukturfunktionalistischen und interaktionistischen Rollentheorie
- Die Funktion des ÖGB in der österreichischen Sozialpartnerschaft
- Intrarollenkonflikte innerhalb der Gewerkschaften
- Interrollenkonflikte, insbesondere die Herausforderungen für Betriebsräte
- Der Einfluss von Parteizwängen auf gewerkschaftliches Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rollenkonflikte in korporatistischen Verbänden ein und hebt die Bedeutung der österreichischen Sozialpartnerschaft hervor. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Herausarbeitung der Problematik von Rollenkonflikten für österreichische Arbeitnehmerverbände im Spannungsfeld zwischen Mitgliederinteressen und Systemzwängen.
Rollendefinition: Dieses Kapitel bietet eine rollentheoretische Grundlage für das Verständnis der Rolle des österreichischen Gewerkschaftsverbandes. Es vergleicht die strukturfunktionalistische und die interaktionistische Rollentheorie und diskutiert deren Anwendbarkeit auf den Kontext der Gewerkschaften. Während der strukturfunktionalistische Ansatz Rollen als vorgegebene Erwartungen beschreibt, betont der interaktionistische Ansatz die dynamische und veränderliche Natur von Rollen in sozialer Interaktion. Die Arbeit argumentiert für die Notwendigkeit, beide Perspektiven zu berücksichtigen, um das komplexe Rollenverständnis von Gewerkschaften adäquat zu erfassen.
Die Rolle der Gewerkschaft in der österreichischen Sozialpartnerschaft: Dieses Kapitel beschreibt die Position des ÖGB innerhalb des Systems der österreichischen Sozialpartnerschaft. Es analysiert die Interaktionen des ÖGB mit den Arbeiterkammern, der Paritätischen Kommission und den Betrieben. Es werden die verschiedenen Erwartungen und Einflüsse beleuchtet, denen der ÖGB in diesen Beziehungen ausgesetzt ist, und wie diese die Rolle des ÖGB und seine Handlungsspielräume prägen.
Rollenkonflikte: Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Arten von Rollenkonflikten, denen Gewerkschaften ausgesetzt sind. Der Intrarollenkonflikt wird im Kontext der Mitgliedschafts- und Einflusslogik betrachtet, während der Interrollenkonflikt die Herausforderungen für Betriebsräte im Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmerinteressen, Gewerkschaftszielen und Arbeitgeberloyalität beleuchtet. Der Einfluss von Parteizwängen auf das Handeln der Gewerkschaften wird ebenfalls analysiert. Das Kapitel veranschaulicht die komplexen Herausforderungen und das Spannungsverhältnis, in dem sich Gewerkschaften aufgrund ihrer vielfältigen Rollen und Interessenlagen befinden.
Schlüsselwörter
Rollenkonflikte, korporatistische Verbände, Gewerkschaften, Österreichische Sozialpartnerschaft, ÖGB, strukturfunktionalistische Rollentheorie, interaktionistische Rollentheorie, Intrarollenkonflikt, Interrollenkonflikt, Parteizwänge, Arbeitnehmerinteressen, Arbeitgeberloyalität, Kollektivbewusstsein, Interessenvertretung, Sozialpartnerschaft, Konfliktmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Rolle Österreichischer Arbeitnehmerverbände
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle österreichischer Arbeitnehmerverbände, insbesondere des ÖGB, innerhalb der österreichischen Sozialpartnerschaft und untersucht die damit verbundenen Rollenkonflikte. Der Fokus liegt auf den Spannungsfeldern zwischen den Interessen der Mitglieder und den systemischen Zwängen, denen diese Verbände ausgesetzt sind.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit verwendet die strukturfunktionalistische und die interaktionistische Rollentheorie, um das Rollenverständnis von Gewerkschaften zu beleuchten. Der strukturfunktionalistische Ansatz betrachtet Rollen als vorgegebene Erwartungen, während der interaktionistische Ansatz die dynamische und veränderliche Natur von Rollen in sozialer Interaktion betont. Beide Perspektiven werden kombiniert, um das komplexe Rollenverständnis adäquat zu erfassen.
Welche Rolle spielt der ÖGB in der österreichischen Sozialpartnerschaft?
Die Arbeit analysiert die Position des ÖGB innerhalb der Sozialpartnerschaft und seine Interaktionen mit den Arbeiterkammern, der Paritätischen Kommission und den Betrieben. Es werden die verschiedenen Erwartungen und Einflüsse untersucht, die die Rolle des ÖGB und seine Handlungsspielräume prägen.
Welche Arten von Rollenkonflikten werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Intrarollenkonflikten (Konflikte innerhalb der Rolle, z.B. zwischen Mitgliederinteressen und Einflusslogik) und Interrollenkonflikten (Konflikte zwischen verschiedenen Rollen, z.B. für Betriebsräte zwischen Arbeitnehmerinteressen, Gewerkschaftszielen und Arbeitgeberloyalität). Der Einfluss von Parteizwängen auf gewerkschaftliches Handeln wird ebenfalls analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Rollendefinition (mit Unterkapiteln zu strukturfunktionalistischer und interaktionistischer Rollentheorie), ein Kapitel zur Rolle der Gewerkschaft in der österreichischen Sozialpartnerschaft (mit Unterkapiteln zu den Beziehungen des ÖGB zu Arbeiterkammern, Paritätischer Kommission und Betrieben), ein Kapitel zu Rollenkonflikten (mit Unterkapiteln zu Intra- und Interrollenkonflikten und Parteizwängen) und einen Schluss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rollenkonflikte, korporatistische Verbände, Gewerkschaften, Österreichische Sozialpartnerschaft, ÖGB, strukturfunktionalistische Rollentheorie, interaktionistische Rollentheorie, Intrarollenkonflikt, Interrollenkonflikt, Parteizwänge, Arbeitnehmerinteressen, Arbeitgeberloyalität, Kollektivbewusstsein, Interessenvertretung, Sozialpartnerschaft, Konfliktmanagement.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Problematik von Rollenkonflikten für österreichische Arbeitnehmerverbände im Spannungsfeld zwischen Mitgliederinteressen und Systemzwängen herauszuarbeiten und ein umfassendes Verständnis ihrer Rolle innerhalb der Sozialpartnerschaft zu liefern.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die jeweiligen Inhalte und Argumentationslinien. Sie beschreibt die Einführung in die Thematik, die rollentheoretische Grundlage, die Analyse der Rolle des ÖGB in der Sozialpartnerschaft und die detaillierte Untersuchung der verschiedenen Rollenkonflikte.
- Citation du texte
- Maria Grashäftl (Auteur), 2015, Rollenkonflikte in korporatistischen Verbänden. Gewerkschaftliche Interessenvertretung im Spannungsfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383717