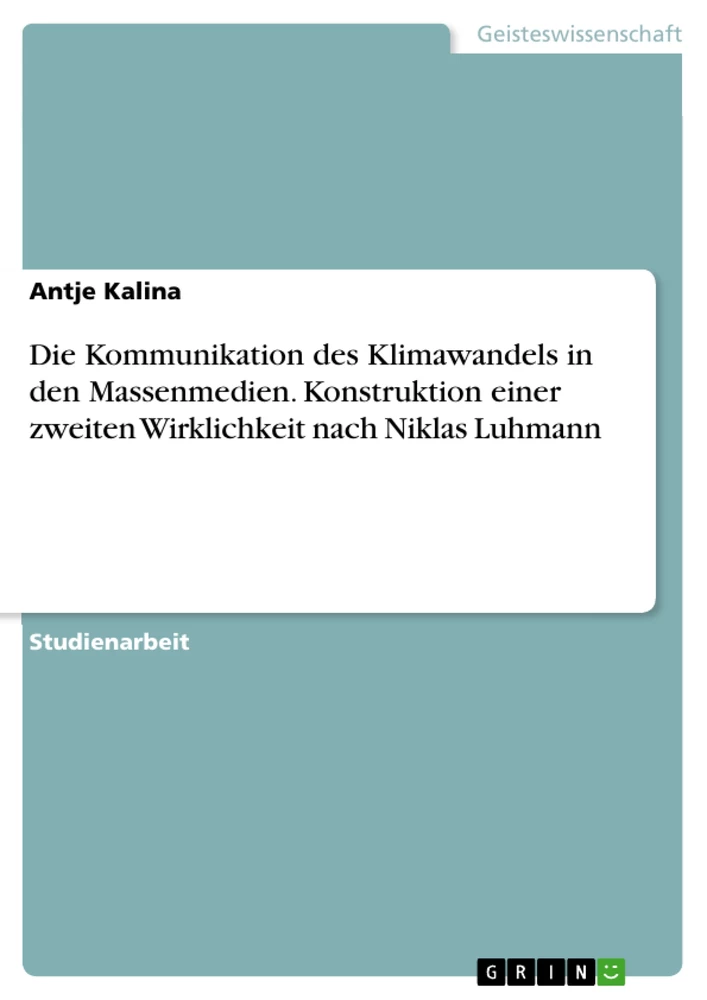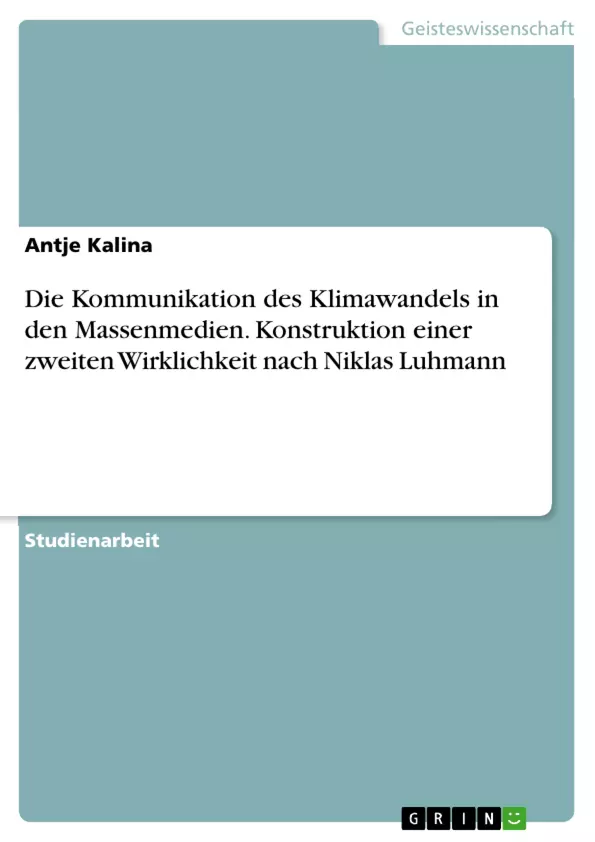Da es sich bei dem Wissenschaftssystem und dem System der Massenmedien bei Niklas Luhmann um zwei verschiedene soziale Systeme handelt, kommt es bei der Berichterstattung über den Klimawandel in den Medien notwendigerweise zu Übersetzungen und so zu Übersetzungsproblemen. Aufgrund dieser Übersetzungsfehler kann der in den Massenmedien dargestellte Klimawandel nie dem Klimawandel entsprechen, wie er in der Realität existiert, weshalb es zwei Realitäten gibt: die konstruierte und die reale Realität. Bei der Medienberichterstattung über den Klimawandel handelt es sich demnach laut Luhmann lediglich um eine Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit.
Die folgende Arbeit behandelt demnach die Kommunikation des Klimawandels in den Massenmedien bezüglich des Konstruktivismus. Zu Beginn wird in die Thematik des anthropogenen Klimawandels eingeführt, gefolgt von theoretischen Vorannahmen, wie dem Konstruktivismus und der Systemtheorie.
Anschließend wird das System der Massenmedien näher beleuchtet, um dann die Kommunikation des Klimawandels in den Massenmedien herauszukristallisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthropogener Klimawandel
- Theoretische Vorannahmen
- Konstruktivismus
- Systemtheorie
- System der Massenmedien
- Funktionssystem Massenmedien
- Programmbereiche
- Kommunikation des Klimawandels in den Massenmedien
- Wissenschafts- und Massenmediensystem
- Darstellung des Klimawandels in den Medien
- Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kommunikation des Klimawandels in den Massenmedien und untersucht, wie diese Kommunikation zu einer Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit führt, basierend auf der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Ziel ist es, die Komponenten Klimawandel, soziologische Systemtheorie und Medien zu verknüpfen und die Übersetzungs- und Übersetzungsprobleme bei der Darstellung des Klimawandels in den Massenmedien aufzuzeigen.
- Anthropogener Klimawandel und seine Ursachen
- Konstruktivismus und Systemtheorie nach Luhmann
- Das System der Massenmedien und seine Funktionsweise
- Die Kommunikation des Klimawandels in den Medien
- Die Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit im Kontext des Klimawandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des Klimawandels als ein wichtiges gesellschaftliches Problem vor und beschreibt den Forschungsfokus der Arbeit, der auf der Verknüpfung von Klimawandel, Systemtheorie und Medien liegt. Das Kapitel 2 beleuchtet den anthropogenen Klimawandel, seine Ursachen, Folgen und wissenschaftliche Erkenntnisse. Kapitel 3 behandelt die theoretischen Vorannahmen der Arbeit, insbesondere den Konstruktivismus und die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Kapitel 4 stellt das System der Massenmedien nach Luhmann vor, mit besonderem Augenmerk auf seine Funktionen und Programmbereiche. In Kapitel 5 wird die Kommunikation des Klimawandels in den Massenmedien analysiert, wobei die Beziehung zwischen Wissenschafts- und Massenmediensystem, die Darstellung des Klimawandels in den Medien und die daraus resultierende Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Klimawandel, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Massenmedien, Kommunikation, Konstruktion, zweite Wirklichkeit, anthropogener Treibhauseffekt, wissenschaftliche Erkenntnisse, Übersetzungsprobleme.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt Niklas Luhmann die Darstellung des Klimawandels in den Medien?
Nach Luhmann sind Wissenschaft und Massenmedien getrennte soziale Systeme. Die Medien übersetzen wissenschaftliche Daten in ihre eigene Logik, was zwangsläufig zu einer „Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit“ führt.
Warum gibt es „Übersetzungsprobleme“ zwischen Wissenschaft und Medien?
Da beide Systeme unterschiedliche Funktionen und Codes verwenden, kann die mediale Darstellung nie exakt der komplexen wissenschaftlichen Realität entsprechen.
Was bedeutet „Konstruktivismus“ in diesem Zusammenhang?
Konstruktivismus besagt, dass Realität nicht einfach abgebildet, sondern durch Beobachtung und Kommunikation innerhalb eines Systems (hier der Massenmedien) erst erschaffen wird.
Was ist der „anthropogene Klimawandel“?
Es handelt sich um den durch den Menschen verursachten Klimawandel, primär durch den Ausstoß von Treibhausgasen, der in der Arbeit als Ausgangspunkt für die soziologische Analyse dient.
Welche Rolle spielen die Programmbereiche der Massenmedien?
Die Programmbereiche bestimmen, wie Themen wie der Klimawandel selektiert und aufbereitet werden, um Aufmerksamkeit zu generieren und das System der Massenmedien aufrechtzuerhalten.
- Quote paper
- Antje Kalina (Author), 2014, Die Kommunikation des Klimawandels in den Massenmedien. Konstruktion einer zweiten Wirklichkeit nach Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383774