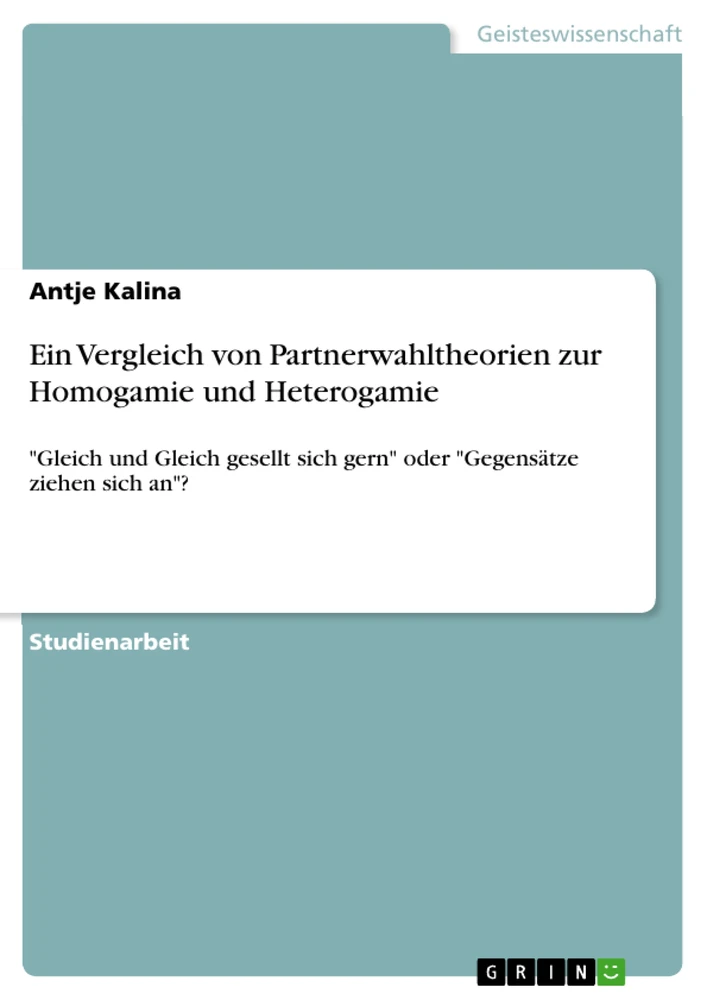Das Thema Liebe und die damit verbundene Wahl des passenden Partners stehen in unserer modernen Gesellschaft im Mittelpunkt des Interesses der Menschen. Die Vielzahl der Publikationen über den Bereich der Partnerwahl zeigt jedoch auch das Interesse der Soziologie an diesem Thema auf.
Dennoch ist Partnerwahl keine moderne Erfindung, denn schon bei früheren Kulturen und auch in den vergangenen Jahrhunderten spielte die Wahl eines passenden Ehepartners eine überaus wichtige Rolle. Dabei fand das Ehepaar nicht durch eine freie Partnerwahl zusammen, die Aufgabe der Partnerwahl fiel stattdessen den Familien und insbesondere dem männlichen Familienoberhaupt zu. So lassen sich bereits in der Vergangenheit Ehen finden, bei der sich die Partner in bestimmten Merkmalen wie dem sozialen Status gleichen, wobei diese homogamen Ehern häufig innerhalb bestimmter sozialer Kreise geschlossen wurden. Andererseits gab es aber auch in der Vergangenheit bereits viele heterogame Ehen, also Ehen, bei denen die Eherpartner über unterschiedliche Merkmale wie den sozialen Status verfügten. So gab es in der Geschichte viele Eheschließungen über soziale Standesgrenzen hinweg, wie sich besonders an der üblichen Aufwärtsheirat von Frauen in der Geschichte zeigt, wodurch Frauen erheblich an sozialem Status gewannen. In modernen westlichen Gesellschaften sind arrangierte Ehen jedoch selten geworden. Stattdessen herrscht das Modell der freien Partnerwahl vor, wobei Ehen vor allem aus Liebe geschlossen werden. Dennoch lässt sich auch in westlichen Kulturen, bei denen die Partnerwahl auf Liebe basiert, eine hohe soziale Strukturierung in Bezug auf den Bildungsgrad, das Alter oder den sozialen Status finden.
Ob sich daraus jedoch ableiten lässt, dass es heute mehr homogame als heterogame Patnerschaften gibt, soll im Laufe dieser Hausarbeit unterscuht werden. Zu Beginn dieser Hausarbeit sollen zunächst die Begriffe Homogamie als auch Heterogamie näher erläutert werden, bevor anschließend verschiedene Partnerwahltheorien vorgestellt werden. Daran anknüpfend soll durch empirische Befunde die Frage beantwortet werden, ob es in unserer modernen Gesellschaft mehr homogame als heterogame Partnerschaften gibt und welche Merkmale hierbei den größten Einfluss haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien zur Partnerwahl
- Theorien der Homogamie
- Theorien der Heterogamie
- Befunde empirischer Studien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Partnerwahl in modernen westlichen Gesellschaften im Kontext von Homogamie und Heterogamie. Sie beleuchtet bestehende Theorien, die diese Phänomene erklären, und analysiert empirische Befunde, um die Frage zu beantworten, ob homogene oder heterogene Partnerschaften überwiegen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit verzichtet auf die Präsentation von Schlussfolgerungen.
- Theorien der Homogamie und Heterogamie
- Analyse der Strukturtheorie nach Blau und der Fokustheorie nach Feld
- Auswertung empirischer Studien zur Partnerwahl
- Der Einfluss von Merkmalen wie Bildung, sozialer Status und Alter auf die Partnerwahl
- Der Vergleich von Homogamie und Heterogamie im Kontext des Heiratsmarktes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Partnerwahl ein und beleuchtet dessen historische und gesellschaftliche Relevanz. Sie kontrastiert traditionelle, arrangierte Ehen mit der modernen, auf Liebe basierenden Partnerwahl in westlichen Gesellschaften. Die Einleitung definiert die Begriffe Homogamie und Heterogamie und skizziert den Aufbau der Hausarbeit, der sich mit Theorien und empirischen Befunden zur Partnerwahl auseinandersetzt, um die Frage nach der Dominanz homogamer oder heterogamer Partnerschaften zu untersuchen.
Theorien zur Partnerwahl: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien zur Partnerwahl, die in homogame und heterogame Ansätze unterteilt werden. Homogamie wird als Ähnlichkeit der Partner in Merkmalen wie Alter, Konfession, sozialer Klasse und Bildung definiert, während Heterogamie das Gegenteil darstellt. Das Kapitel beleuchtet die volkstümlichen Sprichwörter „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ und „Gegensätze ziehen sich an“ als populäre Repräsentationen dieser beiden Konzepte.
2.1 Theorien der Homogamie: Dieser Abschnitt befasst sich genauer mit Theorien, die die Präferenz für homogene Partnerschaften erklären. Im Mittelpunkt steht die Strukturtheorie nach Blau, die die Sozialstruktur und die Verteilung von Individuen auf soziale Positionen betont, wobei die Wahrscheinlichkeit von Partnerschaften mit zunehmender sozialer Distanz sinkt. Die Fokustheorie nach Feld wird ebenfalls vorgestellt, die die Partnerwahl in kleinen, sozial strukturierten Aktionsräumen (Foki) wie Arbeitsplatz oder Vereine verortet. Beide Theorien betonen, wie die räumliche und soziale Nähe die Wahrscheinlichkeit homogamer Partnerschaften erhöht. Die Bedeutung des „meeting-and-mating“-Prinzips wird hervorgehoben, das die Rolle von Gelegenheitsstrukturen bei der Partnerfindung unterstreicht.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Partnerwahl - Homogamie vs. Heterogamie
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Partnerwahl in modernen westlichen Gesellschaften. Sie analysiert Theorien der Homogamie (Ähnlichkeit der Partner) und Heterogamie (Unterschiedlichkeit der Partner) und wertet empirische Befunde aus, um zu untersuchen, welche Art von Partnerschaften überwiegen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu Theorien der Partnerwahl (inkl. Homogamie- und Heterogamie-Theorien, speziell die Strukturtheorie nach Blau und die Fokustheorie nach Feld), eine Zusammenfassung empirischer Studien und ein Fazit.
Welche Theorien zur Partnerwahl werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt verschiedene Theorien der Homogamie und Heterogamie. Im Fokus stehen die Strukturtheorie nach Blau, welche die Bedeutung der Sozialstruktur und der räumlichen Nähe für die Partnerwahl betont, und die Fokustheorie nach Feld, die die Rolle von kleinen, sozial strukturierten Aktionsräumen (Foki) wie Arbeitsplatz oder Vereine hervorhebt. Diese Theorien erklären, warum homogene Partnerschaften häufiger vorkommen.
Welche empirischen Befunde werden untersucht?
Die Arbeit analysiert empirische Studien zur Partnerwahl, um die Frage nach der Dominanz homogamer oder heterogamer Partnerschaften zu beantworten. Die spezifischen Studien werden im Text nicht explizit benannt, aber ihre Ergebnisse werden zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet.
Welche Faktoren beeinflussen die Partnerwahl?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Merkmalen wie Bildung, sozialer Status und Alter auf die Partnerwahl. Die Ergebnisse zeigen, wie diese Merkmale die Wahrscheinlichkeit homogamer oder heterogamer Partnerschaften beeinflussen.
Wie wird Homogamie und Heterogamie definiert?
Homogamie wird definiert als die Ähnlichkeit der Partner in Merkmalen wie Alter, Konfession, sozialer Klasse und Bildung. Heterogamie hingegen bezeichnet das Gegenteil, also die Unterschiedlichkeit der Partner in diesen Merkmalen.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist wie folgt aufgebaut: Einleitung, Theorien zur Partnerwahl (inkl. Unterkapitel zu Homogamie und Heterogamie), Befunde empirischer Studien und Fazit. Die Einleitung stellt das Thema vor und definiert die zentralen Begriffe. Die Kapitel zu den Theorien beschreiben verschiedene Erklärungsansätze für homogene und heterogene Partnerschaften. Die Auswertung empirischer Studien analysiert die Ergebnisse von Forschung zum Thema. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen (obwohl im Text explizit darauf verzichtet wird, Schlussfolgerungen zu präsentieren).
Welche Rolle spielt das "meeting-and-mating"-Prinzip?
Das "meeting-and-mating"-Prinzip wird in der Hausarbeit als wichtiger Faktor für die Partnerwahl hervorgehoben. Es unterstreicht die Bedeutung von Gelegenheitsstrukturen und der räumlichen Nähe für die Partnerfindung und somit die Wahrscheinlichkeit homogamer Partnerschaften.
- Citation du texte
- Antje Kalina (Auteur), 2014, Ein Vergleich von Partnerwahltheorien zur Homogamie und Heterogamie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383785