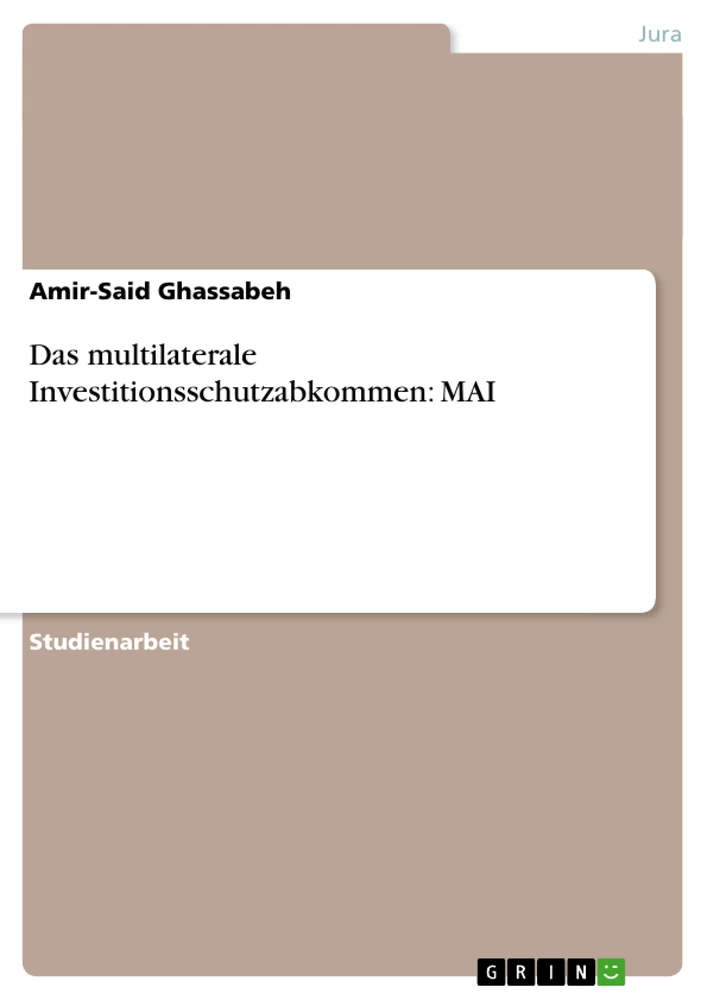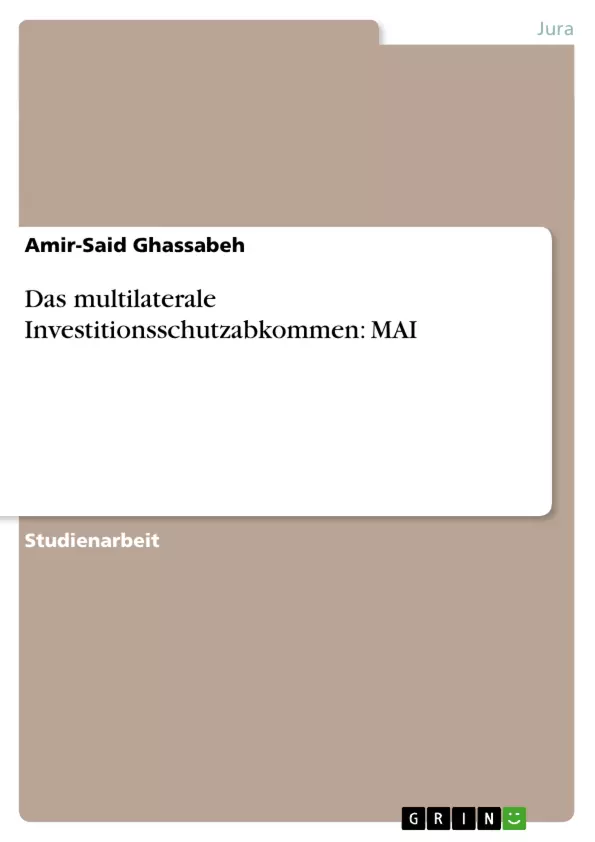Seit Beginn der 90er Jahre unterliegen gemäß einer weitverbreiteten Wahrnehmung die Strukturen einer Weltwirtschaft einem rasanten Wandeln1. Die aktuelle Debatte um die Globalisierung der Wirtschaft hat eine empirische Grundlage in der Wachstumsdynamik grenzüberschreitender Wirtschaftsaktivitäten weltweit. Jene entwickeln sich dynamischer als die binnenländischen. Zwischen 1986 und 1996 wuchs das weltweite Sozialprodukt mit einer durchschnittlichen Rate von 8,5 Prozent, während der Welthandel mit einer Rate von 11 Prozent und die Direktinvestitionen im Ausland mit einer Rate von rund 20 Prozent pro Jahr zunahmen. Allein im Jahr 1995 war eine Zuwachsrate des Volumens der weltweiten ausländ ischen Direktinvestitionen von 32,6 Prozent zu verzeichnen2. Was die heutige Globalisierung von früheren Phasen kapitalistische Entwicklung untersucht, ist zu einem überwiegenden Teil ein Investitionsphänomen. Das Ausmaß internationaler Handelsverflechtungen ist heute nicht wesentlich größer als beispielsweise vor dem Ersten Weltkrieg3. Anders als früher nutzen Unternehmen heute aber ihre neuen Möglichkeiten, sich von ihren heimischen Standorten zu lösen. Die globale Streuung ihrer Aktivitäten erfolgt überwiegend mittels direkter Investitionen im Ausland4. Veränderte Rahmenbedingungen, z.B. Markteröffnungen, neue technische Möglichkeiten und Managementtechniken gehören zu den Faktoren, die eine zunehmende „Globalisierung“ der Produktion ermöglichten, zune hmender Margendruck aufgrund der Wachstumsabschwächung in den Industrienationen bei gleichzeitigem Aufkommen neuer Konkurrenten aus den emerging economies waren Gründe, die sie erzwangen5. 1 Dies gilt vor allem auch für die Struktur der Auslandsinvestitionen. So sind bereits schon seit Ende der sechziger Jahre die intangiblen Investitionen, also diejenigen Investitionen, die in Forschung, Entwicklung, Ausbildung, Softwareentwicklung, „design“ und „engineering“ ergingen, dreimal so schnell wie die tangiblen Investitionen gestiegen (OECD 1992, S.121f). 2 Vgl. UNCTAD 1997, S.4, 303ff, 313ff. 3 Vgl. Hirst/ Thompson, S.204f. 4 Hartwig, S.77. 5 Porter, S.13; Bartlett/ Ghosal, S.20f.
Inhaltsverzeichnis
- DAS MULTILATERALE INVESTITIONSABKOMMEN
- A. EINLEITUNG
- I. Der Weg zu einem internationalen Investitionsabkommen
- 1. Die Globalisierung als Investitionsphänomen
- 2. Bisherige internationale Investitionsregelungen
- II. Idee und Entstehung eines multilateralen Investitionsschutzabkommens
- B. DER ENTWURF DES MULTILATERALEN INVESTITIONSABKOMMEN (MAI)
- I. Ziele des MAI
- II. Geltungsbereich und Anwendung
- III. Behandlung von Investoren und Investitionen
- IV. Schutz von Investitionen
- V. Streitschlichtung
- VI. Generelle und länderspezifische Ausnahmen
- VII. Weitere Abschnitte des MAI- Entwurfs
- C. KRITIK AM MAI UND GRÜNDE FÜR DAS BISHERIGE SCHEITERN
- I. Grundsätzliche Bedenken
- II. Komplexität und Umfang der Verhandlungsmaterie
- III. Asymmetrie des Vertrages
- IV. Entwicklungspolitische Anliegen
- V. Unzureichende Absicherung der Arbeitnehmerrechte
- VI. Der Verhandlungsabruch
- D. PERSPEKTIVEN FÜR EINE „NEUE WELTVERFASSUNG“
- I. Herausforderungen bei künftigen Verhandlungen
- II. Künftige Verhandlungsoptionen
- III. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Multilateralen Investitionsabkommen (MAI), einem internationalen Vertrag, der den Schutz von Investitionen in einem globalisierten Wirtschaftsraum regeln soll. Die Arbeit analysiert die Entwicklung, den Inhalt und die Kritik am MAI und untersucht die Gründe für sein Scheitern. Darüber hinaus werden Perspektiven für ein neues Investitionsabkommen beleuchtet.
- Die Globalisierung als Treiber internationaler Investitionen
- Die Entwicklung und Ziele des MAI
- Kritikpunkte am MAI aus unterschiedlichen Perspektiven
- Die Ursachen für den Verhandlungsabbruch des MAI
- Mögliche Wege für ein neues Investitionsabkommen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung der Globalisierung als treibende Kraft für internationale Investitionen. Es werden die bisherigen internationalen Investitionsregelungen auf verschiedenen Ebenen betrachtet: bilaterale Ebene, multilaterale Ebene (OECD), globale Ebene (WTO) und freiwillige Unternehmensleitsätze. Der zweite Teil analysiert den Entwurf des MAI, beleuchtet seine Ziele, den Geltungsbereich und die zentralen Inhalte. Dazu gehören die Behandlung von Investoren und Investitionen, der Schutz von Investitionen, Streitschlichtung und Ausnahmen.
Kapitel C widmet sich der Kritik am MAI und den Gründen für sein Scheitern. Es werden grundsätzliche Bedenken, die Komplexität des Abkommens, die Asymmetrie des Vertrages, entwicklungspolitische Anliegen, die unzureichende Absicherung der Arbeitnehmerrechte und der Verhandlungsabbruch diskutiert. Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit Perspektiven für ein neues Investitionsabkommen. Herausforderungen bei künftigen Verhandlungen werden beleuchtet, und verschiedene Verhandlungsoptionen werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Globalisierung, internationale Investitionen, Investitionsschutz, multilaterales Abkommen, MAI, Kritik am MAI, Scheitern des MAI, Perspektiven für ein neues Investitionsabkommen, Entwicklung, Inhalte, Streitschlichtung, Arbeitnehmerrechte, Entwicklungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI)?
Das MAI war ein geplanter internationaler Vertrag der OECD-Länder, der den weltweiten Schutz und die Liberalisierung von Auslandsinvestitionen regeln sollte.
Warum ist das MAI-Abkommen gescheitert?
Das Scheitern lag an der hohen Komplexität, der Asymmetrie des Vertrages sowie massivem Widerstand von NGOs und Gewerkschaften.
Was wurde am MAI kritisiert?
Kritiker bemängelten die einseitige Bevorzugung von Investoren, die unzureichende Absicherung von Arbeitnehmerrechten und die Einschränkung staatlicher Handlungsspielräume.
Warum wird Globalisierung als „Investitionsphänomen“ bezeichnet?
Seit den 1980ern wuchsen Direktinvestitionen im Ausland (ca. 20% p.a.) deutlich schneller als das Weltsozialprodukt oder der klassische Warenhandel.
Welche Ziele verfolgte das MAI?
Ziele waren die Inländerbehandlung von ausländischen Investoren, der Schutz vor Enteignung und ein Mechanismus zur Streitschlichtung zwischen Investor und Staat.
- Citation du texte
- Amir-Said Ghassabeh (Auteur), 2002, Das multilaterale Investitionsschutzabkommen: MAI, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38382