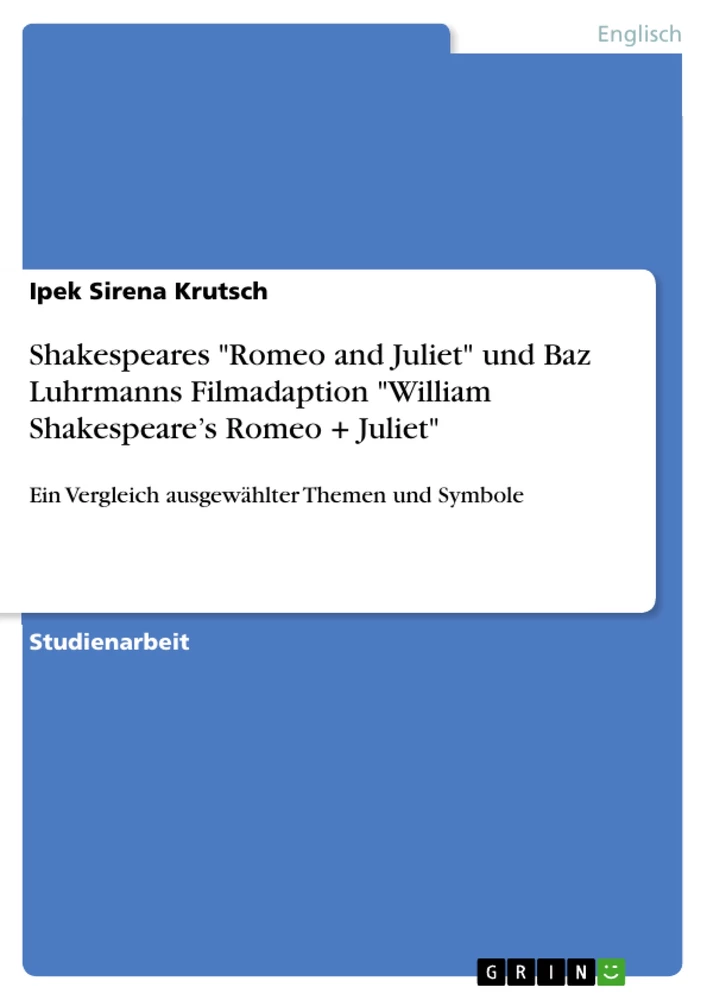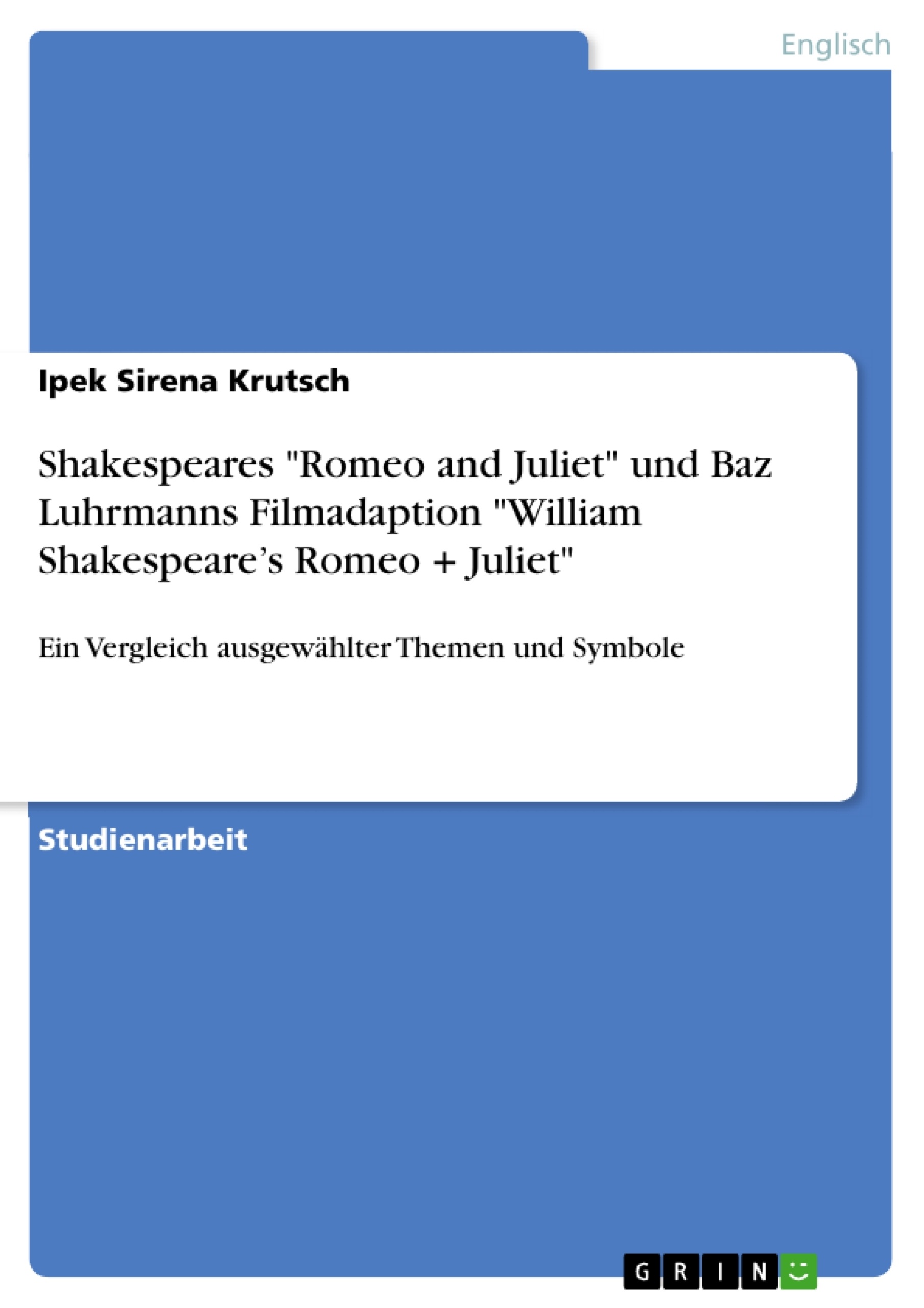Zwei Jahre nach der Premiere seines Filmes „William Shakespeare’s Romeo + Juliet“ tritt der Regisseur des Filmes, Baz Luhrmann, vor ein ausgewähltes Publikum und erklärt seine Gründe, warum er das Bedürfnis verspürt hatte, diesen Film zu machen. Er erklärt seinem Publikum, dass Shakespeare etwas mit allen Leuten im Raum gemeinsam habe, nämlich die Tatsache, dass er in einer Stadt wie London, zu der Zeit mit 400000 Einwohnern, täglich 4000 Menschen, die meist betrunken, grölend oder flegelhaft waren, eine Karte für eine seiner Vorstellungen verkaufen musste. Baz Luhrmann ist der Überzeugung, dass Shakespeare aus diesem Grunde gezwungen war, Stücke zu schreiben, die „aggressiv, sexy, unterhaltsam und voller Action waren“, denn nur dann wären die Zuschauer still gewesen. Weiter ist sich Baz Luhrmann sicher, dass Shakespeare es aber auch gleichzeitig schaffen musste, Stücke mit solchen Inhalten zu verfassen, dass Menschen „verschiedenster Herkunft“ erreicht werden konnten. Viele Kritiker äußerten über Baz Luhrmanns Filmversion des Stückes „Romeo and Juliet“, dass sie eher einer MTV-Produktion gleiche, und nicht mit dem klassischen Stück, sondern eher mit einem modernen Videoclip vergleichbar wäre.
Ziel dieser Hausarbeit ist es nun, durch Analysen von ausgewählten Themen und Symbolen, welche nur ein Bruchteil der möglichen sind, die zum Teil sowohl im Theaterstück als auch im Film zu finden sind, oder aber auch nur in der Filmversion vorliegen, zu zeigen, dass es durchaus möglich sein kann, Shakespeare in einem „neuen“ Gewand darzustellen, ohne ihm oder seiner Intention untreu zu werden. Außerdem ist es ein weiteres Ziel dieser Hausarbeit, die Komplexität und Mehrdimensionalität des Filmes, nicht nur in Hinblick auf das klassische Bühnenstück, sondern auch in Hinblick auf neue Möglichkeiten, die sich aus dem modernen Medium „Film“ ergeben, darzulegen, denn immerhin hat Baz Luhrmann „mehr als ein Jahr für diesen Film recherchiert“ und eins ist sicher: Keine Anspielung ―und sei sie noch so unauffällig― passiert ohne einen wohl überlegten Hintergedanken des Regisseurs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vergleich zwischen Theater zu Shakespeares Zeiten und den Möglichkeiten des Filmes
- Das Theater zu Shakespeares Zeiten und Erwartungen an einen Film
- Themen und Symbole in der Filmadaption von Baz Luhrmann und deren Bedeutung im Hinblick auf das Theaterstück von Shakespeare
- Symbole der Natur
- Die Bedeutung des Wassers
- Die Bedeutung der Gestirne
- Christliche Symbole und der katholische Glaube
- Symbole der Natur
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht ausgewählte Themen und Symbole in Shakespeares „Romeo and Juliet“ und Baz Luhrmanns Filmadaption. Ziel ist es zu zeigen, dass eine moderne Interpretation Shakespeares möglich ist, ohne dessen Intention zu verraten. Die Arbeit beleuchtet auch die Möglichkeiten des Mediums Film im Vergleich zum elisabethanischen Theater.
- Vergleich zwischen elisabethanischem Theater und moderner Filmadaption
- Analyse ausgewählter Symbole in Luhrmanns Film
- Interpretation der Symbole im Kontext des Theaterstücks
- Die Darstellung Shakespeares in einem "neuen Gewand"
- Die Komplexität und Mehrdimensionalität von Luhrmanns Film
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie thematisiert die vermeintliche Kluft zwischen Shakespeare und der Moderne und verweist auf Baz Luhrmanns Motivation, „Romeo and Juliet“ zu verfilmen. Luhrmanns Aussage, Shakespeare habe aufgrund der damaligen Theaterbedingungen Stücke schaffen müssen, die „aggressiv, sexy, unterhaltsam und voller Action“ waren, um ein breites Publikum zu erreichen, wird als Ausgangspunkt der Arbeit verwendet. Die Hausarbeit will zeigen, dass eine moderne Adaption Shakespeares möglich ist, ohne dessen Intention zu verraten, und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten der modernen Filmsprache im Vergleich zum elisabethanischen Theater aufzeigen.
Vergleich zwischen Theater zu Shakespeares Zeiten und den Möglichkeiten des Filmes: Dieses Kapitel vergleicht das elisabethanische Theater mit dem modernen Kino. Es beschreibt das elisabethanische Theater als ein Spektakel für alle Gesellschaftsschichten, das sowohl Unterhaltung als auch einen wichtigen ökonomischen Faktor darstellte. Der Vergleich mit der modernen Filmadaption verdeutlicht, dass auch der Film ein Massenmedium ist, das ein breites Publikum ansprechen muss, ähnlich wie das Theater Shakespeares Zeit. Während das Theater auf die Aufmerksamkeit des Publikums durch die Inszenierung angewiesen war, bietet der Film durch die Möglichkeiten der Kameraführung, des Schnitts und der Musik zusätzliche Werkzeuge der Inszenierung. Der hohe Unterhaltungswert, der im elisabethanischen Theater durch die Inszenierung und die Interaktion mit dem Publikum erzielt wurde, wird im modernen Kino durch die technologischen Möglichkeiten erreicht.
Schlüsselwörter
Shakespeare, Romeo and Juliet, Baz Luhrmann, Filmadaption, elisabethanisches Theater, Symbole, Natur, christlicher Glaube, Vergleich, moderne Interpretation, Massenmedium, Unterhaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Romeo and Juliet": Eine vergleichende Analyse von Shakespeares Theaterstück und Baz Luhrmanns Verfilmung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert ausgewählte Themen und Symbole in Shakespeares "Romeo and Juliet" und vergleicht sie mit Baz Luhrmanns Filmadaption. Ziel ist es, die Möglichkeiten einer modernen Interpretation Shakespeares aufzuzeigen, ohne seine Intention zu verraten, und die Unterschiede zwischen elisabethanischem Theater und moderner Filmadaption zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit vergleicht das elisabethanische Theater mit dem modernen Film als Massenmedien. Sie analysiert Symbole in Luhrmanns Film, insbesondere Natur- und christliche Symbole, und interpretiert deren Bedeutung im Kontext des Theaterstücks. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung Shakespeares in einem "neuen Gewand" und der Komplexität von Luhrmanns Film.
Wie wird der Vergleich zwischen elisabethanischem Theater und Film durchgeführt?
Die Hausarbeit beschreibt das elisabethanische Theater als ein Spektakel für alle Gesellschaftsschichten mit hohem Unterhaltungswert. Der Vergleich mit dem Film zeigt, dass auch der Film ein Massenmedium ist, das ein breites Publikum ansprechen muss. Es werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der Inszenierung (Theater vs. Film) herausgestellt, wobei der Film durch Kameraführung, Schnitt und Musik zusätzliche Werkzeuge bietet.
Welche Symbole werden im Detail analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Natur-Symbole (z.B. Wasser und Gestirne) und christliche Symbole im Kontext des katholischen Glaubens. Die Bedeutung dieser Symbole wird sowohl im Theaterstück als auch in Luhrmanns Film untersucht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit argumentiert, dass eine moderne Adaption Shakespeares möglich ist, ohne dessen Intention zu verraten. Sie zeigt die Vielfältigkeit der Möglichkeiten der modernen Filmsprache im Vergleich zum elisabethanischen Theater auf und hebt den hohen Unterhaltungswert beider Medien hervor.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich zwischen elisabethanischem Theater und Film, ein Kapitel zur Analyse von Themen und Symbolen in Luhrmanns Film und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Shakespeare, Romeo and Juliet, Baz Luhrmann, Filmadaption, elisabethanisches Theater, Symbole, Natur, christlicher Glaube, Vergleich, moderne Interpretation, Massenmedium, Unterhaltung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Hausarbeit enthält detaillierte Analysen und Interpretationen der behandelten Themen.
- Arbeit zitieren
- Ipek Sirena Krutsch (Autor:in), 2005, Shakespeares "Romeo and Juliet" und Baz Luhrmanns Filmadaption "William Shakespeare’s Romeo + Juliet", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383830