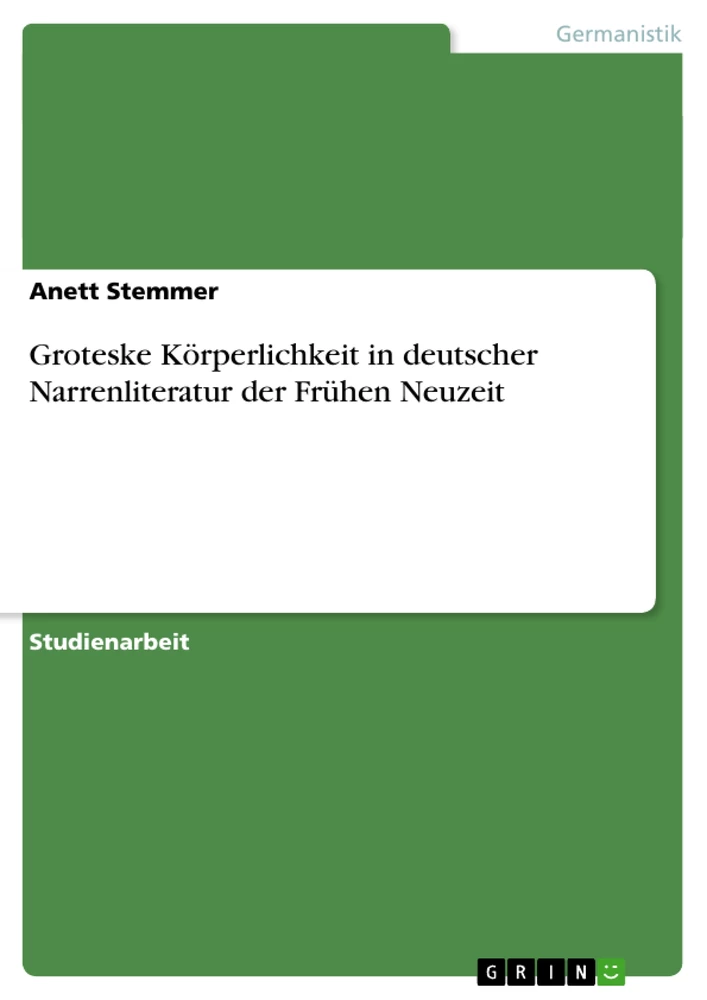Als grotesk erscheint uns alles, was sich mit einem vernünftigen Weltbild nicht vereinbaren lässt. Es ist das Seltsame und Unglaubliche, etwas, das grauenerregende aber auch komische Wirkungen hervorrufen kann – und dieser Zwiespalt macht gerade die Ambivalenz des Grotesken aus. Es ist das, was von dieser herrschenden Ordnung an den Rand gedrängt, ausgrenzt wird, wobei es selbst eine Doppelnatur gewinnt: Als Teil der Kulturordnung hat es die Funktion, sie (wie der Rahmen das Bild) zu stabilisieren. Wenn es als Äußerliches in sie eindringt, hat es die Funktion, sie zu subvertieren. Gemäß der Logik des Sowohl-Als-auch leistet das Groteske beides. […] Die Konzentration auf einen der beiden Aspekte verfehlt die Komplexität des Grotesken. Das Körperliche macht dabei einen Kernbereich des Grotesken aus. Es bildet „einen Bereich des seit je Verborgenen. Der Körper und seine Triebe sind das im Rahmen der Kultivierung des Menschen Marginalisierte, die undisziplinierte Leiblichkeit am Rand der Kulturordnung.“ In der folgenden Arbeit soll es darum gehen, zu untersuchen wie der groteske Körper in literarischen Werken auftreten kann und welche Bedeutungsebenen er eröffnet. Dabei möchte ich zunächst genauer darauf eingehen, was der Begriff des grotesken Körpers eigentlich umfasst, wobei ich mich in erster Linie auf Michail Bachtin beziehe, der diesen Begriff geprägt hat. Danach möchte ich auf die Erscheinungsformen des grotesken Körpers anhand konkreter Werke zu sprechen kommen. Ausgewählt habe ich drei frühneuzeitliche Werke unterschiedlicher Gattungen: Das Fastnachtspiel Der Nasentanz („der nasen-tantz“) von Hans Sachs, wo das Groteske in einen karnevalesken Aufführungszusammenhang eingebettet ist, das Schwankbuch Till Eulenspiegel („Dyl Vlenspiegel“) von Hermann Bote, das groteske Motive zum Gegenstand mehrerer Streiche des Helden macht, und den Roman Das Narrenspital („Der Berühmte Narren-Spital“) von Johann Beer, wo das Groteske eine Art Gegen-Kultur zur Welt der Körperdisziplin darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS KONZEPT DER GROTESKEN KÖRPERLICHKEIT
- Bachtins Modell
- Ergänzungen und Gegenmodelle
- ERSCHEINUNGSFORMEN DES GROTESKEN KÖRPERS UND DEUTUNGSVERSUCHE
- Der verfremdete Körper
- Die Komik des deformierten Körpers im Nasentanz
- „Zannen“ und „Blecken“ im Eulenspiegel
- Verwahrlosung des Körpers im Narrenspital
- Die Inszenierung grotesker Körper
- Der Nasentanz als Dorfspektakel
- Karnevaleskes im Eulenspiegel
- Närrisches Treiben im Narrenspital
- Die „heitere Materie“ als Ausdruck obszöner Körperlichkeit
- Eulenspiegel und die Macht der „,Materie“
- Das Fäkale als Gegenprinzip im Narrenspital
- Der verfremdete Körper
- RÉSUMÉ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung des grotesken Körpers in frühneuzeitlicher deutscher Literatur und beleuchtet die Bedeutungsebenen, die er eröffnet. Dabei wird anhand von drei exemplarischen Werken die Vielseitigkeit des Konzepts des grotesken Körpers ergründet.
- Die Definition und Konzeption des grotesken Körpers im Kontext der Lachkultur des Mittelalters und der Renaissance
- Die Darstellung des grotesken Körpers in literarischen Werken
- Die vielschichtigen Bedeutungen des grotesken Körpers, z.B. Verfremdung, Inszenierung und Subversion
- Die Rolle des grotesken Körpers in der kulturellen Ordnung und seine Verbindung mit der Karnevalszeit
- Die Ambivalenz des Grotesken, die sich durch den Spannungsbogen zwischen Komik, Unheimlichkeit und religiöser Bedeutung zeigt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Groteske Körperlichkeit“ ein und definiert den Begriff des Grotesken als eine Ambivalenz von Seltsamkeit und Komik, die als Teil der Kulturordnung stabilisierend, aber auch subversiv wirken kann. Die Arbeit fokussiert auf das Körperliche als zentralen Aspekt des Grotesken. Sie konzentriert sich auf die Untersuchung des grotesken Körpers in frühneuzeitlicher Literatur und deutet auf die Bedeutungsebenen hin, die er eröffnet.
Im zweiten Kapitel wird das Konzept der grotesken Körperlichkeit anhand des Modells von Michail Bachtin beleuchtet. Es werden die wesentlichen Merkmale des grotesken Körpers erläutert, wie die Aufhebung der Grenzen zwischen Körper und Welt, die „Zweileibigkeit“, und die universelle und kosmische Natur des grotesken Körpers.
Im dritten Kapitel wird die Erscheinungsform des grotesken Körpers in drei ausgewählten Werken der Frühneuzeit beleuchtet: Hans Sachs' „Nasentanz“, Hermann Botes „Eulenspiegel“ und Johann Beers „Narrenspital“. Dabei wird der verfremdete Körper, die Inszenierung grotesker Körper und die „heitere Materie“ als Ausdruck obszöner Körperlichkeit analysiert. Das Kapitel zeigt, wie das Groteske in unterschiedlichen Genres und Kontexten zum Einsatz kommt und welche Bedeutungen es eröffnet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Groteske, Körperlichkeit, Karneval, Lachkultur, Frühneuzeitliche Literatur, Hans Sachs, Hermann Bote, Johann Beer, „Nasentanz“, „Eulenspiegel“, „Narrenspital“, Michail Bachtin, Zweileibigkeit, Komik, Unheimlichkeit, Religion, Subversion, Kulturordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „grotesker Körperlichkeit“ in der Literatur?
Groteske Körperlichkeit bezieht sich auf Darstellungen des Körpers, die sich der herrschenden Ordnung entziehen, oft durch Deformation, Ambivalenz zwischen Komik und Grauen sowie die Aufhebung von Körpergrenzen.
Welche Rolle spielt Michail Bachtin in dieser Analyse?
Bachtin prägte den Begriff des grotesken Körpers im Kontext der Lachkultur des Mittelalters und der Renaissance, wobei er Konzepte wie die „Zweileibigkeit“ und das Karnevaleske betonte.
Wie wird der Körper in Hans Sachs' „Nasentanz“ dargestellt?
Im „Nasentanz“ wird die Komik des deformierten Körpers in einem karnevalesken Aufführungszusammenhang inszeniert, was die Ambivalenz des Grotesken verdeutlicht.
Welche Bedeutung hat das Fäkale in Johann Beers „Narrenspital“?
Das Fäkale dient im „Narrenspital“ als Gegenprinzip zur Welt der Körperdisziplin und repräsentiert eine Art Gegen-Kultur zur herrschenden Ordnung.
Inwiefern ist Till Eulenspiegel ein Beispiel für groteske Motive?
Hermann Botes Werk nutzt den grotesken Körper durch Motive wie „Zannen“ und „Blecken“ sowie die Macht der „Materie“, um gesellschaftliche Normen zu subvertieren.
- Citation du texte
- Anett Stemmer (Auteur), 2004, Groteske Körperlichkeit in deutscher Narrenliteratur der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38397